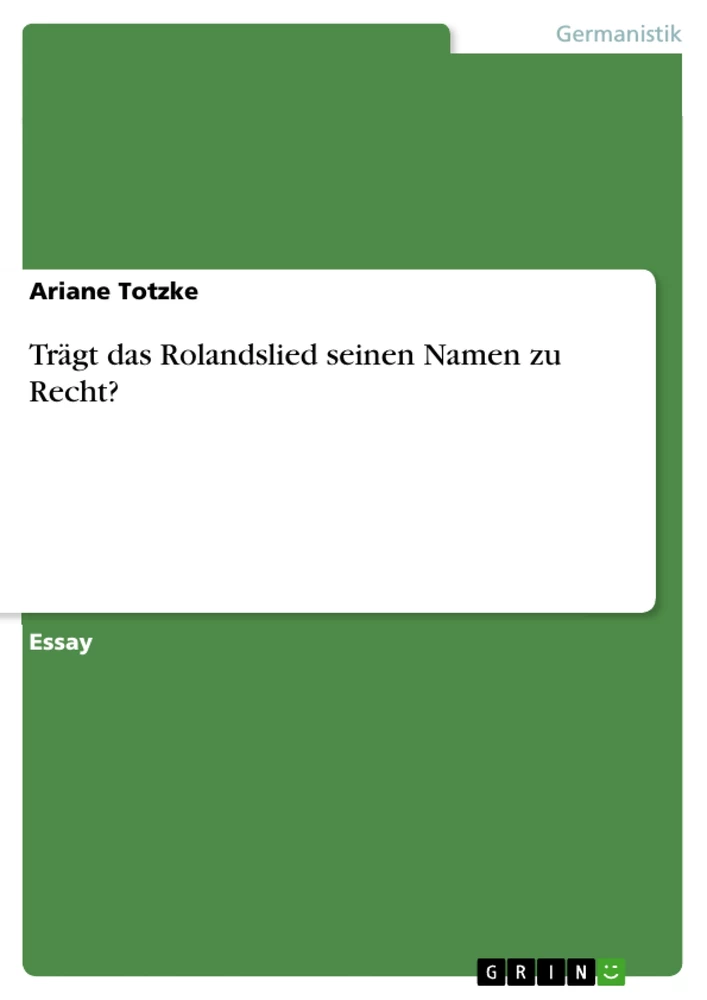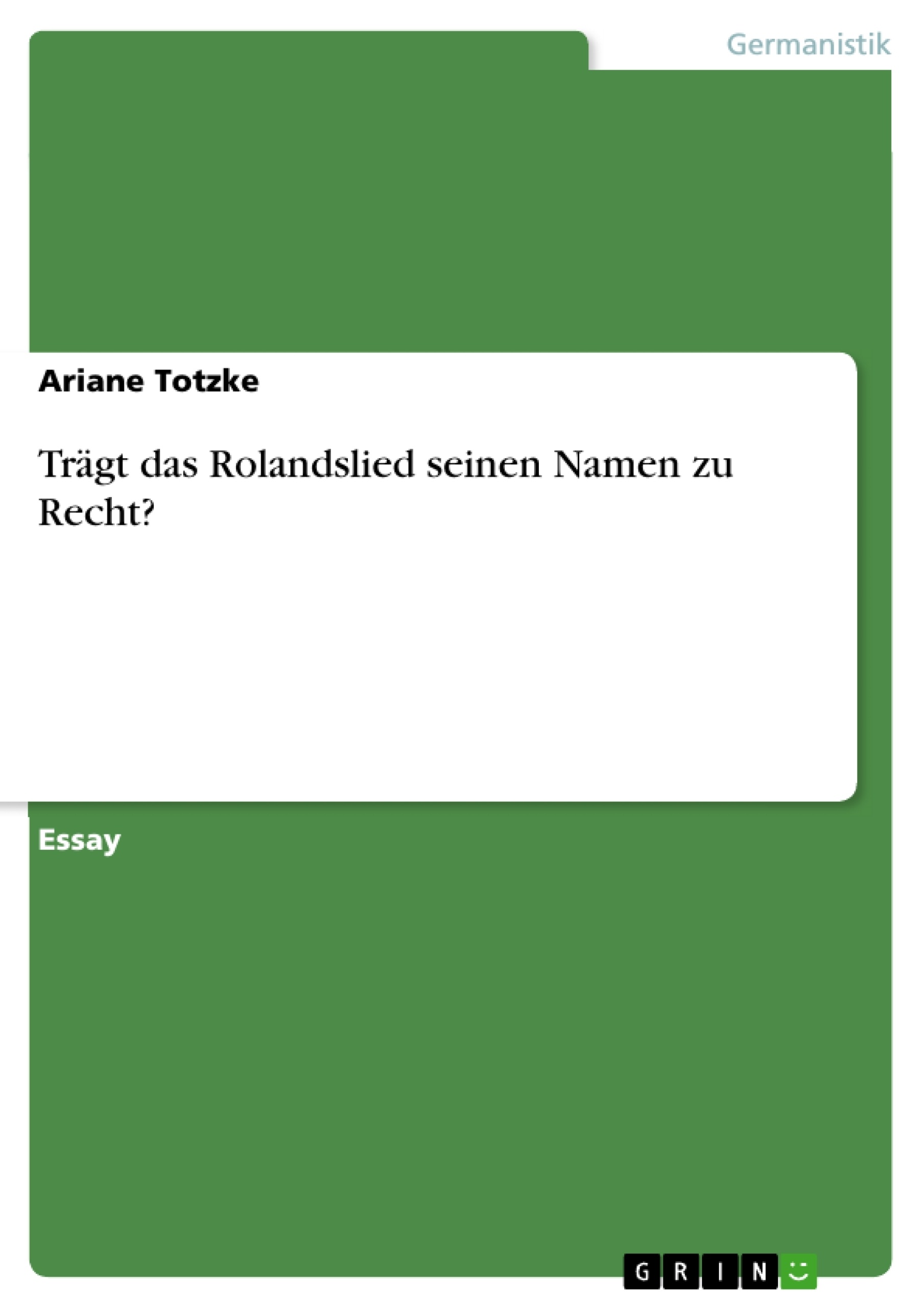Das Hauptaugenmerk des Essays liegt auf der Kontroverse, ob das Rolandslied nicht vielmehr ein ‚Karlslied‘ und ob das deutsche Rolandslied demnach nicht eher eine Adaption als eine reine Übertragung seines Vorbildes ist.
Trägt das Rolandslied seinen Namen zu Recht?
Um die Frage, ob das Rolandslied seinen Namen zu Recht trägt, zu beantworten, erweist es sich als zentral, seine Vorlage – die Chanson de Roland –in die Untersuchung mit einzubeziehen. Denn wäre das Rolandslied eine bloße Übersetzung der Chanson, so müsste der Titelnicht in Frage gestellt werden. Mein Hauptaugenmerk liegt folglich auf der Kontroverse, ob das Rolandslied nicht vielmehr ein ‚Karlslied‘ und ob das deutsche Rolandslied demnach nicht eher eine Adaption als eine reine Übertragung seines Vorbildes sei.[1] Dreh- und Angelpunkt zur Beantwortung der Frage ist also die Art und Weise der Verarbeitung des Karlsstoffes: Handelt es sich bei der deutschen Fassung der Chanson de Roland um eine Heldendichtung, wie es das Vorbilddiktiert, oder wurde es durch Abwandlung des Pfaffen Konrad vielmehr zu einer „geistlich geprägten Buchdichtung“?[2] Anhand der Darstellung der Karlsfigur werde ich, angelehnt an die wissenschaftliche Debatte, die These vertreten, dass durch einen thematischen Wandel von der Chanson hin zum Rolandslied ebenso der Titel hätte verändert werden sollen, wie es beispielsweise gleichfalls bei einer weiteren Verarbeitung des deutschen Rolandsliedes vorkommt; im 13. Jahrhundert schuf Der Stricker eine Neufassung des Rolandsliedes und nannte diese Karl.Da jene Neufassung des Strickers durch thematische Erweiterung und Ummotivierung des Vorbildes zu einem kaiserfreundlichen Karlsepos wurde, hätte es zu Recht einen neuen, besser passenden Titel verdient.
Die Übersetzung des Rolandsliedes wurde von dem Fürsten Heinrich der Löwe in Auftrag gegeben. Es scheint der Versuch Heinrichs zu sein, sich ‚karlsgleich‘ als königlich feiern zu lassen, da auch er selbst an kreuzzugsähnlichen Gefechten gegen heidnische Slawen teilgenommen hat und sich als Nachfolger Karls empfand.[3] Im Epilog des Rolandsliedes wird Heinrich sogar mit König David gleichgesetzt:
Nune mügen wir in disem zîte
dem küninge Dâvîte
niemen sô wol gelîchen
sô den herzogen Hainrîchen.[4]
Dieser Punkt in der Entstehungsgeschichte des Rolandsliedes, die Verehrung Karls von Heinrich dem Löwen, spricht ebenso dafür, dass der Titel ungenau ist – da es sich augenscheinlich um eine Karlsdichtung handelt. Auch auf der Figurenebene lässt sich diese These weiter untermauern:Karl, als historische Gestalt, kann anhand vieler Quellen und Zeugnisse nachvollzogen werden, während Rolands historischer Nachweis eher etwas ‚dunkel‘ erscheint. Erwähnt wird er ausschließlich in einer Handschrift namens Vita Karoli Magni von Einhard. Hier taucht er als Gefallener des gescheiterten Spanienfeldzuges auf, bei dem die französische Nachhut bei Roncesvalles im Jahr 778 von den Basken überfallen wurde.[5]
[...]
[1] Diese Fragestellung ist in der wissenschaftlichen Diskussion vertreten. Ich beziehe mich vor allem auf folgende zwei Titel: Elisabeth Lienert: Das „Rolandslied“ des Pfaffen Konrad. In: Bremisches Jahrbuch 84 (2005), S. 78-96. Wolfgang Spiewok: Karl und Roland: Funktionswandel bei Adaption und Rezeption. In: Danielle Buschinger/Wolfgang Spiewok (Hgg.): Zum Traditionsverständnis in der mittelalterlichen Literatur. Greifswald 1991, S. 117-138.
[2] Lienert, S. 82.
[3] Vgl. Lienert, S. 84.
[4] Das Rolandslied des Pfaffen Konrad. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Hrsg., übersetzt und kommentiert von Dieter Kartschoke. Stuttgart 1993. V. 9039-9042. Ab hier RL.
Häufig gestellte Fragen zum Rolandslied
Trägt das Rolandslied seinen Namen zu Recht?
Die Frage, ob das Rolandslied seinen Namen zu Recht trägt, wird untersucht, indem die Vorlage, die Chanson de Roland, in die Analyse einbezogen wird. Es wird argumentiert, dass, wenn das Rolandslied eine reine Übersetzung der Chanson wäre, der Titel nicht in Frage gestellt werden müsste. Die zentrale Kontroverse ist, ob das Rolandslied nicht vielmehr ein ‚Karlslied‘ ist und ob es sich um eine Adaption anstatt einer Übersetzung handelt.
Was ist der Dreh- und Angelpunkt zur Beantwortung der Frage nach dem passenden Titel?
Der Dreh- und Angelpunkt ist die Art und Weise der Verarbeitung des Karlsstoffes. Es wird untersucht, ob es sich bei der deutschen Fassung der Chanson de Roland um eine Heldendichtung handelt oder um eine geistlich geprägte Buchdichtung.
Welche These wird bezüglich des Titels vertreten?
Die These ist, dass durch einen thematischen Wandel von der Chanson hin zum Rolandslied auch der Titel hätte verändert werden sollen, ähnlich wie bei der Neufassung des Rolandsliedes durch Der Stricker, der diese Karl nannte.
Wer gab die Übersetzung des Rolandsliedes in Auftrag?
Die Übersetzung des Rolandsliedes wurde von dem Fürsten Heinrich der Löwe in Auftrag gegeben.
Welchen Zweck hatte Heinrich der Löwe bei der Übersetzung des Rolandsliedes?
Es wird vermutet, dass Heinrich der Löwe versuchte, sich ‚karlsgleich‘ als königlich feiern zu lassen, da er selbst an kreuzzugsähnlichen Gefechten gegen heidnische Slawen teilgenommen hat und sich als Nachfolger Karls empfand. Im Epilog wird er sogar mit König David gleichgesetzt.
Welche historische Basis hat die Figur des Roland im Vergleich zu Karl?
Karl als historische Gestalt kann anhand vieler Quellen und Zeugnisse nachvollzogen werden, während Rolands historischer Nachweis eher unsicher ist. Roland wird ausschließlich in einer Handschrift namens Vita Karoli Magni von Einhard erwähnt.
- Quote paper
- Ariane Totzke (Author), 2009, Trägt das Rolandslied seinen Namen zu Recht?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191875