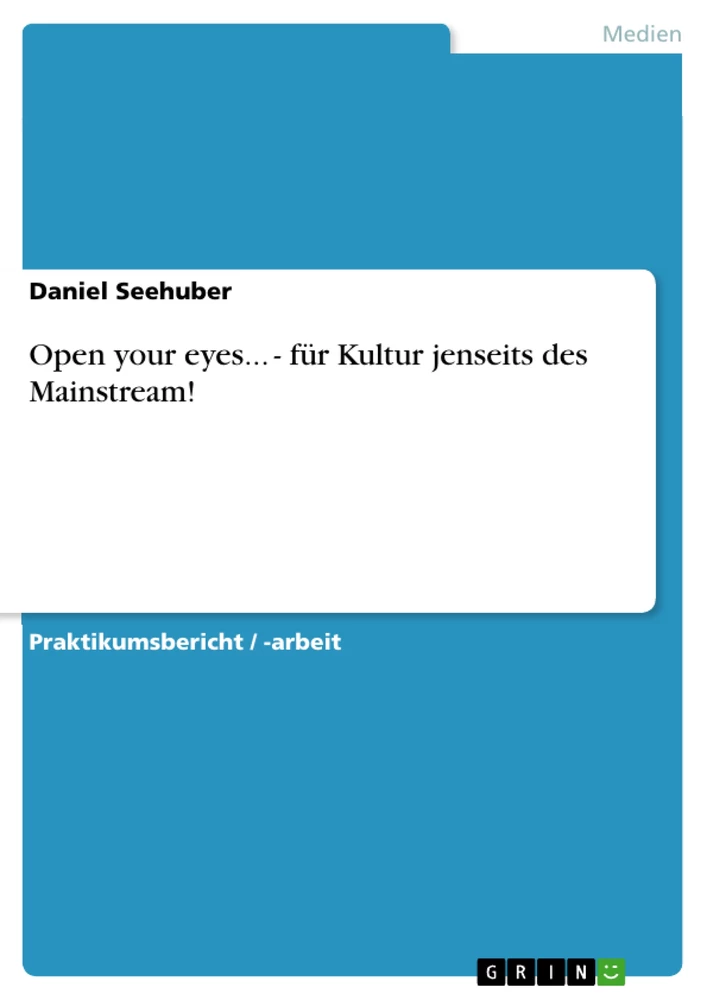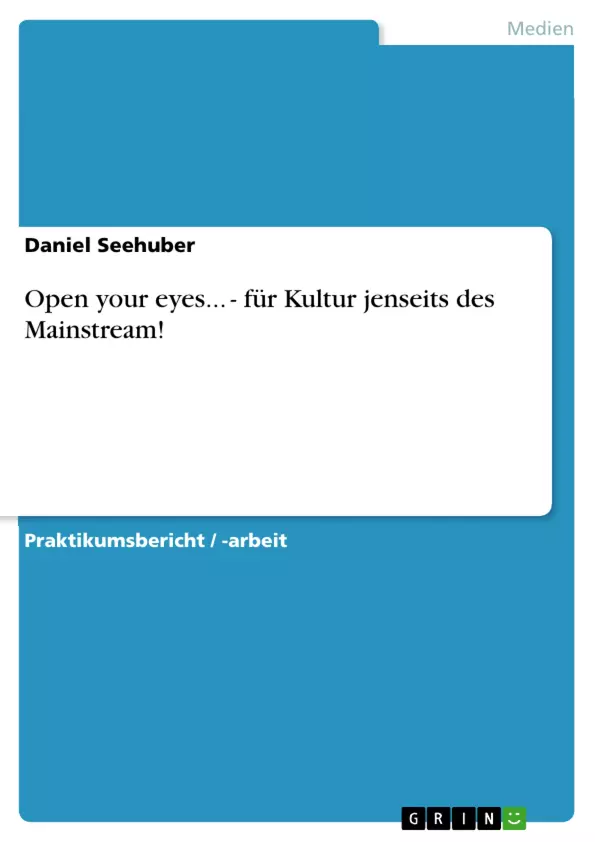Bereits zu Beginn meines medienwissenschaftlichen Studiums wurde ich durch eine Tutorin
auf das Café Trauma aufmerksam gemacht. Mit soziokulturellen Zentren hatte ich bis dahin
zwar keine Erfahrungen gemacht, dennoch keimten in mir zunächst negative Assoziationen
auf, wobei ich solche Institutionen im Wesentlichen als 'Auffangort' für gesellschaftliche
Randgruppen einstufte. Doch um mein Filmwissen auszubauen, besuchte ich regelmäßig
Vorführungen des Traumakinos, zumal ich mich dafür interessierte, Filmkulturen zu erleben,
die im Mainstream-Programm größerer Kinos ausgeblendet werden. Ich war zunächst über
die organisatorischen Strukturen verwundert, die gemäß des Selbstverständnisses von
soziokulturellen Zentren durch Selbstverwaltung und fehlende Hierarchien geprägt sind. Da
jedem Mitarbeiter - unabhängig von Talent und Vorerfahrung - die Möglichkeit gegeben
wird, seine Vorstellungen von Kultur umzusetzen, konnte ich mir kaum vorstellen, dass
dieses Prinzip erfolgreich praktiziert werden kann. Doch als ich mich während des zweiten
Semesters im Rahmen des Seminars Kulturarbeit und Erwachsenenbildung im Sektor „Film“
u.a. an der Organisation eines im Café Trauma stattfindenden Filmfestivals beteiligte,
verflüchtigten sich meine Bedenken. So wurden in Vorträgen die Funktionsweisen und
Tätigkeitsfelder von (sozio)kultureller Arbeit erläutert; zudem lernte ich die institutionellen
Abläufe des Café Trauma näher kennen und konnte mich davon überzeugen, dass das nichthierarchische
Prinzip größtenteils erfolgreich Anwendung findet.
Trotz des positiven Eindrucks kam es für mich zunächst nicht in Frage, mein
Pflichtpraktikum beim Café Trauma zu absolvieren. Dieses wollte ich vielmehr bei einem
hochkarätigen Unternehmen machen, um meinen Lebenslauf aufzuwerten. Da ich mich seit
jeher für Radio und Fernsehen interessiere, bewarb ich mich bei größeren Sendern und erhielt
von Hit Radio FFH eine Zusage. Doch in der Folgezeit wurde mir von ehemaligen
Praktikanten vermittelt, dass die Arbeitsbedingungen dort nicht zufriedenstellend seien und
hierarchische Strukturen oftmals zur Ausgrenzung von Praktikanten führen. So entwickelte
ich die Idee, mich beim hierarchiefreien Café Trauma zu bewerben, um meine fachlichen und
überfachlichen Qualifikationen in einem weit gefächerten Arbeitsfeld, das die Organisation
von Kino- und Tanzveranstaltungen sowie Konzerten und Vorträgen beinhaltet, adäquat
einsetzen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Hauptteil
- 2.1 Die Praktikumseinrichtung
- 2.1.1 Das Café Trauma
- 2.1.2 Das OpenEyes Filmfest
- 2.2 Tätigkeitsbereiche während des Praktikums
- 2.2.1 Festivalplanung und -Durchführung
- 2.2.2 Filmjury und Programmheft
- 2.2.3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 2.2.4 Filmverwaltung
- 2.3 Studium und Praxis: Jenseits des Mainstream
- 2.1 Die Praktikumseinrichtung
- Kapitel 3: Bilanz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Praktikumsbericht befasst sich mit den Erfahrungen des Autors während seines Praktikums im Café Trauma, einem soziokulturellen Zentrum in Marburg, im Rahmen des OpenEyes Filmfests. Der Bericht beleuchtet die Funktionsweise und Organisation des Café Trauma, die verschiedenen Tätigkeitsbereiche des Autors während des Praktikums und die Bedeutung von Filmfestivals im Kontext der British Cultural Studies.
- Das Café Trauma als soziokulturelles Zentrum und dessen Rolle in der Marburger Kulturlandschaft
- Die Organisation und Durchführung des OpenEyes Filmfests
- Die Bedeutung von Filmfestivals für die Förderung von unabhängigem und nicht-kommerziellem Film
- Der Zusammenhang zwischen dem Ansatz der British Cultural Studies und der Bedeutung von Filmfestivals
- Die Bedeutung von Selbstverwaltung und ehrenamtlicher Arbeit im soziokulturellen Bereich
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel beleuchtet die anfängliche Skepsis des Autors gegenüber soziokulturellen Zentren, seine Erfahrungen mit dem Café Trauma und die Entwicklung seiner Entscheidung, dort sein Praktikum zu absolvieren. Der Autor beschreibt seine Motivation, sich mit alternativen Filmkulturen jenseits des Mainstreams auseinanderzusetzen, und seine anfänglichen Bedenken gegenüber der Selbstverwaltung und dem hierarchiefreien Prinzip des Café Trauma.
Kapitel 2: Hauptteil
2.1 Die Praktikumseinrichtung
Dieses Kapitel beschreibt das Café Trauma und das OpenEyes Filmfest. Der Autor stellt die Geschichte und die organisatorische Struktur des Café Trauma vor, beschreibt die verschiedenen Angebote und Veranstaltungen, die das Zentrum bietet, und beleuchtet die besondere Rolle des Traumakinos im Kontext von nicht-kommerziellem Film.
2.2 Tätigkeitsbereiche während des Praktikums
Dieses Kapitel erläutert die Aufgaben und Tätigkeitsbereiche des Autors während seines Praktikums, die von der Festivalplanung und -durchführung über die Filmjury und das Programmheft bis hin zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und der Filmverwaltung reichten.
2.3 Studium und Praxis: Jenseits des Mainstream
Dieses Kapitel befasst sich mit der gesellschaftlichen Bedeutung von Filmfestivals und soziokulturellen Zentren, ihre Entwicklung in Deutschland, und den Zusammenhang mit dem Ansatz der British Cultural Studies. Der Autor zeigt auf, wie seine Praktikumserfahrungen die Bedeutung von Selbstverwaltung und die Förderung unabhängiger Filmkultur im Kontext der British Cultural Studies illustrieren.
Schlüsselwörter
Café Trauma, OpenEyes Filmfest, soziokulturelles Zentrum, Selbstverwaltung, Filmfestival, unabhängiger Film, British Cultural Studies, Filmkultur, Mainstream, Medienwissenschaft, Praktikum, Marburg.
Häufig gestellte Fragen
Was zeichnet das Café Trauma in Marburg aus?
Es ist ein soziokulturelles Zentrum, das durch Selbstverwaltung und das Fehlen von Hierarchien geprägt ist und Raum für Kultur jenseits des Mainstreams bietet.
Was ist das OpenEyes Filmfest?
Ein jährlich stattfindendes Filmfestival im Café Trauma, das sich auf unabhängige und nicht-kommerzielle Kurzfilme konzentriert.
Welche Aufgaben übernimmt ein Praktikant beim OpenEyes Filmfest?
Die Aufgaben reichen von der Festivalplanung und Filmauswahl (Jury) über die Pressearbeit bis hin zur technischen Verwaltung der Filme.
Wie hängen British Cultural Studies und soziokulturelle Arbeit zusammen?
Der Ansatz der British Cultural Studies betont die Bedeutung von Alltagskultur und die Förderung von Subkulturen, was sich in der Arbeit hierarchiefreier Zentren wie dem Café Trauma widerspiegelt.
Warum ist Selbstverwaltung in der Kulturarbeit wichtig?
Sie ermöglicht es allen Beteiligten, unabhängig von Vorerfahrungen eigene kulturelle Vorstellungen umzusetzen und fördert eine demokratische Teilhabe an der Kulturlandschaft.
- Quote paper
- Daniel Seehuber (Author), 2010, Open your eyes... - für Kultur jenseits des Mainstream!, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191888