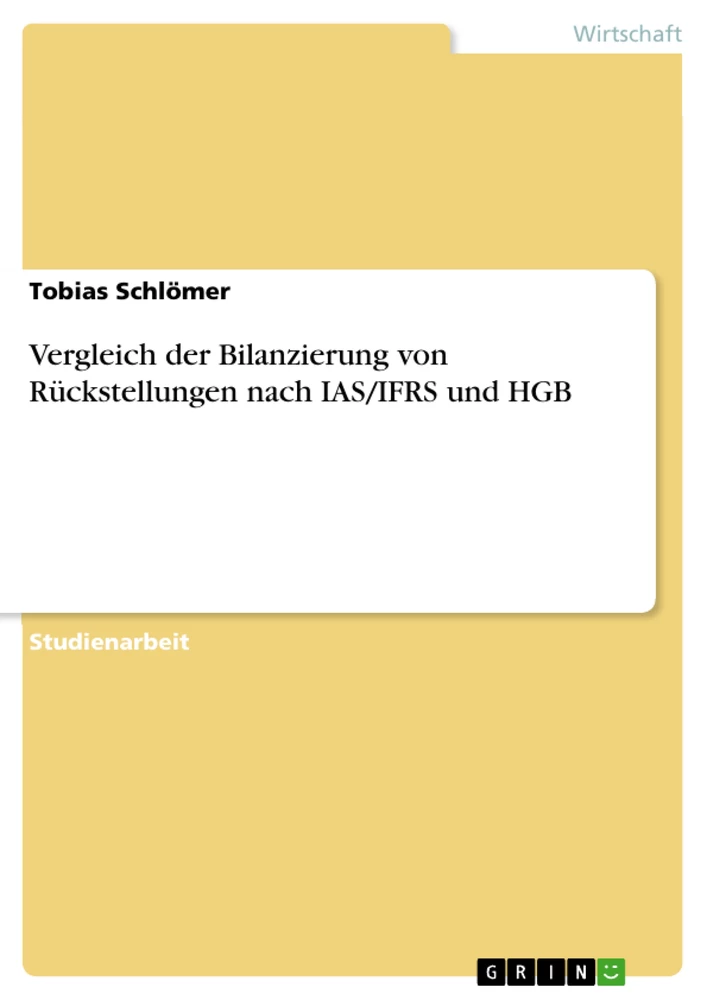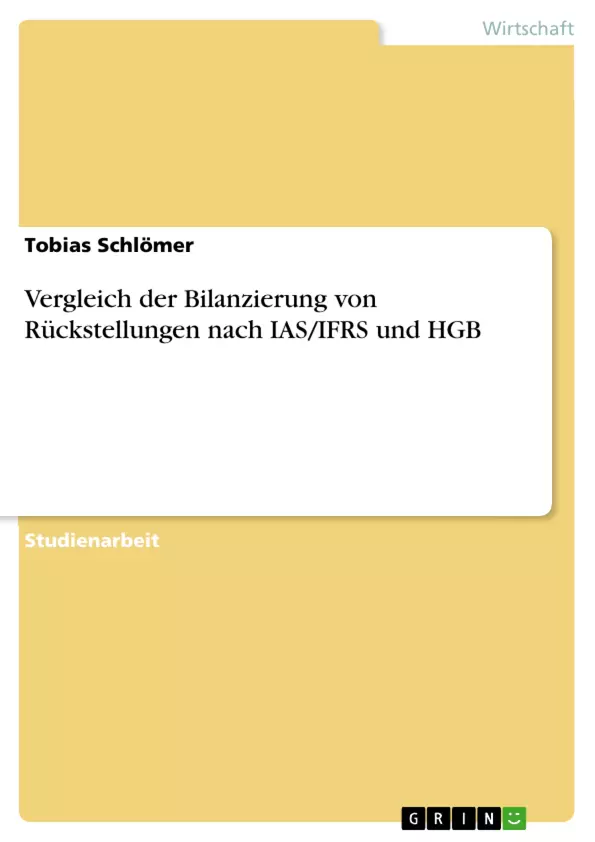Einleitung mit Zielsetzung der beiden Rechnungslegungsvorschriften sowie Gang der Untersuchung:
Das Handelsrecht verfolgt mit seinen Rechnungslegungsvorschriften das vorrangige Ziel, die Gläubiger des Bilanzierenden zu schützen. Sie sind nach dem HGB die bedeut-samsten Adressaten von Jahresabschlüssen. Die Rechnungslegungszwecke nach IAS/IFRS sind hingegen anlegerorientiert. Hier stellen Investoren die Hauptadressaten von Jahresabschlüssen dar. Im Gegensatz zum Handelsrecht sind vorrangig die Anleger zu schützen.
Die Intention dieser Arbeit ist es, dem Leser hinsichtlich der zum Teil unterschiedlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften einen vergleichenden Überblick zu verschaffen. Zur Realisierung dieses Ziels sieht die Gliederung des Hauptteiles vor, im zweiten Kapitel „Rückstellungen nach Handelsrecht“ und im dritten Kapitel „Rückstellungen nach IAS/IFRS“ hinsichtlich Ansatz und Bewertung ausführlich darzustellen. Das anschlie-ßende vierte Kapitel befasst sich mit der Darlegung der wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Rechnungslegungsstandards, bevor die Schlussbetrachtung diese Seminararbeit komplettiert. Um bereits frühzeitig im Hauptteil einen trennscharfen Vergleich zu ermöglichen, beginnen die weiteren Untergliederungspunkte des zweiten und dritten Kapitels jeweils mit Erklärungen der Begrifflichkeiten (Definitionen). Um darüber hinaus Stringenz und Übersichtlichkeit zu gewährleisten, folgen anschließend in der weiteren Untergliederung der Kapitel zwei und drei jeweils die Darstellungen der einzelnen Ansatz- und Bewertungsvorschriften. Das vergleichende und zusammenfassende Kapitel vier „Wesentliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede nach HGB und IAS/IFRS“ legt die Ergebnisse dieser Untersuchung dar.
Angesichts des einzuhaltenden Umfanges dieser Seminararbeit sei bereits an dieser Stelle erwähnt, dass Pensionsrückstellungen, aufgrund der Vielzahl an Besonderheiten, Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb der beiden Rechnungslegungssysteme, in dieser Seminararbeit nicht näher erläutert werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung mit Zielsetzung der beiden Rechnungslegungsvorschriften sowie Gang der Untersuchung
- Rückstellungen nach Handelsrecht
- Begrifflichkeiten
- Ansatz von Rückstellungen nach HGB
- Ziele der Rückstellungsbildung
- Verbindlichkeitsrückstellungen
- Aufwandsrückstellungen
- Bewertung von Rückstellungen nach HGB
- Allgemeine Bewertungsgrundsätze
- Besondere Bewertungsgrundsätze
- Rückstellungen nach IAS/IFRS
- Begrifflichkeiten
- Ansatz von Rückstellungen nach IAS/IFRS
- Voraussetzungen für Rückstellungen
- Verbindlichkeitsrückstellungen
- Bewertung von Rückstellungen nach IAS/IFRS
- Allgemeine Bewertungsgrundsätze
- Besondere Bewertungsgrundsätze
- Wesentliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede nach IAS/IFRS und HGB
- Übereinstimmungen nach HGB und IAS/IFRS
- Gemeinsamkeiten des Ansatzes
- Gemeinsamkeiten der Bewertung
- Abweichungen nach HGB und IAS/IFRS
- Ansatzunterschiede
- Bewertungsunterschiede
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Vergleich der Bilanzierung von Rückstellungen nach den Rechnungslegungsvorschriften IAS/IFRS und HGB. Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Regelwerke aufzuzeigen, um ein besseres Verständnis für die spezifischen Anforderungen und Auswirkungen der jeweiligen Vorschriften zu erlangen.
- Begrifflichkeiten und Ansatz von Rückstellungen
- Bewertungsgrundsätze und Methoden für Rückstellungen
- Wesentliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Bilanzierung
- Einfluss der Rechnungslegungsvorschriften auf die Unternehmenspraxis
- Auswirkungen der unterschiedlichen Vorschriften auf die Vergleichbarkeit der Bilanzierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Zielsetzung der beiden Rechnungslegungsvorschriften IAS/IFRS und HGB sowie den Gang der Untersuchung beschreibt. Anschließend werden Rückstellungen nach Handelsrecht (HGB) definiert und die Voraussetzungen für deren Ansatz und Bewertung erläutert. Dabei werden insbesondere die Unterscheidung zwischen Verbindlichkeitsrückstellungen und Aufwandrückstellungen sowie die verschiedenen Bewertungsgrundsätze und -methoden im Detail behandelt. Das dritte Kapitel widmet sich den Rückstellungen nach IAS/IFRS. Hier werden die spezifischen Anforderungen des internationalen Rechnungslegungsstandards, insbesondere die Voraussetzungen für den Ansatz und die Bewertung von Rückstellungen, vorgestellt. Dabei werden auch die Unterschiede zu den Vorgaben des HGB deutlich gemacht. Im vierten Kapitel werden die wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Bilanzierung von Rückstellungen nach IAS/IFRS und HGB analysiert. Dazu werden die Übereinstimmungen im Ansatz und in der Bewertung sowie die Abweichungen in beiden Bereichen untersucht. Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung, die die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst und die Relevanz der unterschiedlichen Vorschriften für die Unternehmenspraxis herausstellt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen der Arbeit sind Rückstellungen, IAS/IFRS, HGB, Bilanzierung, Rechnungslegung, Ansatz, Bewertung, Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Unternehmenspraxis, Vergleichbarkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied in der Zielsetzung von HGB und IFRS?
Das HGB verfolgt primär den Gläubigerschutz und das Vorsichtsprinzip. Die IAS/IFRS sind dagegen anlegerorientiert und zielen darauf ab, entscheidungsrelevante Informationen für Investoren bereitzustellen.
Wie unterscheiden sich die Voraussetzungen für den Ansatz von Rückstellungen?
Während das HGB auch Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zulässt, fordern IFRS zwingend eine Außenverpflichtung gegenüber Dritten für die Bildung einer Rückstellung.
Wie werden Rückstellungen nach HGB bewertet?
Nach HGB erfolgt die Bewertung zum nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag, wobei zukünftige Preis- und Kostensteigerungen teils anders berücksichtigt werden als nach IFRS.
Welche Besonderheit gilt für Rückstellungen nach IAS 37?
Nach IAS 37 muss eine Rückstellung gebildet werden, wenn ein Abfluss von Ressourcen wahrscheinlich ist und die Höhe verlässlich geschätzt werden kann („Best Estimate“).
Warum werden Pensionsrückstellungen in dieser Arbeit nicht behandelt?
Aufgrund der hohen Komplexität und der Vielzahl an spezifischen versicherungsmathematischen Unterschieden zwischen den Systemen würden Pensionsrückstellungen den Rahmen dieser Seminararbeit sprengen.
Was sind Verbindlichkeitsrückstellungen?
Dies sind Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber Dritten, bei denen entweder die Höhe oder der Zeitpunkt des Eintritts am Bilanzstichtag noch ungewiss sind.
- Arbeit zitieren
- Tobias Schlömer (Autor:in), 2011, Vergleich der Bilanzierung von Rückstellungen nach IAS/IFRS und HGB, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191940