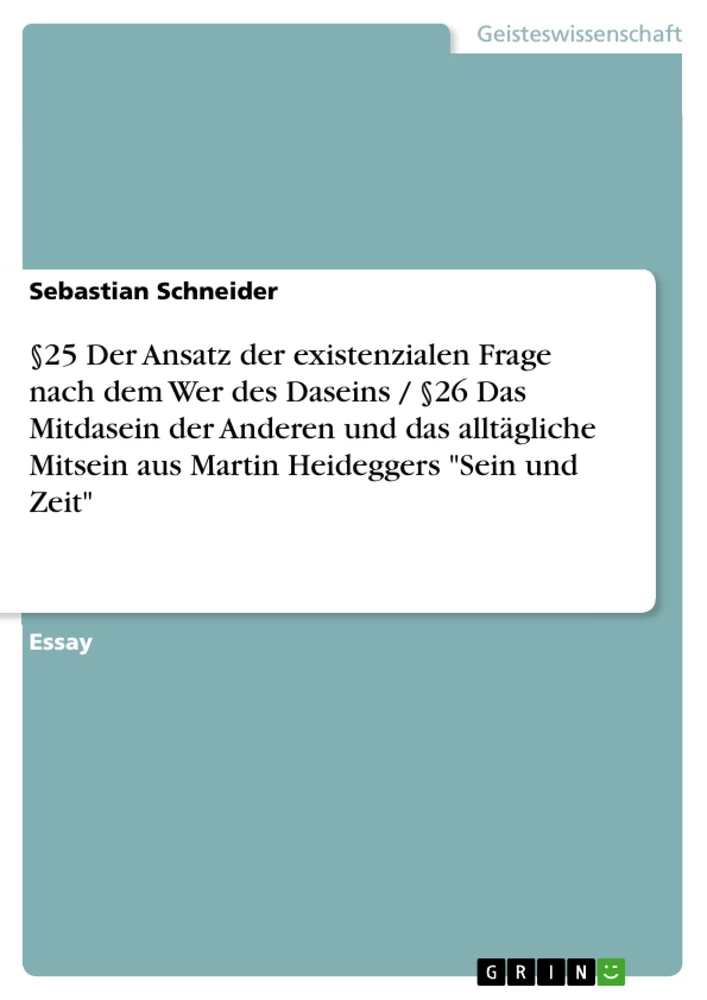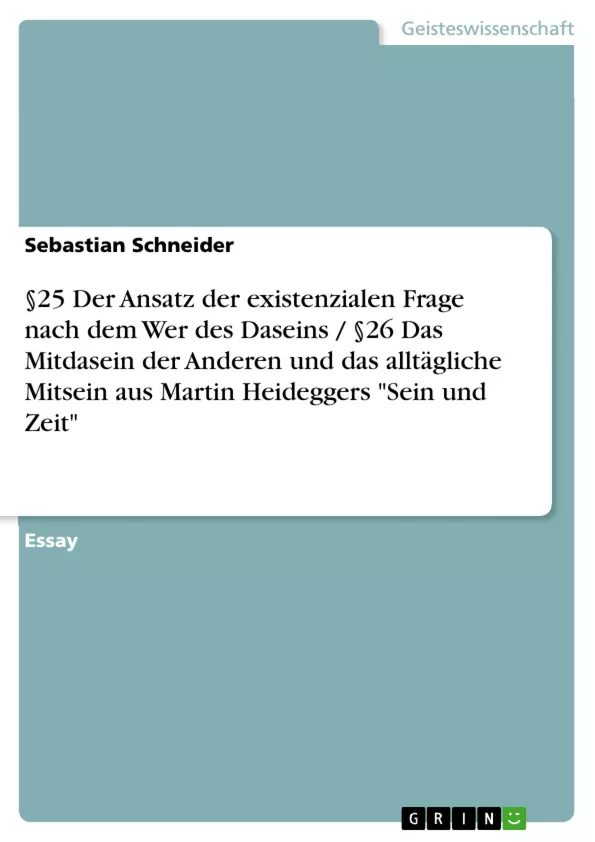Bisher hat Heidegger die Welt als Bewandtnisganzheit zunächst ohne ausdrückliche Berücksichtigung der Vielheit von Dasein behandelt. Dieser „Vielheit“ widmet sich Heidegger ab dem vierten Kapitel von SuZ, indem er nach der Identität des Daseins fragt1, um das Existenzial „Weltlichkeit“ genauer fassen zu können. Wer ist es, der in der Alltäglichkeit identisch mit dem Dasein ist, bzw. wer ist es, der in der Alltäglichkeit als Dasein fungiert? Dasein wurde von Heidegger als eine Struktur beschrieben und die Frage, die sich nun stellt, ist, wer exemplifiziert diese Struktur? Die nahe liegende Antwort, je ich selbst und das letztendlich als etwas „allein existierendes“2, wird von Heidegger zurückgewiesen. Eine erste Antwort auf diese Frage, liefert Heidegger in §25. Erstmals in dem Paragraphen 9 und anschließend ausführlicher in Paragraph 12, wurde deutlich, dass Heidegger die Vorstellungen von einem Selbst, Ich oder Subjekt (im Sinne der cartesianischen Substanz res cogitans oder des Husserlschen Ichs als Subjekt von Akten) ablehnt. Denn dies würde nebenbei bemerkt bedeuten, dass wir bereits schon wissen, was mit dem Ich gemeint ist. Mit der Ablehnung dieser Begriffe macht Heidegger darauf aufmerksam, dass jene (Ich, Selbst, Subjekt) keine geeigneten Kandidaten für die Frage „wer das Dasein ist“ darstellen, da diese Begriffe auf dem ontologischen Fundament der Vorhandenheit fussen.3
Inhaltsverzeichnis
- Viertes Kapitel: Das In-der-Welt-sein als Mit- und Selbstsein. Das >>Man<<
- §25 Der Ansatz der existenzialen Frage nach dem Wer des Daseins
- §26 Das Mitdasein der Anderen und das alltägliche Mitsein
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Kapitel von Heideggers "Sein und Zeit" untersucht die Identität des Daseins und die Bedeutung des "Mitseins" und "Mitdaseins". Es hinterfragt die traditionelle Vorstellung des Subjekts und entwickelt eine alternative Perspektive auf die menschliche Existenz.
- Die Identität des Daseins und die Ablehnung des cartesischen Subjekts
- Das Mitsein und Mitdasein als konstitutive Elemente des Daseins
- Die Unterscheidung zwischen Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit
- Das Phänomen des "Man" als Ausdruck der Alltäglichkeit
- Die Rolle der "Bewandtnis" im Verständnis der Welt
Zusammenfassung der Kapitel
Viertes Kapitel: Das In-der-Welt-sein als Mit- und Selbstsein. Das >>Man<<: Dieses Kapitel befasst sich mit der zentralen Frage nach der Identität des Daseins. Heidegger widerlegt die Vorstellung eines isolierten, selbständigen Subjekts und führt die Konzepte des "Mitseins" und "Mitdaseins" ein. Er argumentiert, dass Dasein immer schon in Beziehung zu anderen Daseinen steht, und diese Beziehung konstitutiv für das Verständnis der menschlichen Existenz ist. Die "Alltäglichkeit", verkörpert im "Man", wird als ein Modus des Daseins beschrieben, der sich von der "Eigentlichkeit" abhebt. Heidegger analysiert die Rolle von "Zeug" und "Bewandtnis" um zu veranschaulichen, wie Dasein in ein Geflecht von Beziehungen und Bezügen eingebunden ist, wodurch die Welt als "Mitwelt" verstanden wird. Die Frage nach dem "Wer" des Daseins bleibt zwar zunächst offen, doch wird ein grundlegendes Verständnis des Daseins als Mitsein und Mitdasein etabliert, das auf die weiteren Kapitel verweist.
Schlüsselwörter
Dasein, Mitsein, Mitdasein, Eigentlichkeit, Uneigentlichkeit, Alltäglichkeit, Man, Bewandtnis, Weltlichkeit, Zeug, Sein, Heidegger, Existenzial.
Heideggers "Sein und Zeit": Kapitel 4 - FAQs
Was behandelt Kapitel 4 von Heideggers "Sein und Zeit"?
Kapitel 4, "Das In-der-Welt-sein als Mit- und Selbstsein. Das >>Man<<", befasst sich zentral mit der Identität des Daseins. Heidegger widerlegt die Vorstellung eines isolierten Subjekts und führt die Konzepte des "Mitseins" und "Mitdaseins" ein, die konstitutiv für das Verständnis der menschlichen Existenz sind.
Welche Kernkonzepte werden in Kapitel 4 eingeführt oder diskutiert?
Wichtige Konzepte sind: Mitsein, Mitdasein, Eigentlichkeit, Uneigentlichkeit, Alltäglichkeit, das "Man", Bewandtnis, Weltlichkeit und Zeug. Diese Konzepte helfen Heidegger, die Verbundenheit des Daseins mit anderen und die Eingebundenheit in die Welt zu beschreiben.
Was versteht Heidegger unter "Mitsein" und "Mitdasein"?
Heidegger argumentiert, dass Dasein immer schon in Beziehung zu anderen Daseinen steht. "Mitsein" und "Mitdasein" beschreiben diese grundlegende Verbundenheit und zeigen, dass die menschliche Existenz nicht isoliert, sondern immer schon relational ist.
Was ist die Bedeutung des "Man" in Heideggers Analyse?
Das "Man" repräsentiert die Alltäglichkeit, einen Modus des Daseins, der sich von der "Eigentlichkeit" abhebt. Es beschreibt ein unreflektiertes, konformes Dasein, das sich in anonymen Verhaltensweisen und Meinungen verliert.
Wie unterscheidet Heidegger zwischen Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit?
Eigentlichkeit bezeichnet ein authentisches, reflektiertes Dasein, das sich seiner eigenen Existenz und Verantwortung bewusst ist. Uneigentlichkeit hingegen beschreibt das "Man"-hafte Dasein, das sich in der Anonymität der Masse verliert und die eigene Authentizität verkennt.
Welche Rolle spielen "Bewandtnis" und "Zeug" im Verständnis der Welt?
"Bewandtnis" beschreibt die Bedeutung und den Zusammenhang von Dingen in der Welt. "Zeug" bezieht sich auf die Dinge, die uns umgeben und mit denen wir in Beziehung stehen. Beide Konzepte veranschaulichen, wie Dasein in ein Geflecht von Beziehungen und Bezügen eingebunden ist, wodurch die Welt als "Mitwelt" verstanden wird.
Welche Frage bleibt am Ende von Kapitel 4 offen?
Obwohl ein grundlegendes Verständnis des Daseins als Mitsein und Mitdasein etabliert wird, bleibt die Frage nach dem "Wer" des Daseins zunächst offen und wird in den folgenden Kapiteln weiter untersucht.
Welche Schlüsselwörter sind mit Kapitel 4 verbunden?
Schlüsselwörter sind: Dasein, Mitsein, Mitdasein, Eigentlichkeit, Uneigentlichkeit, Alltäglichkeit, Man, Bewandtnis, Weltlichkeit, Zeug, Sein, Heidegger, Existenzial.
- Quote paper
- Sebastian Schneider (Author), 2011, §25 Der Ansatz der existenzialen Frage nach dem Wer des Daseins / §26 Das Mitdasein der Anderen und das alltägliche Mitsein aus Martin Heideggers "Sein und Zeit", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191977