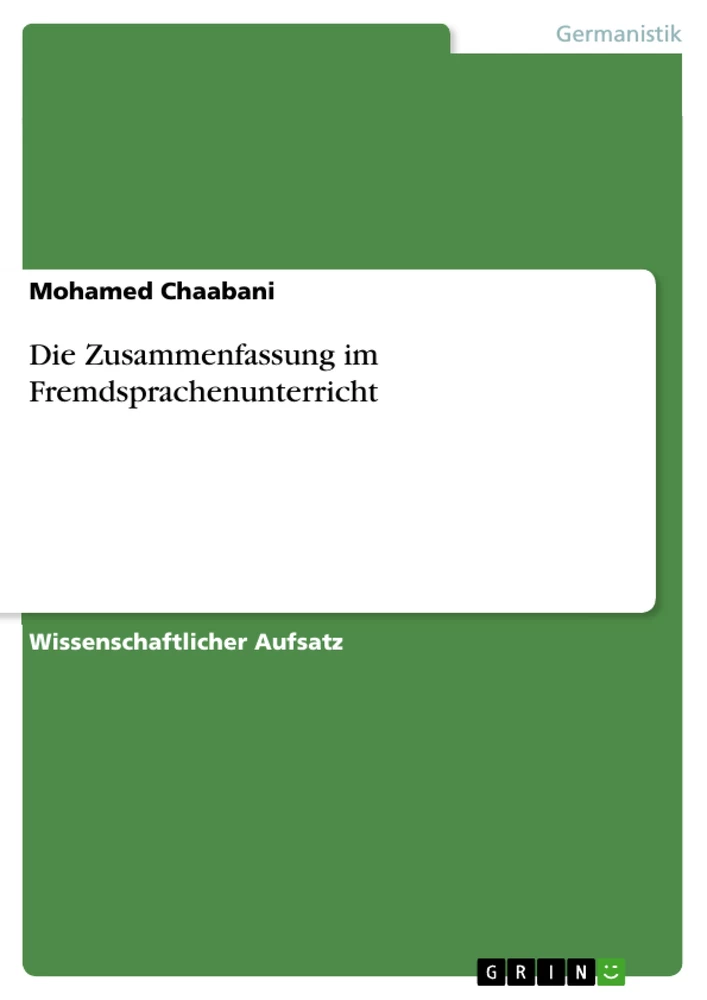Abstract
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Textsorte „die Zusammenfassung“ auseinander. Im Studium sind die Studenten in fast allen Fachbereichen aufgefordert, Texte zusammenzufassen. Deshalb scheint es notwendig, diese Textsorte zu untersuchen. Es werden Zusammenfassungen, die von Probanden verfasst sind, analysiert.
Abstract
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Textsorte „die Zusammenfassung“ auseinander. Im Studium sind die Studenten in fast allen Fachbereichen aufgefordert, Texte zusammenzufassen. Deshalb scheint es notwendig, diese Textsorte zu untersuchen. Es werden Zusammenfassungen, die von Probanden verfasst sind, analysiert.
Die Zusammenfassung
Die Studenten und Schüler sind meistens mit der Aufgabe konfrontiert, Artikel oder Texte schriftlich zusammenzufassen. Deswegen kommt dem Schreiben von Zusammenfassungen im FU eine besondere Bedeutung zu. Aus den Ausführungen von Steets, A.[1] (2007, 83) lässt sich entnehmen, dass Zusammenfassen eine zentrale reproduktiv-produktive sprachliche Handlung sei. In Anlehnung an Weber-Wulff (2007) lässt sich der Vorgang der Zusammenfassung in vier Schritte erfolgen:[2]
Zuerst sollte sich der Schreibende einen Überblick über den Text verschaffen. Dies lässt sich mithilfe der Textüberschrift und des Untertitels realisieren, d.h. der Titel und der Untertitel sollten Hinweise über den Inhalt des Textes geben. Darüber hinaus könnte das Verschaffen eines Überblicks anhand der Einleitung oder der ersten Sätze erfolgen, die einen Überblick über den Textinhalt geben. Ansonsten könnte auch ein Text durch seinen Schluss verstanden werden, denn im Schluss stellt man die Resultate der Textsinhalte vor.
Als zweiten Schritt stellt man Fragen über den Text, z.B. was ist das Problem? Was sind die Hintergründe, Anlässe und Ursachen? Wie ist das Problem zu bewerten?
Als dritten Schritt kommt die Phase des genauen Lesens und Gliederns. Hier sollte man den Text genauer lesen und dabei sollten folgende Hilfsmittel mit einbezogen werden: Das Unterstreichen von wichtigen Textstellen. Zudem können Notizen gemacht werden, d.h. man notiert die wichtigen Informationen im Text in Stichpunkten. Beim Lesen sollte man die inhaltliche Struktur des Textes berücksichtigen, z.B. Einleitung, Hauptteil, Schluss oder den Argumentationsverlauf des Textes. Überdies sollte man ebenfalls versuchen, einen Überblick über die Denkschritte des Verfassers und seine Absichten zu bekommen. Als vierten Schritt versucht man, die wesentlichen Gedanken mit eigenen Worten schriftlich wiederzugeben und dabei sollte die inhaltliche und formale Gliederung des Textes beachtet werden. Zudem sollte eine Zusammenfassung mit einem sachlichen Stil geschrieben werden, d.h. persönliche Urteile oder eigene Meinungen finden hier keinen Platz. Darüber hinaus werden Fragen und Ausrufe sowie indirekte Rede durch Aussagesätze oder direkte Rede ersetzt. Es wird auf schmückende Einzelheiten verzichtet und meistens sind die Zusammenfassungen in der Präsensform geschrieben.
In diesem Zusammenhang findet sich bei Ehlich (2003) auch die Auffassung, dass die schriftliche Zusammenfassung die häufig praktizierte Schreibaufgabe in der Schule sei.[3] Diese Schreibform bezieht sich sowohl auf sachliche als auch auf literarische Texte, wobei sie das Lesen von Texten unterstützt, indem sie zum besseren Textverständnis verhilft. Ehlich führt weiterhin aus, dass die Zusammenfassung als nützliche Schreibübung betrachtet ist, denn sie versetzt die Schreibenden in die Lage, das Wesentliche aus einem Text herauszunehmen, d.h. dabei werden die Schreiber trainiert, Unwichtiges von Wichtigem zu unterscheiden. Auch sollen die Schreibenden das Wesentliche eines Textes mit wenigen Wörtern wiedergeben.
Was die Textsorte Zusammenfassung[4] angeht, finden sich die folgenden Ausführungen von Krischer, B. (2002, 390). Typisch für die Textsorte Zusammenfassung können die Schreiber die Schlüsselwörter des vorliegenden Texts herausschreiben. Im Weiteren können die Lernenden die Inhalte des Textes mithilfe des Titels und der Zwischentitel erahnen. Zur Erschließung des Textes können die Lerner folgende Fragen auflisten und beantworten. Was wissen die Lerner bereits über das Thema und was möchten sie noch erfahren? In dieser Phase könnten auch Nachschlagwerke eingesetzt werden wie zum Beispiel Wörterbücher. Bevor die Schreiber in die Phase der Formulierung übergehen, sollten sie einen Schreibplan entwerfen, indem sie mit einer Textvorlage arbeiten. Dabei sollten sie wie folgt an ihre Arbeit herangehen. Zuerst lesen die Lerner den Originaltext und unterstreichen oder markieren sie hierbei die wichtigen Stellen des Textes. Falls sie auf schwierigen Wörtern oder Sätzen stoßen, könnten sie sie beispielsweise im Wörterbuch nachschlagen oder fragen sie einfach den Lehrer. Anschließend sollten die Lerner ihre Schreibziele auf einem aufschreiben. Nachfolgend fangen sie mit einem systematischen Lesen des Originaltextes, das nach ihren Schreibplan erfolgt. Es ist auch hinzuweisen, dass dieser Schreibplan vorläufig ist, denn es stellt nur eine grobe Strukturierung der Arbeit. Die feine Planung beginnt mit den ersten Formulierungen. Bei der Phase der Formulierung sollten die Schreibenden als ersten Schritt den originalen Text noch einmal Wort für Wort durchlesen. Diese Maßnahme scheint erforderlich, um sicherzugehen, ob sie den Inhalt des Textes erschlossen haben. Noch einmal sollten ebenso prüfen, ob die alle wichtigen Textstellen markiert sind. Bei den Markierungen sollte sie sowohl Wörter als auch Wortgruppen, die die Zusammenhänge im Text erklären. Des Weiteren sollten die erste anfertigte Gliederung, wo die einzelnen Ideen und Inhalte in eine logische Abfolge gebracht sind, nachgeprüft werden. Nach diesen Maßnahmen formulieren die Schreiber ihre ersten Sätze für die Zusammenfassung. Dabei ist es empfehlenswert, dass sie mit kürzeren Sätzen anfangen. Sie können für diesen Zweck Nominalisierungen und Attribuierung wie Partizipialattribut gebrauchen.
Hier werden auch Sätze laut Krischer, B. (2002, 390). kombiniert und hierbei sollten sie als Ziel im Auge behalten, dass eine Zusammenfassung nur kurze überschaubare Informationen enthält. Demzufolge sind die Lerner angehalten, den Text sprachlich und inhaltlich zu reduzieren. Zur Unterstützung diesen Vorgang können Formulierungshilfen in Form von Redemitteln eingesetzt werden. Nachdem die Lernenden ihre Zusammenfassungen formuliert haben, gehen sie als Nächstes in die Phase der Überarbeitung über. Bevor die Lernenden mit den Überarbeitungen anfangen, sollten sie ihre Texte, wenn es möglich ist, einen Tag beiseite lassen. Hier braucht man zuerst Distanz zum Text, damit sie sich auf die Überarbeitung konzentrieren können. Die Überarbeitung basiert auf der Überprüfung von zwei Aspekten. Der Text[5] muss einerseits für den Leser verständlich sein. Anderseits muss er alle Anforderungen, die einen Text gestellt werden, gerecht werden. Die Überarbeitung erfolgt auf drei Ebenen. Die inhaltliche und die sprachliche Revision sowie die Perspektivierung. Angefangen mit der inhaltlichen Revision sollten die Schreiber folgenden Fragen nachgehen. Sind alle wichtigen Informationen aufgenommen? Sind diese wichtigen Punkte so angeordnet, dass sie logisch und nachvollziehbar für den Leser sind? Sind diese Punkte je nach ihrer Relevanz angeordnet? Sind möglicherweise Aspekte wiederholt oder mehrmalig erwähnt? Als Nächstes sollte sich die Überarbeitung auf die sprachliche Ebene beziehen. Hier ist die Rede von der Makrostruktur des Textes. Ebenso werden hier folgenden Fragen[6] nachgegangen. Fehlen im Text sprachliche Formulierungen für die Versprachlichung der wichtigen Inhaltspunkte? Sind verschiedene Pro-Formen für die jeweiligen Referenzträger verwendet? Sind vor- und rückverweisende Mittel eingesetzt? Sind für den Zweck der Begründungen Konjunktionen verwendet? Können Sätze aus dem Text ausgelassen werden, ohne dass keine wesentlichen Inhaltspunkte fehlen. Was die Perspektivierung angeht, sollten hier ebenfalls folgenden Fragen nachgegangen werden. Was war das Ziel des Schreibers? Was wollte der Schreiber hinsichtlich des Lesers erreichen? Ist der verfasste Text angebracht, diesen Zweck zu erfüllen? Wie würde der Schreiber als Leser auf den geschriebenen Text reagieren?
[...]
[1] Steets, A. (2007), Schreiben. In: Deutsch Methodik. Handbuch für die Sekundarstufe I und II. Gisela Beste (Hrsg.). Berlin. Cornelsen
[2] Weber-Wulff, aus www.f4.fhtw-berlin.de/weberwu/lib/protokoll-schreiben.html. Zugriff am 02.02.2007
[3] Ehlich, Konrad. Schulische Textarten, universitäre Textarten und das Problem ihrer Passung, Mitteilungen des Deutschen Germanistikverbandes, 50 Jahrgang, Heft 2-3 /2003.
[4] Krischer, B. Schreiben- aber wie? Ein Planunngsmodell. Info DaF Informationen Deutsch als Fremdsprache. Nr. 5 29. Jahregang. 2002. S.390
[5] Ebd.
[6] Ebd.
Häufig gestellte Fragen
In welche vier Schritte lässt sich das Zusammenfassen gliedern?
1. Überblick verschaffen, 2. Fragen an den Text stellen, 3. Genaues Lesen und Gliedern, 4. Wesentliche Gedanken mit eigenen Worten wiedergeben.
Warum ist das Zusammenfassen im Fremdsprachenunterricht wichtig?
Es schult das Textverständnis, hilft Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und trainiert die sprachliche Reduktionsfähigkeit.
Welcher Stil sollte in einer Zusammenfassung verwendet werden?
Ein sachlicher Stil im Präsens ist erforderlich. Eigene Meinungen, Ausschmückungen oder direkte Rede sollten vermieden werden.
Was ist bei der Überarbeitung einer Zusammenfassung zu prüfen?
Man sollte auf inhaltliche Vollständigkeit, logische Abfolge, sprachliche Korrektheit (Konnektoren, Pro-Formen) und die Verständlichkeit für den Leser achten.
Wie helfen Titel und Untertitel beim Zusammenfassen?
Sie geben erste Hinweise auf das Hauptthema und die inhaltliche Struktur, was den Einstieg in die Textanalyse erleichtert.
Was bedeutet „reproduktiv-produktive sprachliche Handlung“?
Es bedeutet, dass Informationen aus einer Vorlage aufgenommen (reproduziert) und in einer neuen, eigenen sprachlichen Form wiedergegeben (produziert) werden.
- Arbeit zitieren
- Mohamed Chaabani (Autor:in), 2012, Die Zusammenfassung im Fremdsprachenunterricht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192122