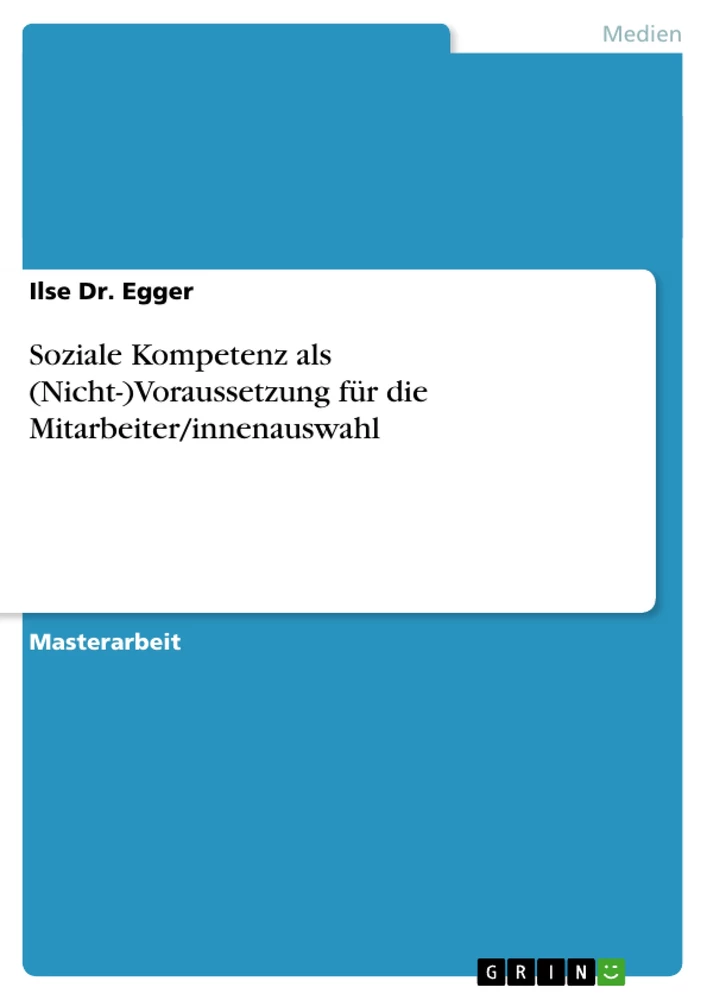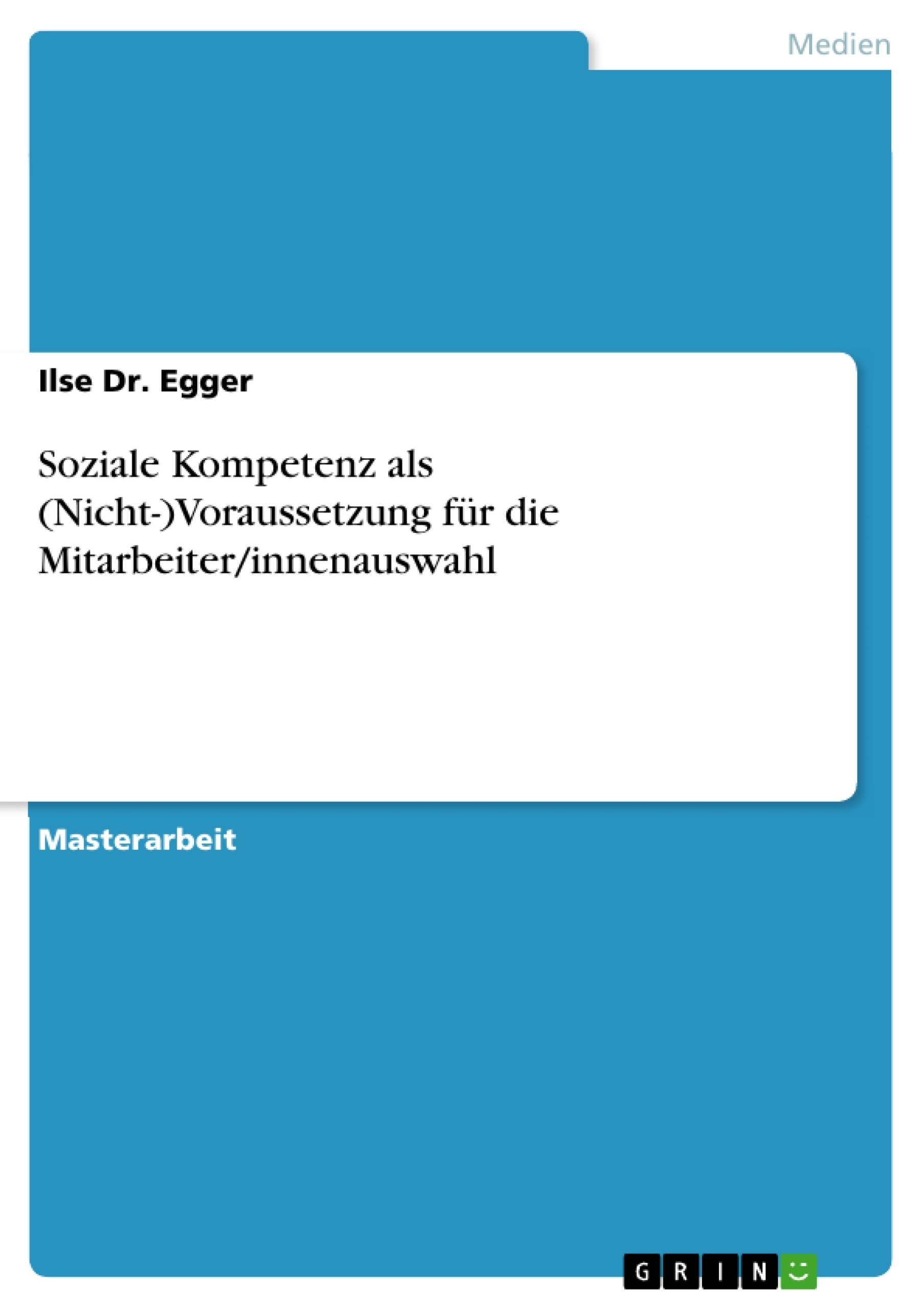Die Arbeit setzt sich im ersten Teil mit dem Begriff „Soziale Kompetenz“ auseinander. Hierbei werden zunächst die zahlreichen verschiedenen, in der Literatur verwendeten Definitionen dieses Fachterminus aufgezeigt und die diversen Eigenschaften bzw. Fähigkeiten, die im Begriff „Soziale Kompetenz“ subsumiert werden, beschrieben. Der zweite Teil zeigt die Bedeutung der „Unternehmenskultur“ bei der Auswahl von Mitarbeiter/innen auf. Nach einem umfassenden Überblick über die diesbezügliche Literatur wird anhand einer Stellenanzeige veranschaulicht, dass „eingestellt wird, wer zur Kultur des Unternehmens passt“. Im dritten Teil wird schließlich in Anlehnung an das Kompetenzmodell von Heyse/Erpenbeck das Ergebnis der Analyse von über 1900 Stellenanzeigen, die im Zeitraum Jänner bis Dezember 2009 im WIKU, der wöchentlichen Wirtschaftsbeilage der Südtiroler Tageszeitung „Dolomiten“, veröffentlicht wurden, präsentiert. Dabei werden mögliche Einflussfaktoren mitberücksichtigt.
Die wichtigsten Ergebnisse sind:
1. Noch immer ist sich die Wissenschaft nicht darüber einig, was genau unter dem Begriff der „Sozialen Kompetenz“ verstanden werden soll. Jede/r Autor/in umschreibt damit unterschiedliche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Eigenschaften.
2. Aus den untersuchten Stellenanzeigen geht eindeutig hervor, dass bei der Personalauswahl größeres Augenmerk auf Fach- und Methodenkompetenz als auf Soziale Kompetenz gelegt wird. Vielfach tauchen überhaupt keine Angaben bezüglich Voraussetzungen im Bereich der Sozialen oder Personalen Kompetenz auf.
3. Der Einfluss der Unternehmenskultur auf die Personalauswahl bzw. der Verbleib eine/s Mitarbeiters/in im Unternehmen hängt sehr stark mit der im Unternehmen gelebten Kultur zusammen.
4. Personalentwickler bzw. Verantwortliche für die Personalaufnahme sind aufgefordert, sich mit dem Thema „Soziale Kompetenz“ und „Unternehmenskultur“ sowie die Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen auseinanderzusetzen.
Während Fach- und Methodenkompetenzen in der Schul- und Berufsbildung erworben bzw. während der Ausübung des Berufes gesammelt werden können, ist bei der Personalauswahl ein verstärktes Augenmerk auf Soziale bzw. personale Kompetenz zu legen. Diese Kompetenzen ermöglichen es nämlich sowohl Mitarbeitern/innen als auch Vorgesetzten in Interaktionen mit anderen Menschen zu guten Lösungen für alle Beteiligten zu kommen und dem gesamten Unternehmen dadurch Nutzen zu stiften.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- Teil I
- 1. „Soziale Kompetenz“
- 1.1 Versuch einer Definition des Begriffs „Soziale Kompetenz“
- 1.2 Soziale Kompetenz als Schlüsselqualifikation?
- 1.3 Zusammenfassung - Soziale Kompetenz: ein multidimensionales Konzept
- 1. „Soziale Kompetenz“
- Teil II
- 2.1 Unternehmenskultur
- 2.2 Welche Bedeutung hat die Unternehmenskultur für die Personalauswahl?
- 2.3 Unternehmens- oder Organisationskultur – ausgewählte Definitionen
- 2.4 Kultur-Modelle oder -Konzepte
- 2.5 Beobachtbar ist nur was beobachtbar ist.
- 2.6 Kulturebenen und ihr Zusammenhang.
- 2.7 Spannungsfelder
- 2.8 Positive und negative Aspekte einer starken Unternehmenskultur.
- 2.9 Wesentliches der Unternehmenskultur
- 3. Denkanstöße für Personalverantwortliche
- 3.1 Gezielter Einsatz von Instrumenten der Personalpolitik
- 4. Was sagt eine Stellenanzeige über die Kultur eines Unternehmens aus?
- 4.1 Beschreibung des Vorgehens der Interpretation
- 4.2 Die Stellenanzeige und die drei Kulturebenen von Edgar H. Schein
- 4.3 Interpretation der Stellenanzeige
- 4.4 Zusammenfassung
- 5. Kulturgestaltung über Kulturträger
- 5.1 Die besondere Rolle der Führungskräfte bei der Kulturgestaltung.
- 5.2 Die Führungskraft als Rollenmodell.
- 6. Die provokative Perspektive der systemischen Organisationstheorie
- 6.1 „Eingestellt wird, wer zur Kultur der Organisation passt.“
- 6.2 „Der Geist des Hauses“
- 7. Auftrag und Beitrag der Personalentwicklung
- Teil III
- 9. Soziale Kompetenz als Voraussetzung oder Nicht-Voraussetzung bei der Mitarbeiter/innenauswahl?
- 9.1 Die Ausgangspunkte des Kompetenzverständnisses von Heyse und Erpenbeck
- 9.2 Die begriffliche Klärung von Kompetenz
- 9.3 Der KompetenzAtlas und die Kompetenzkombinationen
- 9.4 Präzisierter KompetenzAtlas (Stand 2009)
- 9. Soziale Kompetenz als Voraussetzung oder Nicht-Voraussetzung bei der Mitarbeiter/innenauswahl?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht den Stellenwert sozialer Kompetenz bei der Mitarbeiterauswahl. Ziel ist es, die Auswirkungen unterschiedlicher Fokussierungen auf soziale Kompetenz in der Personalauswahl auf Unternehmen und Personalentwicklung zu analysieren und die Rolle der Unternehmenskultur dabei zu beleuchten.
- Definition und Facetten sozialer Kompetenz
- Bedeutung der Unternehmenskultur für die Personalauswahl
- Analyse von Stellenanzeigen bezüglich der Gewichtung sozialer Kompetenz
- Auswirkungen auf Personalentwicklungsmaßnahmen
- Zusammenhang zwischen sozialer Kompetenz, Unternehmenskultur und Unternehmenserfolg
Zusammenfassung der Kapitel
Teil I: „Soziale Kompetenz“: Dieser Teil befasst sich eingehend mit dem vielschichtigen Begriff der „Sozialen Kompetenz“. Es werden verschiedene Definitionen aus der Literatur vorgestellt und die damit verbundenen Fähigkeiten und Eigenschaften beschrieben. Die Komplexität und die Uneinigkeit in der wissenschaftlichen Literatur bezüglich einer einheitlichen Definition werden hervorgehoben. Die Diskussion legt den Grundstein für die spätere Analyse der Bedeutung sozialer Kompetenz in der Personalauswahl.
Teil II: Unternehmenskultur und Personalauswahl: Dieser Abschnitt beleuchtet die Bedeutung der Unternehmenskultur für die Auswahl von Mitarbeitern. Es werden diverse Definitionen und Modelle von Unternehmenskultur vorgestellt und deren Einfluss auf die Personalauswahl analysiert. Anhand von Stellenanzeigen wird verdeutlicht, wie Unternehmen implizit oder explizit nach Kandidaten suchen, die zur bestehenden Unternehmenskultur passen. Der Abschnitt liefert ein umfassendes Verständnis des Zusammenhangs zwischen Kultur und Personalentscheidungen.
Kapitel 9: Soziale Kompetenz als Voraussetzung oder Nicht-Voraussetzung bei der Mitarbeiter/innenauswahl?: Dieser Teil präsentiert die Ergebnisse der Analyse von über 1900 Stellenanzeigen. Unter Berücksichtigung des Kompetenzmodells von Heyse/Erpenbeck wird die Gewichtung von sozialer Kompetenz im Vergleich zu Fach- und Methodenkompetenz untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass sozialer Kompetenz in der Personalauswahl oft weniger Gewicht beigemessen wird als anderen Kompetenzbereichen. Der Abschnitt schließt mit Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen für Personalverantwortliche.
Schlüsselwörter
Soziale Kompetenz, Personalauswahl, Unternehmenskultur, Stellenanzeigenanalyse, Kompetenzmodelle, Personalentwicklung, Mitarbeiterintegration, Kompetenzmanagement
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Soziale Kompetenz in der Personalauswahl
Was ist der Gegenstand der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht den Stellenwert sozialer Kompetenz bei der Mitarbeiterauswahl. Sie analysiert die Auswirkungen unterschiedlicher Fokussierungen auf soziale Kompetenz in der Personalauswahl auf Unternehmen und Personalentwicklung und beleuchtet die Rolle der Unternehmenskultur dabei.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Facetten sozialer Kompetenz, die Bedeutung der Unternehmenskultur für die Personalauswahl, die Analyse von Stellenanzeigen bezüglich der Gewichtung sozialer Kompetenz, die Auswirkungen auf Personalentwicklungsmaßnahmen und den Zusammenhang zwischen sozialer Kompetenz, Unternehmenskultur und Unternehmenserfolg.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. Teil I befasst sich mit dem Begriff der „Sozialen Kompetenz“ und dessen Definition. Teil II beleuchtet die Bedeutung der Unternehmenskultur für die Personalauswahl, analysiert Stellenanzeigen und den Zusammenhang zwischen Kultur und Personalentscheidungen. Teil III präsentiert die Ergebnisse der Analyse von Stellenanzeigen bezüglich der Gewichtung sozialer Kompetenz im Vergleich zu Fach- und Methodenkompetenz.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative und quantitative Forschungsmethode. Es werden verschiedene Definitionen und Modelle aus der Literatur herangezogen und Stellenanzeigen analysiert, um die Gewichtung von sozialer Kompetenz in der Personalauswahl zu untersuchen. Die Analyse von über 1900 Stellenanzeigen bildet einen zentralen Bestandteil der Arbeit.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse zeigen, dass sozialer Kompetenz in der Personalauswahl oft weniger Gewicht beigemessen wird als anderen Kompetenzbereichen. Die Arbeit liefert Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen für Personalverantwortliche.
Welche Rolle spielt die Unternehmenskultur?
Die Unternehmenskultur spielt eine entscheidende Rolle bei der Personalauswahl. Die Arbeit analysiert, wie Unternehmen implizit oder explizit nach Kandidaten suchen, die zur bestehenden Unternehmenskultur passen. Der Einfluss der Unternehmenskultur auf die Gewichtung sozialer Kompetenz wird untersucht.
Welche Bedeutung hat das Kompetenzmodell von Heyse und Erpenbeck?
Das Kompetenzmodell von Heyse und Erpenbeck dient als Grundlage für die Analyse der Stellenanzeigen. Es ermöglicht den Vergleich der Gewichtung von sozialer Kompetenz zu Fach- und Methodenkompetenz.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Personalverantwortliche, Personalentwickler, Studierende der Personalpsychologie und Wirtschaftswissenschaften sowie alle, die sich für die Themen soziale Kompetenz, Personalauswahl und Unternehmenskultur interessieren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Kompetenz, Personalauswahl, Unternehmenskultur, Stellenanzeigenanalyse, Kompetenzmodelle, Personalentwicklung, Mitarbeiterintegration, Kompetenzmanagement.
Wo finde ich den vollständigen Inhaltsverzeichnis?
Der vollständige Inhaltsverzeichnis ist im Hauptdokument enthalten und umfasst neben Abstract und Einleitung detaillierte Kapitelübersichten zu den drei Teilen der Arbeit (Soziale Kompetenz, Unternehmenskultur und Personalauswahl, sowie die Analyse sozialer Kompetenz in der Personalauswahl).
- Quote paper
- Ilse Dr. Egger (Author), 2011, Soziale Kompetenz als (Nicht-)Voraussetzung für die Mitarbeiter/innenauswahl, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192240