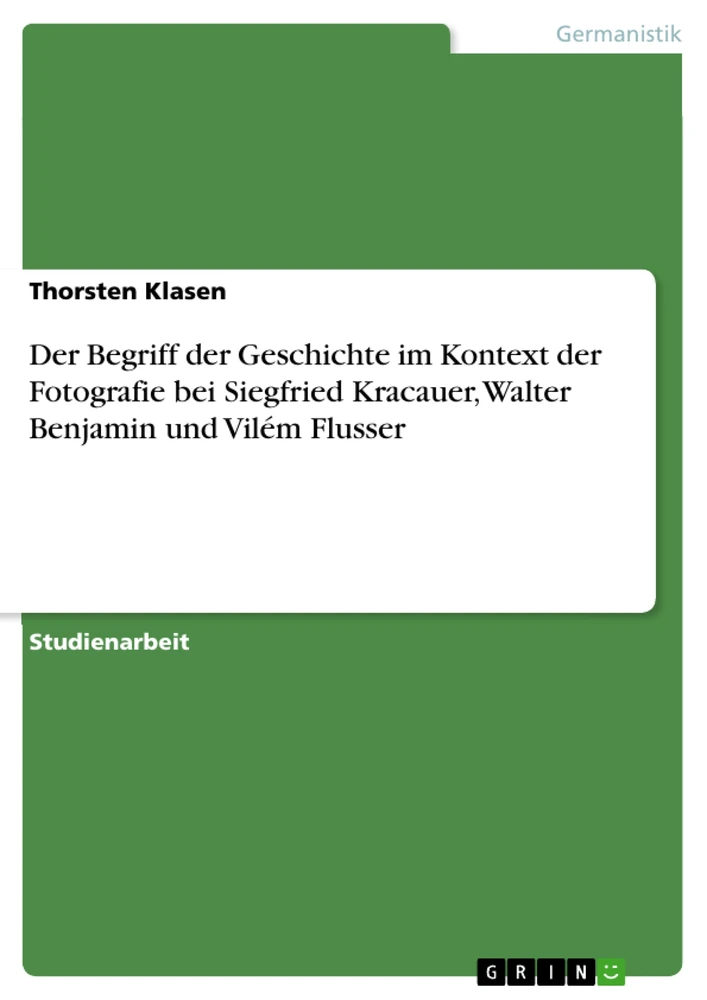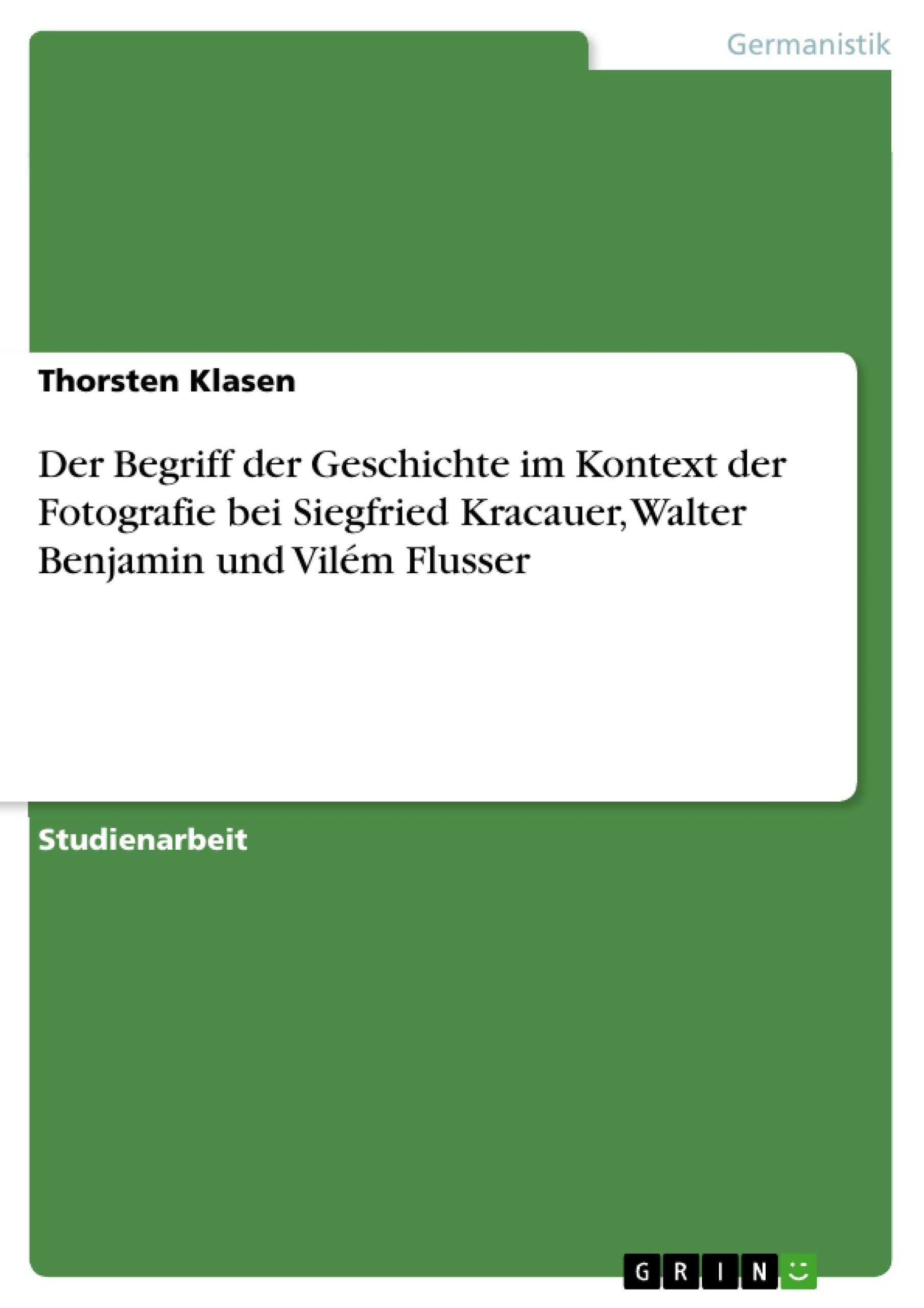Im Hinblick auf das Werk Walter Benjamins als Gegenstand der sogenannten Humanities, betrachtet dieser Hausarbeit das Verhältnis von Walter Benjamins Begriff der Geschichte im Spannungsfeld gesellschaftlichen Lebens und politischen Wandels, aber insbesondere hinsichlichich eines Konzepts der Fotografie, wie sie Siegfried Kracauer in seinem Aufsatz Die Photographie von 1927 präsentiert. Interessant ist hier insbesondere, worin sich beide Konzepte, trotz ähnlicher Voraussetzungen – beide Autoren kritisieren u. a. das Fortschrittsparadigma historischen Denkens – unterscheiden und inwiefern ihnen heute möglicherweise noch gesellschaftliche Relevanz zukommt. Des Weiteren sollen Erkenntnisse der neueren Kultur- und Medientheorie von Vilém Flusser bezüglich des Aspekts von Fotografie und Geschichte beigebracht werden, um die sozio-kulturelle Tragweite Fotografie im Zusammenhang mit dem Ende von Geschichte, der sog. Nachgeschichte bzw. dem Posthistorismus zu verdeutlichen.
Im ersten T
eil der Arbeit sollen zunächst die grundlegenden Positionen von Kracauer und Benjamin, was Fotografie und Geschichte anbelangt, herausgearbeitet werden. Dazu werden zunächst Kracauers grundsätzliche Annahmen darüber geklärt, was sowohl Fotografie und Erinnerung, als auch Geschichte bedeuten und in welchem Funktionszusammenhang sie miteinander stehen. Im zweiten Abschnitt wird dann Walter Benjamins Geschichtsmodell anhand seines Begriffs von »Stillstand« – als Komplementärbegriff zur Fotografie – hinsichtlich seiner Qualität und seines funktionalen Potenzials für den geschichtlichen Gesamtprozess vorgestellt. Im letzten Teil der Arbeit soll kurz an aktuellere Debatten um den Begriff von Geschichte auf Basis der postmodernen Position des Kulturphilosophen Vilém Flusser angeknüpft werden, für den Bilder eine ganz besondere Rolle innerhalb seiner Kultur- und Medientheorie spielen, um schließlich zu einem Fazit bezüglich der 3 unterschiedlichen Ansätze zu gelangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 2.1 Fotografie, Erinnerung und Geschichte bei Siegfried Kracauer
- 2.2 Walter Benjamins Begriff der Geschichte im Kontext der Fotografie
- 2.3 Vilém Flusser und die Philosophie der Fotografie
- 3. Zusammenfassung und Fazit
- 4. Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Beziehung zwischen Walter Benjamins Geschichtsbegriff und dem Konzept der Fotografie, insbesondere im Kontext von Siegfried Kracauers Werk. Der Fokus liegt auf den Gemeinsamkeiten und Unterschieden in ihren Ansätzen, die beide das Fortschrittsparadigma des historischen Denkens kritisieren. Die Arbeit betrachtet auch die Relevanz dieser Konzepte in der heutigen Gesellschaft und erweitert diese Diskussion durch die Einbeziehung von Vilém Flussers Kultur- und Medientheorie.
- Fotografie und Erinnerung als Spiegelbild der Geschichte
- Kritik am Fortschrittsparadigma des historischen Denkens
- Walter Benjamins Geschichtsmodell und der Begriff von "Stillstand"
- Die Rolle der Fotografie in der postmodernen Gesellschaft
- Die sozio-kulturelle Tragweite von Fotografie im Zusammenhang mit dem Ende der Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und skizziert die zentrale Fragestellung sowie die Forschungsmethodik. Sie stellt die drei zentralen Figuren, Walter Benjamin, Siegfried Kracauer und Vilém Flusser, vor und zeigt die Relevanz ihrer Arbeiten für das Verständnis von Geschichte und Fotografie.
- 2.1 Fotografie, Erinnerung und Geschichte bei Siegfried Kracauer: Dieser Abschnitt analysiert Kracauers Essay "Die Photographie" und beleuchtet seine Sichtweise auf Fotografie als sozio-kulturelles Massenphänomen der 1920er Jahre. Der Fokus liegt auf Kracauers Kritik am Fortschrittsparadigma des historischen Denkens und seiner Analyse des Verhältnisses zwischen Fotografie, Erinnerung und Geschichte.
- 2.2 Walter Benjamins Begriff der Geschichte im Kontext der Fotografie: Dieser Abschnitt untersucht Walter Benjamins Geschichtsmodell und den Begriff von "Stillstand" im Kontext der Fotografie. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu Kracauers Ansatz aufgezeigt und die Relevanz dieser Konzepte für das Verständnis der Geschichte im 20. Jahrhundert beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Geschichte, Fotografie, Erinnerung, Kultur, Medien, Fortschritt, Stillstand, und Postmoderne. Sie untersucht die Ansätze von Walter Benjamin, Siegfried Kracauer und Vilém Flusser, um die Bedeutung von Fotografie im Kontext der Geschichte und des gesellschaftlichen Wandels zu erforschen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Autoren stehen im Zentrum dieser Untersuchung?
Die Arbeit untersucht die Positionen von Walter Benjamin, Siegfried Kracauer und Vilém Flusser zum Thema Fotografie und Geschichte.
Was kritisierten Kracauer und Benjamin am historischen Denken?
Beide Autoren kritisierten das Fortschrittsparadigma des historischen Denkens und suchten nach alternativen Wegen, Geschichte zu verstehen.
Wie sieht Siegfried Kracauer die Fotografie?
Kracauer betrachtet die Fotografie als sozio-kulturelles Massenphänomen und analysiert ihr Verhältnis zur Erinnerung und zur Geschichte.
Was bedeutet Benjamins Begriff des „Stillstands“?
Der Stillstand fungiert bei Benjamin als Komplementärbegriff zur Fotografie und beschreibt ein funktionales Potenzial innerhalb des geschichtlichen Gesamtprozesses.
Welche Rolle spielt Vilém Flusser in dieser Arbeit?
Flusser liefert eine postmoderne Perspektive und verdeutlicht die sozio-kulturelle Tragweite der Fotografie im Zusammenhang mit dem „Ende der Geschichte“ (Posthistorismus).
- Quote paper
- Thorsten Klasen (Author), 2011, Der Begriff der Geschichte im Kontext der Fotografie bei Siegfried Kracauer, Walter Benjamin und Vilém Flusser, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192295