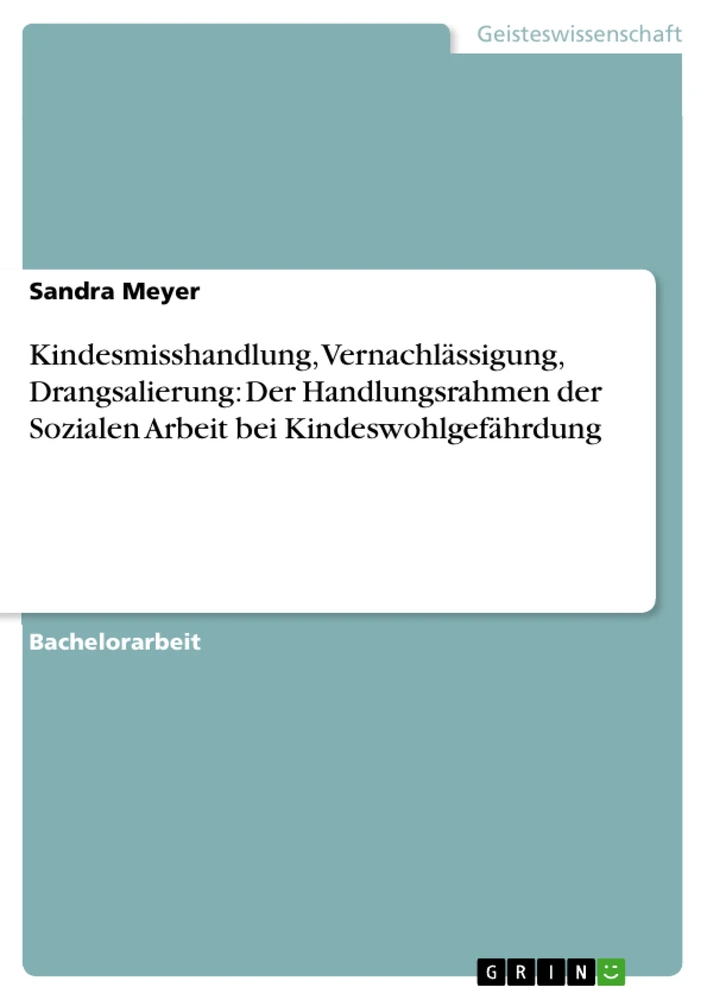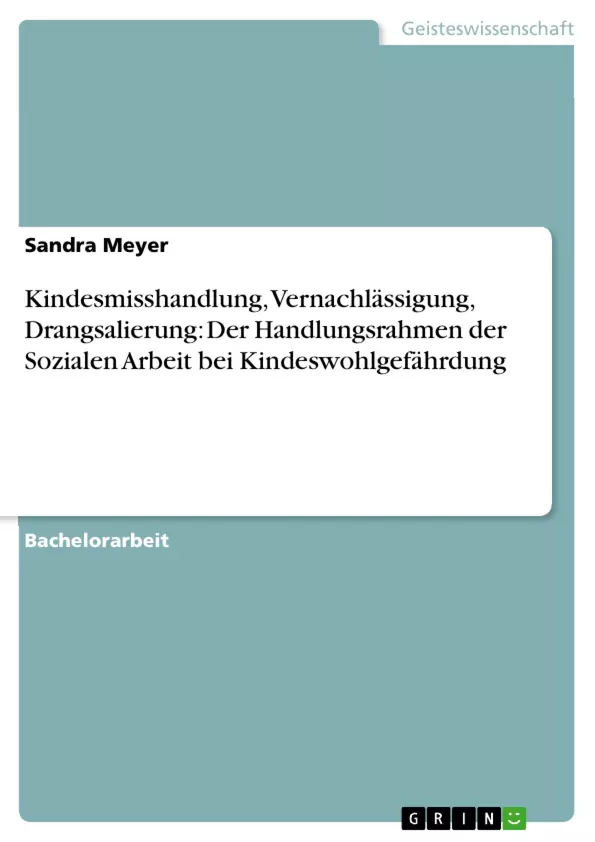In Anlehnung an verschiedene Praktika in der Kinder- und Jugendhilfe habe ich mich dazu entschieden meine Bachelorarbeit dem brisanten Thema der Kindeswohlgefährdung zu widmen. Insbesondere in den letzten Jahren hat das Thema eine hohe Dynamik gewonnen durch eine in den Medien geführte Kindeswohldebatte. Aufgrund dessen, dass Fälle von Kindesmisshandlungen und Vernachlässigen zu spät entdeckt wurden und Kinder verhungert sind oder durch Drangsalierung ihrer Eltern starben. Verantwortung wird dann in der Regel beim Jugendamt und auch bei den betreuenden freien Trägern gesucht.
Auch die tatsächlichen Zahlen unterstreichen die Brisanz.[...]
Kindeswohlgefährdung ist somit ein Thema mit dem die Mitarbeiter eines Jugendamtes naehzu täglich in Berührung kommen sowie die freien Träger ebenfalls, da diese dann verschiedene Formen der Hilfen zur Erziehung im Auftrag des Jugendamtes ausführen.
Aus diesem Grund stelle ich die Frage: „Wie gestaltet sich der Handlungsrahmen der Sozialen Arbeit bei Kindeswohlgefährdung am Beispiel der Kooperation von Jugendamt und freien Trägern der Jugendhilfe?“
Dabei möchte ich zunächst den Begriff des Kindeswohls klären und sehen was Kinder genau brauchen und welche Bedürfnisse erfüllt sein müssen, damit sie sich gut entwickeln können. Ferner möchte ich beschreiben was unter einer Kindeswohlgefährdung zu verstehen ist und aus welchen Ursachen Gefährdungen entstehen können.
Große Bedeutung für den Kinderschutz hat der §8a KJHG da durch ihn im Jahr 2005 das „wie“ des Kinderschutzes neu verbindlich formuliert wurde. Welche neuen rechtlichen Vorgaben gibt es und wie werden diese von Jugendamt und freien Trägern der Jugendhilfe umgesetzt? Welche Berührungspunkte gibt es dabei zwischen beiden Trägern? Dazu werden sowohl der Handlungsrahmen des Jugendamtes als auch der freien Träger skizziert und gegenübergestellt.
Bei (möglichen) Kindeswohlgefährdungen entstehen Kontakte oft auf nicht freiwilliger Basis auf Seiten der Erziehungsberechtigten zugleich dienen sie aber als wichtige Kooperationspartner damit Hilfen gelingen können. Wie ist es für die SozialarbeiterInnen neben Hilfe auch notwendige Kontrolle auszuüben und wie können Eltern trotz des Zwangskontextes für eine Mitarbeit gewonnen werden?
Ebenso stellt sich die Frage wie die Sozialarbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe mit den anspruchsvollen Anforderungen ihres Berufsalltags umgehen können? Sind dabei Methoden der kollegialen Beratung o. Supervision zur Unterstützung hilfreich?
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe
- 1.1 Die gesetzlichen Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe
- 1.2 Der Organisation des Jugendamtes
- 1.3 Aufgaben der Kinder und Jugendhilfe
- 1.4 Freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe
- 2. Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung
- 2.1 Kindeswohl – eine begriffliche Klärung
- 2.2 Bedürfnisse von Kindern - was beeinflusst ihre Entwicklung positiv?
- 2.3 Mögliche Anhaltspunkte und Indikatoren für eine Kindeswohlgefährdung
- 2.4 Ursachen von Kindeswohlgefährdung
- 3. Gesetzliche Grundlagen des Kinderschutzes gemäß §8a KJHG
- 4. Das professionelle Handeln bei Kindeswohlgefährdung
- 4.1 Verfahrensablauf des Jugendamtes
- 4.2 Verfahrensabläufe bei freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe
- 4.3 Gegenüberstellung von Jugendamt und freien Trägern
- 5. Die Hilfen zur Erziehung als Antwort auf Kindeswohlgefährdung?
- 5.1 Hilfen zur Erziehung und Hilfeplanung
- 5.2 Erziehungsberechtigte als wichtige Kooperationspartner zur Umsetzung und zum Gelingen von Hilfen
- 5.3 Herausforderungsvoller Umgang von Sozialpädagogen mit Erziehungsberechtigten im Kontext der Kindeswohlgefährdung
- 6. Leitlinien des Handelns in der Kinder- und Jugendhilfe
- 6.1 Professioneller Umgang mit Hilfe und Kontrolle
- 6.2 Kollegiale Beratung
- 6.3 Supervision
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Handlungsrahmen der Sozialen Arbeit bei Kindeswohlgefährdung, fokussiert auf die Kooperation zwischen Jugendamt und freien Trägern der Jugendhilfe. Die Arbeit klärt den Begriff des Kindeswohls, beschreibt Kindeswohlgefährdung und deren Ursachen, und analysiert die gesetzlichen Grundlagen des Kinderschutzes gemäß §8a KJHG.
- Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und freien Trägern der Jugendhilfe
- Begriff und Ursachen von Kindeswohlgefährdung
- Gesetzliche Grundlagen des Kinderschutzes (§8a KJHG)
- Professionelles Handeln bei Kindeswohlgefährdung
- Hilfen zur Erziehung im Kontext von Kindeswohlgefährdung
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Kindeswohlgefährdung ein und begründet die Wahl des Themas anhand von Praktikaerfahrungen und der aktuellen gesellschaftlichen Debatte. Sie unterstreicht die Brisanz des Themas mit aktuellen Zahlen zu gerichtlichen Eingriffen und Inobhutnahmen von Kindern. Die zentrale Forschungsfrage lautet: "Wie gestaltet sich der Handlungsrahmen der Sozialen Arbeit bei Kindeswohlgefährdung am Beispiel der Kooperation von Jugendamt und freien Trägern der Jugendhilfe?"
1. Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe: Dieses Kapitel beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe, die Organisation des Jugendamtes (inklusive Jugendhilfeausschuss und Verwaltung, insbesondere des Allgemeinen Sozialen Dienstes – ASD), und die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe gemäß §1 KJHG. Es beschreibt die Rolle sowohl der öffentlichen als auch der freien Jugendhilfe und deren Zusammenarbeit. Der Fokus liegt auf der Struktur und den Aufgaben beider Akteure im System der Kinder- und Jugendhilfe.
Schlüsselwörter
Kindeswohlgefährdung, Jugendamt, freie Träger der Jugendhilfe, §8a KJHG, Hilfen zur Erziehung, Kooperation, sozialpädagogische Arbeit, Kinderschutz, gesetzliche Grundlagen, professionelles Handeln.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Handlungsrahmen der Sozialen Arbeit bei Kindeswohlgefährdung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Handlungsrahmen der Sozialen Arbeit im Kontext von Kindeswohlgefährdung, mit besonderem Fokus auf die Kooperation zwischen Jugendämtern und freien Trägern der Jugendhilfe. Sie beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen, analysiert Kindeswohlgefährdung und deren Ursachen und beschreibt die Abläufe des professionellen Handelns.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die gesetzlichen Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe, die Organisation des Jugendamtes und der freien Träger, den Begriff und die Ursachen von Kindeswohlgefährdung, die gesetzlichen Grundlagen des Kinderschutzes gemäß §8a KJHG, die Verfahrensabläufe bei Kindeswohlgefährdung im Jugendamt und bei freien Trägern, Hilfen zur Erziehung und die Herausforderungen im Umgang mit Erziehungsberechtigten. Weitere Schwerpunkte sind der professionelle Umgang mit Hilfe und Kontrolle, kollegiale Beratung und Supervision.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Zusammenarbeit Jugendamt/freie Träger, Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung, Gesetzliche Grundlagen des Kinderschutzes (§8a KJHG), Professionelles Handeln bei Kindeswohlgefährdung, Hilfen zur Erziehung im Kontext von Kindeswohlgefährdung und Fazit. Jedes Kapitel enthält detaillierte Unterpunkte, die die jeweiligen Themenbereiche vertiefen.
Welche zentralen Forschungsfragen werden gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: "Wie gestaltet sich der Handlungsrahmen der Sozialen Arbeit bei Kindeswohlgefährdung am Beispiel der Kooperation von Jugendamt und freien Trägern der Jugendhilfe?"
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Kindeswohlgefährdung, Jugendamt, freie Träger der Jugendhilfe, §8a KJHG, Hilfen zur Erziehung, Kooperation, sozialpädagogische Arbeit, Kinderschutz, gesetzliche Grundlagen, professionelles Handeln.
Werden die Rollen des Jugendamtes und der freien Träger verglichen?
Ja, die Arbeit vergleicht die Rollen und Aufgaben des Jugendamtes und der freien Träger der Jugendhilfe im Kontext der Kindeswohlgefährdung, beleuchtet ihre Zusammenarbeit und die jeweiligen Verfahrensabläufe.
Wie wird der Begriff "Kindeswohlgefährdung" definiert?
Die Arbeit klärt den Begriff des Kindeswohls und beschreibt detailliert mögliche Anhaltspunkte und Indikatoren für eine Kindeswohlgefährdung sowie deren Ursachen.
Welche Rolle spielen Hilfen zur Erziehung?
Die Arbeit untersucht die Hilfen zur Erziehung als mögliche Antwort auf Kindeswohlgefährdung, inklusive der Hilfeplanung und der Bedeutung der Kooperation mit Erziehungsberechtigten.
Welche Bedeutung haben kollegiale Beratung und Supervision?
Kollegiale Beratung und Supervision werden als wichtige Leitlinien des professionellen Handelns in der Kinder- und Jugendhilfe im Umgang mit Kindeswohlgefährdung hervorgehoben.
Wo finde ich die detaillierten Kapitelzusammenfassungen?
Die bereitgestellte HTML-Datei enthält Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, die detaillierter auf die jeweiligen Inhalte eingehen.
- Arbeit zitieren
- Sandra Meyer (Autor:in), 2011, Kindesmisshandlung, Vernachlässigung, Drangsalierung: Der Handlungsrahmen der Sozialen Arbeit bei Kindeswohlgefährdung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192339