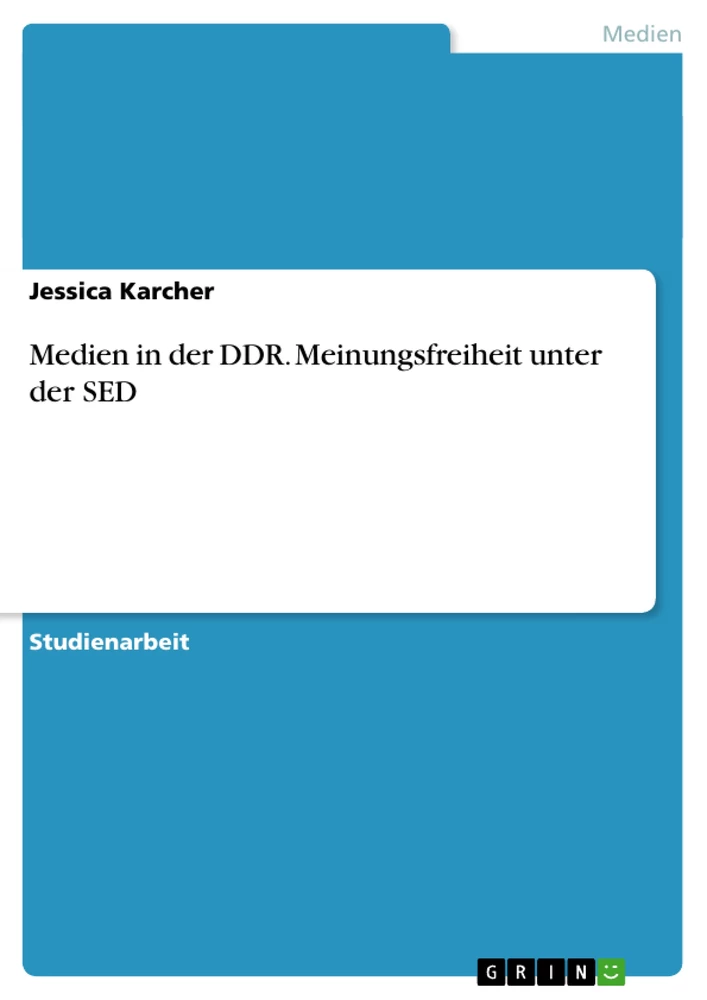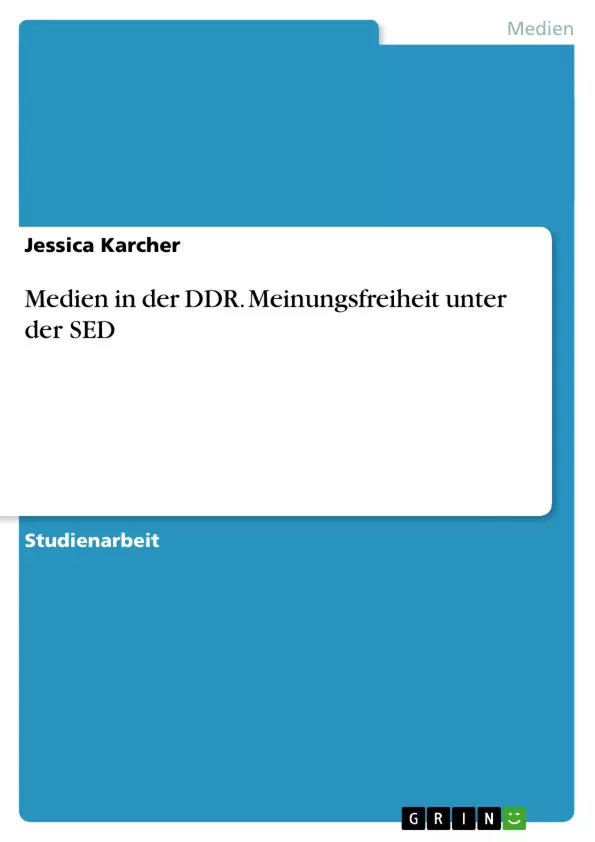"Die sozialistische Massenmedien leisten als Führungs- und Kampfinstrumente der Partei der Arbeiterklasse und des sozialen Staates ihren Beitrag zur Veränderung der gesellschaftlichen Wirklichkeit mittels spezifischer journalistischer bzw. künstlerischer Mittel." (Geißler, Rainer In: DDR-Fernsehen intern. Berlin: Wiss.-Vlg. Spiess 1990, S. 298). So sah die Theorie aus, dass die Praxis beweisen die letzten Jahre vor der politischen Wende
der DDR.
Neben der Abhandlung geschichtlicher Ereignisse und Entwicklungen sowjetischen Besatzungszone über die Geburt bis zum Ende der DDR, werden auf den folgenden Seiten auch Erörterungen über die "Aktuelle Kamera" und die Situation der Medienmitarbeiterfolgen am Beispiel der Journalisten folgen.
Über die Entwicklung des Hörfunks im Abschnitt 2 dieser Arbeit, die bereits in der Zeit vor 1949 also der Besatzungszeit wurzelte über das erste Fernsehprogramm der DDR im dritten Teil bis hin zu den ersten privat- wirtschaftlichen Bestrebungen Sendeversuche sowie dem unausweichlichem Ende der DDR, die der vierte Punkt behandelt.
Am Beispiel der "Aktuellen Kamera" werde ich im Punkt 3.3. aufzeigen wie und mit welchen Mitteln die SED-Führung genauer das Zentralkomitee die Beeinflussung der Rezepienten versuchte. Von der Körperhaltung bis zum Wortgebrauch und Redeablauf war alles von Wirkungsabsichten durchdrungen. Die Gestaltung der Sendungen oder Zeitungen lag fest in der hand der SED und ihrer Gesandten.
Im Abschnitt 3.4. bietet sich ein besonderer Blickpunkt auf die Ereignisse. Aus der Sicht der Mitarbeiter des Rundfunks und der Presse, von denen sich die meisten im Laufe der Zeit immer weniger mit der Linie der Partei identifizieren konnten, die aber bis zu letzt an den revolutionären Bestrebungen des Volkes der DDR unbeteiligt waren, Geschweige denn die Geschehnisse reflektierten. Am Beispiel der Studentenzeitschrift "Forum" werde ich auf die Mitarbeiter der Presse eingehen. Auf deren Haltungen dem System gegenüber sowie deren Schicksal während und nach der politischen Wende.
Den Abschluss im Punkt 4 wird eine Betrachtung der Entwicklung der DDR-Medien sein. Was mit den einzelnen Radiosendern und Fernsehprogrammen sowie deren Mitarbeitern geschehen ist.
In der darauffolgenden Schlussbetrachtung werden die wesentlichen Aspekte dieser Arbeit zusammenfassend wiedergegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorgeschichte: Rundfunkentwicklung in der sowjetischen Besatzungszone
- Der Hörfunk
- Medienarbeit in der DDR: Öffentlichkeitsarbeit unter der SED. (1949-1989)
- Die Hörfunkentwicklung in der Frühphase der DDR.
- Der ostdeutsche Fernsehfunk.
- Der Prototyp sozialistischer Berichterstattung: Die Aktuelle Kamera.
- Die Lage der Journalisten: Zwischen Berufsethos und politischer Gesinnung.
- Entwicklung während und nach der politischen Wende: Was bleibt?
- Resümee
- Quellenangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Entwicklung der Medien in der DDR, insbesondere den Einfluss der SED auf die Meinungsfreiheit und die journalistische Arbeit. Dabei werden die historischen Hintergründe und die Entwicklung des Hörfunks und des Fernsehens in der DDR beleuchtet.
- Die Rolle des Hörfunks in der sowjetischen Besatzungszone
- Die Entwicklung des Fernsehens in der DDR
- Die "Aktuelle Kamera" als Beispiel für die sozialistische Berichterstattung
- Die Situation der Journalisten in der DDR
- Die Entwicklung der Medien nach der politischen Wende
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel befasst sich mit der Einordnung der Medien in der DDR im Kontext der sozialistischen Ideologie und der Rolle der SED.
- Das zweite Kapitel beleuchtet die Vorgeschichte der Rundfunkentwicklung in der sowjetischen Besatzungszone und die Entstehung des Hörfunks in der DDR.
- Das dritte Kapitel untersucht die Entwicklung des ostdeutschen Fernsehfunks, die Herausbildung der "Aktuellen Kamera" als Prototyp sozialistischer Berichterstattung und die Situation der Journalisten in der DDR.
- Das vierte Kapitel befasst sich mit der Entwicklung der DDR-Medien während und nach der politischen Wende.
Schlüsselwörter
DDR, Medien, Meinungsfreiheit, SED, Propaganda, Rundfunk, Fernsehen, Aktuelle Kamera, Journalismus, politische Wende
- Citar trabajo
- Jessica Karcher (Autor), 2001, Medien in der DDR. Meinungsfreiheit unter der SED, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19235