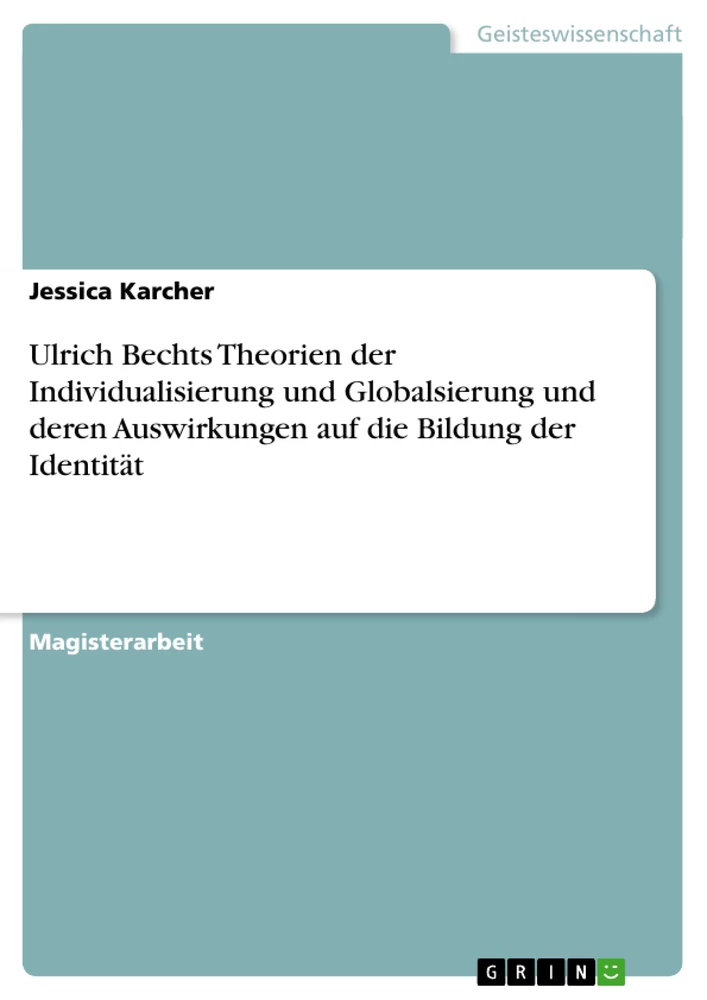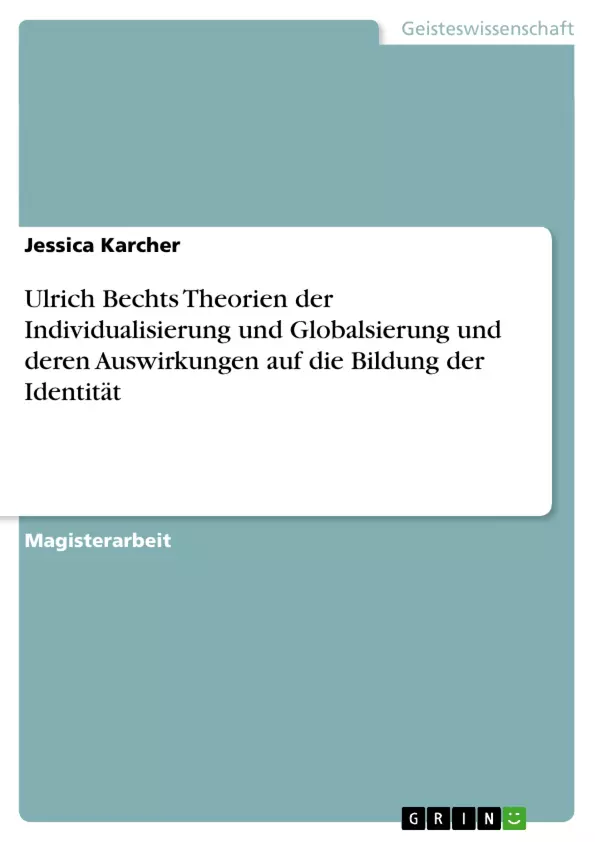In dieser Arbeit soll der Versuch unternommen werden, BECKs Thesen zur
Individualisierung und Globalisierung kritisch zu untersuchen. Um BECKs Aussagen in
einem sozialwissenschaftlichen Kontext betrachten zu können, wird neben den erwähnten
klassischen Betrachtungsweisen WEBERs, SIMMELs und DURKHEIMs auch Norbert
ELIAS` Theorie der Individualisierung in die Ausführungen einbezogen.
Als Ausgangspunkt dieses Arbeit kann hierbei die folgende Forschungsfrage gelten: Kann
man die Betrachtungen von BECK und ELIAS dazu heranziehen, um die Auswirkungen
5
der Modernisierung – insbesondere die der Individualisierung und Globalisierung – auf die
Konstruktion der Identität zu untersuchen?
Der erste Abschnitt dieser Arbeit soll einerseits dazu dienen, die historischen
individualisierungstheoretischen Herangehensweisen der Soziologen Max WEBER, Georg
SIMMEL und Emile DURKHEIM als theoretischen Rahmen in die Diskussion
einzuführen.
Im Anschluss daran, werden die identitätstheoretischen Grundannahmen Lothar
KRAPPMANNs vorgestellt. KRAPPMANN, dessen Annahmen sich an den Symbolischen
Interaktionisten Georg Herbert MEAD und Irvin GOFFMANN orientieren, unterscheidet
zwischen „personaler“ und „sozialer“ Identität und versucht so, individuellen und sozialen
Komponenten der Identität gerecht zu werden (KRAPPMANN 1988).
Im zweiten Abschnitt werden die Betrachtungen BECKs und ELIAS` zur
Individualisierung und Globalisierung vorgestellt. Dies soll anhand einiger ausgewählter
Aspekte, wie der theoretischen Einbettung, der Bedeutung des Staates sowie der
Herausbildung einer globalen Kultur geschehen.
BECK, dessen Annahmen im Rahmen der Theorie der „reflexiven Moderne“ dargestellt
werden, betrachtet Individualisierung im Kontext des Sozialstaats und grenzt seine Thesen
von vorangegangenen Betrachtungen ab, indem er das Individuum nicht mehr aus der
Ständegesellschaft in die Industriegesellschaft, sondern aus der Industriegesellschaft in die
Risikogesellschaft entlässt. BECK betrachtet Individualisierung und Globalisierung als
verwandte Prozesse gegenwärtiger Modernisierung (BECK 1994: 470).
Um die Verknüpfung zwischen beiden Prozessen herzustellen, wird neben der Betrachtung
innerstaatlicher Prozesse auch aus außerstaatlicher Perspektive auf die weltweit
zunehmenden „[...] Handlungen über Distanzen hinweg [...]“, die von BECK als
„Globalisierung“ bezeichnet werden, Wert gelegt (BECK 1994: 470). [...]
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1 Grundlegende Betrachtungen
- 1.1 Historische Vorläufer der Beckschen Individualisierungstheorie
- 1.2 Identitätstheoretische Grundannahmen (nach KRAPPMANN)
- 2 Betrachtungen zur Theorie der Individualisierung aus den Perspektiven der Autoren BECK und ELIAS
- 2.1 Der Prozess der Individualisierung in den Analysen von Ulrich BECK
- 2.1.1 Die Theorie der „,reflexiven Moderne’“
- 2.1.2 BECKS Individualisierungsverständnis
- 2.1.3 Die Rolle des Staates
- 2.1.3.1 Die Rolle des Staates aus der Innenperspektive
- 2.1.3.2 Die Rolle des Staats aus der Außenperspektive
- 2.1.4 Becks „,Weltgesellschaft’“
- 2.1.5 Unter welchen Bedingungen findet Identitätskonstruktion bei Beck statt?
- 2.1.6 Kritik
- 2.2 Der Prozess der Individualisierung in den Analysen von Norbert ELIAS
- 2.2.1 Ausgangspunkt: Der prozess-soziologische Zugang
- 2.2.2 Menschliche Figurationen als Basis der Gesellschaft
- 2.2.3 ELIAS Individualisierungsverständnis
- 2.2.4 Die Rolle des Staates
- 2.2.4.1 Die Rolle des Staates aus der Innenperspektive
- 2.2.4.2 Die Rolle des Staats aus der Außenperspektive
- 2.2.5 Die höchste Integrationsstufe: Die Menschheit - Chancen der „Weltgesellschaft“
- 3 Ein Vergleich - Differenzen und Übereinstimmungen zwischen den Betrachtungen der Soziologen BECK und ELIAS
- 3.1 Differenzen
- 3.1.1 Die Dimension der Freisetzung
- 3.1.2 Der Selbstzwang
- 3.1.3 Die Gemeinschaftsbildung
- 3.2 Gemeinsamkeiten
- 3.2.1 Das Verhältnis der „,Wir-Ich- Balance’“
- 3.2.2 Die Bedeutung staatlicher Institutionen
- 3.2.3 Die „,Weltgesellschaft’“
- 4 Konsequenzen für die Konstruktion der Identität
- 4.1 Rekapitulation der Krappmannschen Identitätstheorie
- 4.2. Identitätskonstruktion des Beckschen Individuums
- 5 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit den Theorien der Individualisierung und Globalisierung von Ulrich Beck und untersucht deren Auswirkungen auf die Konstruktion der Identität. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Thesen von Beck kritisch zu analysieren und sie in einen sozialwissenschaftlichen Kontext zu stellen. Dabei wird auch die Individualisierungstheorie von Norbert Elias in die Betrachtung einbezogen.
- Der Prozess der Individualisierung und seine historischen Vorläufer
- Die Rolle des Staates und die Herausbildung einer „Weltgesellschaft“
- Die Bedeutung von Individualisierung und Globalisierung für die Konstruktion der Identität
- Vergleichende Analyse der Theorien von Beck und Elias
- Kritik an den Thesen Becks und die Bedeutung der Krappmannschen Identitätstheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Individualisierung und ihre Bedeutung für die Konstruktion der Identität ein. Sie stellt die beiden gegensätzlichen Gesellschaftsmodelle, das kollektivistische und das individualistische Modell, vor und erläutert das Konzept der Individualisierung als Brücke zwischen diesen Modellen.
Das erste Kapitel widmet sich den historischen Vorläufern der Beckschen Individualisierungstheorie. Es werden die Ansätze von Max Weber, Georg Simmel und Émile Durkheim vorgestellt und ihre Bedeutung für die Entwicklung des Individualisierungsprozesses herausgearbeitet. Des Weiteren werden die identitätstheoretischen Grundannahmen von Lothar Krappmann vorgestellt, die als Basis für die spätere Analyse der Identitätskonstruktion dienen.
Das zweite Kapitel präsentiert die Theorien von Ulrich Beck und Norbert Elias zur Individualisierung und Globalisierung. Es werden wichtige Aspekte wie die theoretische Einbettung, die Rolle des Staates und die Herausbildung einer globalen Kultur beleuchtet. Beck betrachtet Individualisierung im Kontext der „reflexiven Moderne“ und grenzt seine Thesen von vorhergehenden Betrachtungen ab, indem er das Individuum in die Risikogesellschaft entlässt. Elias hingegen versteht den Individualisierungsprozess als Herauslösung des Individuums aus traditionellen Bindungen und die Entstehung eines verinnerlichten Selbstzwangs.
Das dritte Kapitel stellt einen Vergleich der Theorien von Beck und Elias dar. Es werden sowohl die Differenzen als auch die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Ansätzen herausgearbeitet, die die komplexe Beziehung zwischen Individualisierung und der Konstruktion der Identität veranschaulichen. Die Kapitel 4 und 5 befassen sich mit den Konsequenzen der Individualisierung und Globalisierung für die Konstruktion der Identität. Es wird untersucht, inwiefern Becks Thesen neue Erkenntnisse für die Identitätsbildung liefern und ob die Krappmannsche Identitätstheorie zusätzliche Kategorien für die Rezeption der Thesen Becks benötigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf zentrale Themen wie Individualisierung, Globalisierung, Identitätskonstruktion, „reflexive Moderne“, Risikogesellschaft, „Weltgesellschaft“, und die Theorien von Ulrich Beck, Norbert Elias und Lothar Krappmann.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Ulrich Beck unter „reflexiver Moderne“?
Es beschreibt den Übergang von der Industriegesellschaft zur Risikogesellschaft, in der Individuen gezwungen sind, ihre Identität und ihren Lebensweg ständig neu zu reflektieren.
Wie beeinflusst die Globalisierung die Identitätsbildung?
Globalisierung führt zu einer „Weltgesellschaft“, in der nationale Grenzen an Bedeutung verlieren und Individuen ihre Identität in einem globalen Kontext konstruieren müssen.
Was ist der Unterschied zwischen Beck und Norbert Elias?
Während Beck den Fokus auf moderne Risiken und Institutionen legt, sieht Elias Individualisierung als langfristigen historischen Prozess der Herausbildung von Selbstzwängen und Figurationen.
Was bedeutet die „Wir-Ich-Balance“?
Dieses Konzept von Elias beschreibt das Verhältnis zwischen der individuellen Identität (Ich) und der Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen (Wir).
Welche Rolle spielt der Staat im Individualisierungsprozess?
Der Sozialstaat wirkt als Motor der Individualisierung, indem er den Einzelnen aus traditionellen Bindungen (wie der Großfamilie) löst und direkt an staatliche Institutionen bindet.
- Quote paper
- Jessica Karcher (Author), 2003, Ulrich Bechts Theorien der Individualisierung und Globalsierung und deren Auswirkungen auf die Bildung der Identität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19236