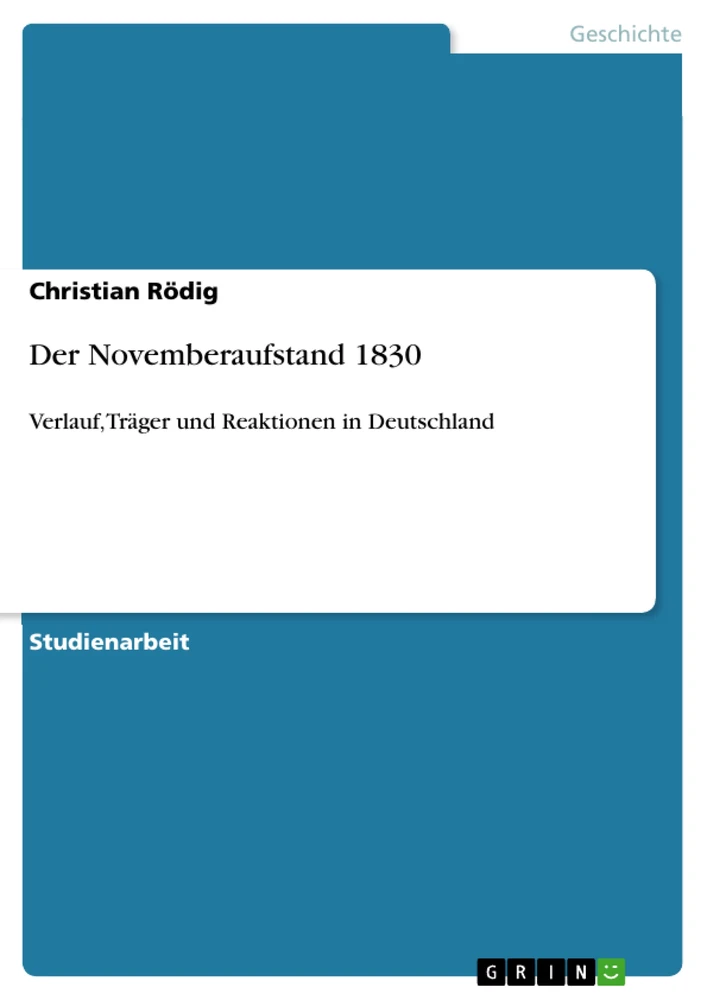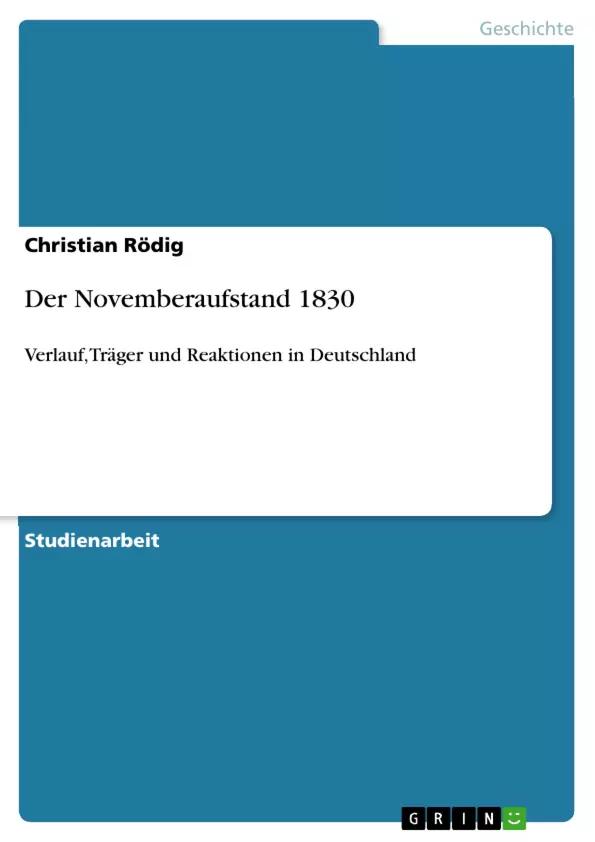Novemberaufstand 1830 in Polen: Ursachen, Folgen und bemerkenswerte Reaktionen von deutscher Seite.
[...]
Die Geschichte Polens ist so reich an Aufständen, wie keine andere Geschichte eines europäischen Landes. Vor allem die drei Teilungen Polens im 18. Jh., welche das Land als souveränen Staat von der Karte verschwinden ließen, schufen den Nährboden für Aufstände und Revolutionen im 19. Jahrhundert. Eine der größten und bedeutendsten dieser Erhebungen war der Novemberaufstand 1830, mit dem sich diese Hausarbeit befasst.
Zu Beginn wird das historische Umfeld des Aufstands gezeigt. Dazu gehört zum einen die allgemeine politische Situation und Geschehnisse in anderen Ländern, welche den Aufstand in Polen beeinflusst haben, zum anderen die Stimmung in Polen einige Jahre, bzw. unmittelbar vor dem Aufstand. Anschließend wird untersucht, wer die eigentlichen Träger und Initiatoren waren, um zu klären ob der Aufstand eher als Revolution des ganzen polnischen Volkes oder vielmehr als Aufruhr einer vergleichsweise kleinen Bevölkerungsgruppe verstanden werden kann. Darauf folgt eine kurze Darstellung des Verlaufs. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit den Reaktionen in Deutschland auf den Novemberaufstand. Dabei wird unterschieden zwischen den Regierungen der deutschen Staaten und deren Bevölkerung. Dies ist deswegen sinnvoll, da sich Handlungen gegenüber den Polen, bzw. die jeweiligen Einstellungen zum Aufstand selbst, zwischen Bevölkerung und Obrigkeit so stark unterscheidet, dass man sie als entgegengesetzt bezeichnen muss. Im Fazit werden die Erkenntnisse noch einmal zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Verhältnisse vor dem Aufstand
- Politische Situation in Polen und Europa
- Vorzeichen und Träger des Aufstands
- Der Aufstand von 1830
- Verlauf bis Ende 1830
- Erste Gefechte bis zur Schlacht von Ostroleka
- Der Zusammenbruch des Aufstands
- Reaktionen in Deutschland zum Aufstand
- Verhalten der deutschen Staaten
- Die deutsche Bevölkerung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Novemberaufstand von 1830 in Polen. Zunächst wird das historische Umfeld des Aufstands beleuchtet, indem die politische Situation in Polen und Europa sowie die Stimmung in Polen vor dem Aufstand analysiert werden. Anschließend werden die Träger und Initiatoren des Aufstands untersucht, um zu klären, ob er als Revolution des ganzen polnischen Volkes oder als Aufruhr einer kleineren Gruppe verstanden werden kann. Der Verlauf des Aufstands wird kurz dargestellt und schließlich werden die Reaktionen in Deutschland auf den Aufstand beleuchtet, wobei zwischen dem Verhalten der deutschen Staaten und der deutschen Bevölkerung unterschieden wird.
- Der Novemberaufstand 1830 als Ausdruck des polnischen Kampfes um nationale Souveränität
- Die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Aufstands
- Die Rolle der verschiedenen Akteure im Aufstand, von der polnischen Bevölkerung bis zu den europäischen Großmächten
- Die Reaktionen in Deutschland auf den polnischen Aufstand, sowohl vonseiten der deutschen Staaten als auch der Bevölkerung
- Die Bedeutung des Novemberaufstands für die Geschichte Polens und Europas
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Novemberaufstand 1830 als ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte Polens vor und skizziert die Themen und Ziele der Arbeit. Sie erläutert, wie die Geschichte Polens geprägt ist von Aufständen und Revolutionen, insbesondere im Kontext der drei Teilungen Polens im 18. Jahrhundert. Die Einleitung stellt auch die Struktur der Arbeit vor und betont die Bedeutung der Analyse der Reaktionen Deutschlands auf den Aufstand.
Die Verhältnisse vor dem Aufstand
Dieses Kapitel beleuchtet die politische Situation in Polen und Europa im Jahr 1830. Es beschreibt die Auswirkungen der Julirevolution in Frankreich und der Belgischen Revolution auf die Stimmung in Europa und in Polen. Es wird die Rolle der Heiligen Allianz und deren Bestrebungen zur Unterdrückung von liberalen und nationalen Bestrebungen in Europa hervorgehoben. Darüber hinaus werden die Folgen der Teilungen Polens für das Land und die Bestrebungen der Polen nach Wiedererlangung ihrer nationalen Souveränität beleuchtet.
Der Aufstand von 1830
Dieses Kapitel stellt den Verlauf des Novemberaufstands 1830 dar. Es beschreibt die ersten Ereignisse des Aufstands und die wichtigsten Kampfhandlungen.
Reaktionen in Deutschland zum Aufstand
Dieses Kapitel untersucht die Reaktionen in Deutschland auf den Novemberaufstand. Es werden die unterschiedlichen Positionen der deutschen Staaten und der deutschen Bevölkerung gegenüber den Aufständischen und dem polnischen Kampf um Unabhängigkeit analysiert.
Schlüsselwörter
Die Hauptaugenmerke dieser Arbeit liegen auf dem Novemberaufstand 1830, den Teilungen Polens, der politischen Situation in Polen und Europa, den Reaktionen Deutschlands auf den Aufstand, der Heiligen Allianz, dem russischen Einfluss auf Polen, dem polnischen Nationalismus und der Wiedererlangung der nationalen Souveränität.
- Quote paper
- B.A. Christian Rödig (Author), 2009, Der Novemberaufstand 1830, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192393