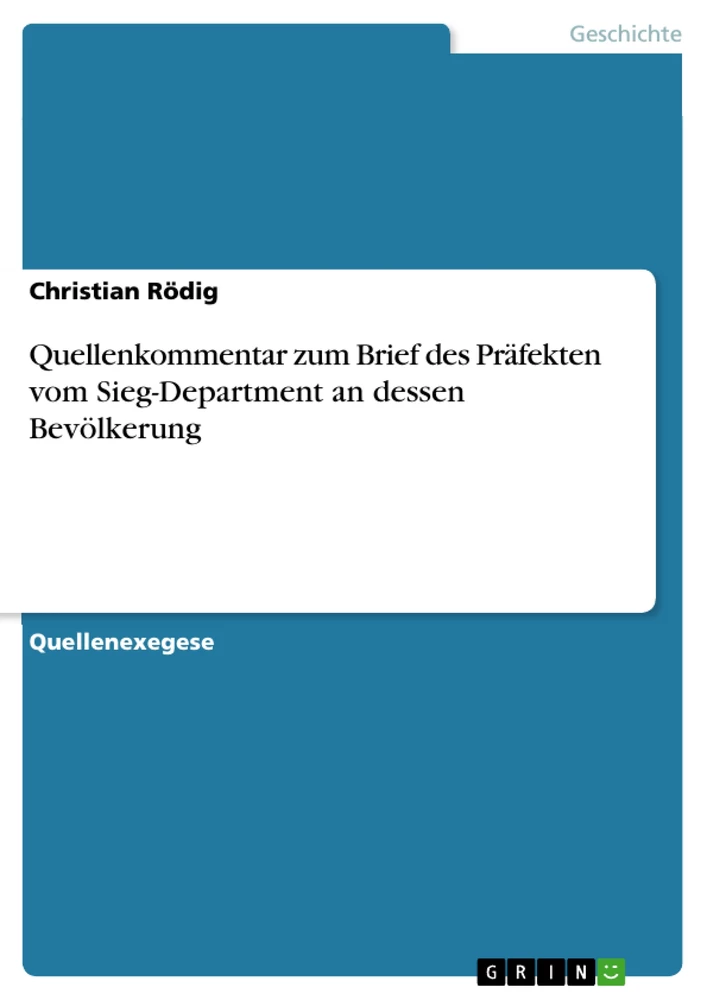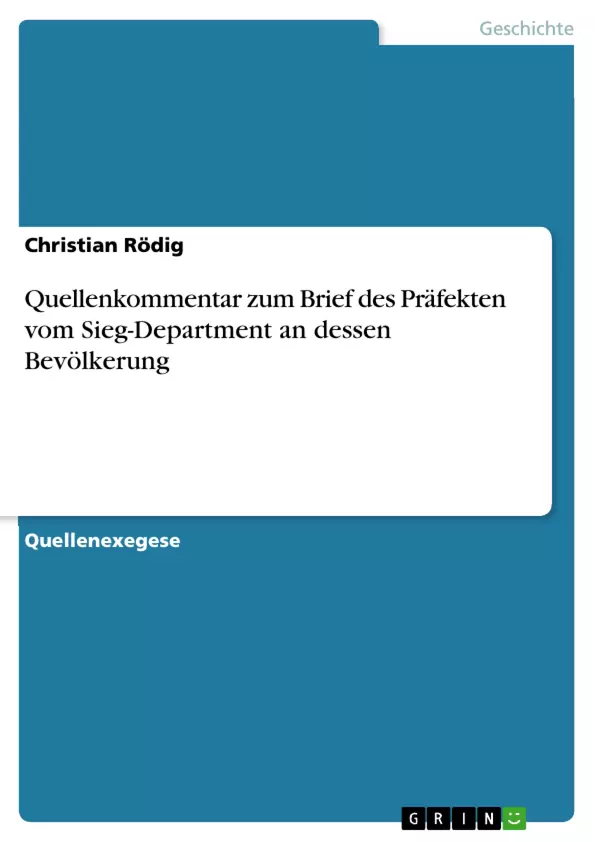Das Jahr 1806 gilt in einem Jahrhundert, welches an Ereignissen äußerst reich war, als historisch sehr bedeutend. Nach dem Sieg Napoleons bei Austerlitz 1805 über Russland und Österreich, konnte der Herrscher Frankreichs seine Macht über die Territorien des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen bedeutend ausbauen. Als Ergebnis daraus entstand 1806 der Rheinbund, eine mit Frankreich verbündete Koalition deutscher Fürsten, welcher das Ende des Heiligen Römischen Reiches im selben Jahr besiegelte. Das Großherzogtum Berg, gelegen in Teilen des heutigen Nordrhein-Westfalen, war eines dieser Territorien des Rheinbundes. In den folgenden Jahren gelang Napoleon eine weitere Machtfestigung, z.B. durch den Frieden von Tilsit 1807. Erst 1809 griff Österreich Frankreich, welches mit massiven Probleme in Spanien konfrontiert war, erneut an.
In diesen Zeitraum des sog. Fünften Koalitionskrieges fällt auch die hier zu behandelnde Quelle.
Dazu wird zuerst der Inhalt der Quelle wiedergegeben, anschließend werden die in der Quelle angesprochenen Reformen in Berg untersucht. Danach erfolgt eine Darstellung des Widerstände in der Bevölkerung im Großherzogtum. Dabei wird nur die Situation bis Juli 1809 präsentiert, damit die Ausgangslage für die Quelle deutlich wird. Die Ergebnisse dieser Ausarbeitungen werden anschließend in Bezug zur Quelle gesetzt, um sich kritisch mit ihr auseinander zu setzen. Dies bezieht sich vor allem auf Aussagen in ihr, die gar nicht oder nur bedingt der Wahrheit entsprechen.
Abschließend wird im Fazit eine Zusammenfassung geboten, wobei auch ein kurzer Ausblick auf die Folgezeit geboten werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Brief des Präfekten an die Bevölkerung
- Inhalt
- Reformen im Großherzogtum Berg
- Die Widerstände in der Bevölkerung
- Bezug zur Quelle
- Fazit
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert einen Brief des Präfekten vom Sieg-Departement an die Bevölkerung des Großherzogtums Berg aus dem Jahr 1809. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der im Brief angesprochenen Reformen, den Widerständen in der Bevölkerung und dem Verhältnis der Quelle zur historischen Realität. Die Arbeit beleuchtet die Auswirkungen der napoleonischen Herrschaft auf das Großherzogtum Berg und die Reaktion der Bevölkerung auf die eingeführten Reformen.
- Napoleonische Reformen im Großherzogtum Berg
- Antifranzösische Tendenzen und Widerstände in der Bevölkerung
- Der Brief als Quelle für die Analyse der politischen und sozialen Verhältnisse im Großherzogtum Berg
- Die Rolle des Präfekten Schmitz in der Durchsetzung der napoleonischen Politik
- Die Auswirkungen der napoleonischen Herrschaft auf die Bevölkerung des Sieg-Departements
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die historische Situation des Großherzogtums Berg im Kontext der napoleonischen Herrschaft ein. Sie beleuchtet die Entstehung des Rheinbundes und die Bedeutung des Großherzogtums Berg für die napoleonische Politik. Der zweite Abschnitt analysiert den Brief des Präfekten Schmitz, der sich an die Bevölkerung des Sieg-Departements richtet. Der Brief thematisiert die Widerstände gegen die napoleonische Herrschaft und die Notwendigkeit der Loyalität gegenüber der französischen Regierung. Der dritte Abschnitt befasst sich mit den Reformen, die Napoleon im Großherzogtum Berg einführte, insbesondere mit der Aufhebung der Leibeigenschaft.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit den Schlüsselthemen des Großherzogtums Berg, der napoleonischen Reformpolitik, den Widerständen der Bevölkerung und der französischen Herrschaft im Kontext des Rheinbundes. Wichtige Schlagwörter sind dabei: Napoleon, Rheinbund, Großherzogtum Berg, Reformen, Leibeigenschaft, Antifranzösische Tendenzen, Präfekt Schmitz, Sieg-Departement, Quelle, Analyse, historische Situation.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Großherzogtum Berg?
Das Großherzogtum Berg war ein 1806 gegründeter Staat im Rheinbund unter napoleonischer Herrschaft, gelegen im heutigen Nordrhein-Westfalen.
Worum geht es in dem Brief des Präfekten Schmitz von 1809?
Der Präfekt des Sieg-Departements appelliert an die Bevölkerung zur Loyalität gegenüber Napoleon, da es im Kontext des Fünften Koalitionskrieges zu Unruhen und Widerständen kam.
Welche napoleonischen Reformen wurden in Berg eingeführt?
Zu den wichtigsten Reformen gehörten die Aufhebung der Leibeigenschaft, die Einführung des Code Civil und die Modernisierung der Verwaltung nach französischem Vorbild.
Warum gab es Widerstand in der Bevölkerung gegen die Reformen?
Trotz fortschrittlicher Ansätze wie der Freiheit von Leibeigenschaft führten hohe Steuern, die Zwangsrekrutierung für napoleonische Kriege und die wirtschaftliche Belastung zu antifranzösischen Tendenzen.
Inwiefern ist der Brief als historische Quelle kritisch zu betrachten?
Die Arbeit zeigt auf, dass Aussagen im Brief über die Zufriedenheit der Bevölkerung teilweise der Propaganda dienten und nicht immer der tatsächlichen sozialen Realität entsprachen.
- Arbeit zitieren
- B.A. Christian Rödig (Autor:in), 2009, Quellenkommentar zum Brief des Präfekten vom Sieg-Department an dessen Bevölkerung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192401