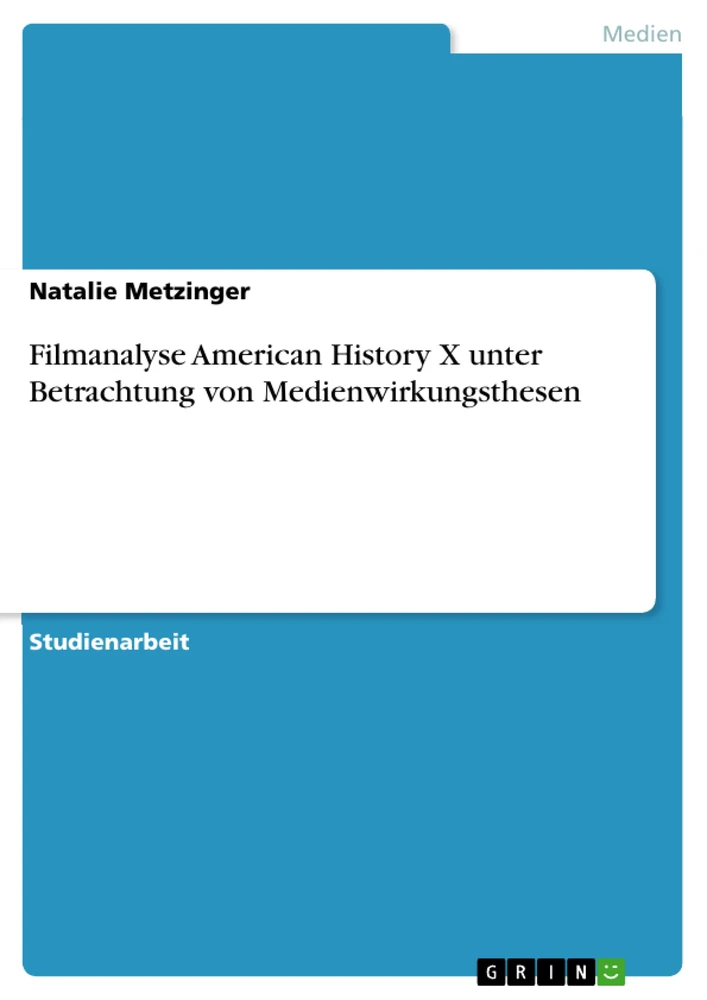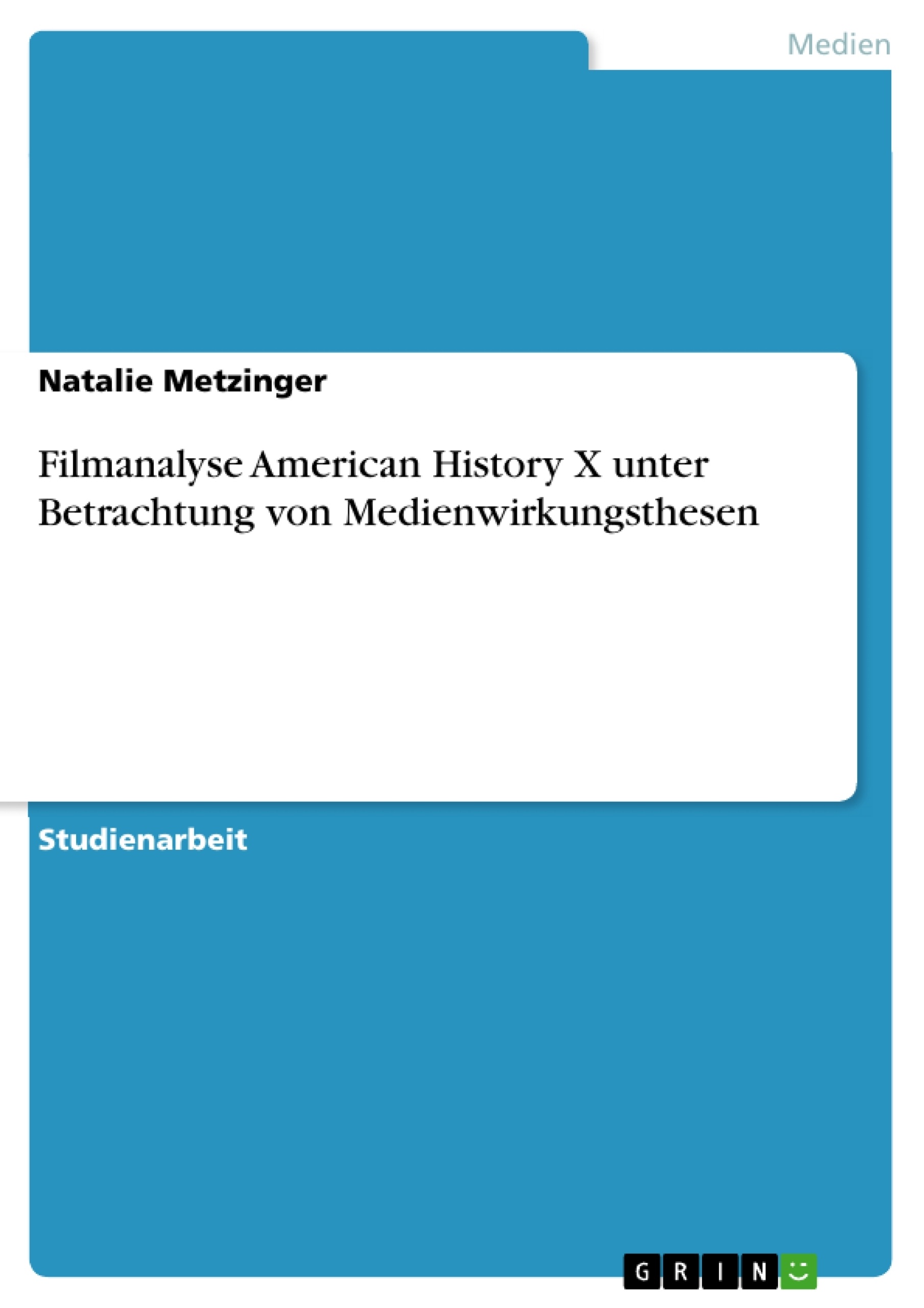Der Film American History X zeigt die Problematik der rechten Ideologie, die im
Wesentlichen in der Abgrenzung von der Gesellschaft durch die Konstruktion von
Feindbildern besteht, auf. Gewalt wird als strategisches Mittel eingesetzt, die dem
Protagonisten Macht und den sogenannten „emotionalen Kick“ verschafft. Gleichzeitig
werden die Konsequenzen der Gewalthandlungen deutlich. Aufgrund dieser
Ambivalenz und der fehlenden – zumindest für viele nicht offensichtlichen –
Verurteilung des Rechtsradikalismus geriet das Filmwerk ins Kreuzfeuer der Kritik. Die
eigentliche Problematik besteht jedoch vielmehr darin, dass der Film eine hohe
Intelligenz beim Empfänger voraussetzt. Viele Dinge werden erst ganz zum Schluss des
Films, wenn nicht sogar erst bei der zweiten Rezeption, klar. Es werden daher große
Erwartungen an die Aufmerksamkeitsprozesse des Zuschauers gestellt.
Unter Betrachtung von den gängigen Medienwirkungsthesen - wie die Katharsis-, Inhibitions- und Stimulationsthesen werden die verschiedenen potentiellen Wirkungen des Films diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG
- 2. MEDIENWIRKUNGSFORSCHUNG
- 2.1 DIE KATHARSISTHESE
- 2.2 DIE STIMULATIONSTHESE
- 2.3 DIE HABITUALISIERUNGSTHESE
- 2.4 RATIONALISIERUNGSTHESE
- 2.5 SUGGESTIONSTHESE
- 2.6 LERNTHEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN
- 3. FILMANALYSE: AMERICAN HISTORY X
- 3.1 FAKTEN ZUM FILM
- 3.2 CHARAKTERE
- 3.2.1 DEREK - DER ANFÜHRER
- 3.2.2 DANY-DER MITLÄUFER
- 3.3 ZUSAMMENFASSUNG DES INHALTS
- 3.4 SZENENINTERPRETATION: DIE BORDSTEINSZENE
- 3.5 BOTSCHAFT DES FILMS
- 4. TRANSFER DER MEDIENWIRKUNGSTHESEN
- 5. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert den Film „American History X“ und untersucht dessen mögliche Auswirkungen auf jugendliche Zuschauer im Kontext der Medienwirkungsforschung. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Thesen der Medienwirkungsforschung, insbesondere die Katharsisthese, und setzt diese in Beziehung zur Filmanalyse.
- Der Einfluss von Gewaltdarstellungen in Medien auf die Entwicklung von Jugendlichen
- Die Katharsisthese und ihre Relevanz im Kontext von Filmanalyse
- Die Analyse von „American History X“ und deren Interpretationsmöglichkeiten für junge Zuschauer
- Die Rolle der Medien in der Gesellschaft und deren Wirkung auf Einstellungen und Verhalten
- Die Bedeutung von Medienkompetenz und kritischer Medienrezeption
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung und Problemstellung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Medienwirkung und insbesondere die Bedeutung von Gewalt im Spielfilm heraus. Sie beleuchtet den Einfluss der Medien auf die Meinungsbildung und das Verhalten von Jugendlichen, insbesondere in Bezug auf die Sammlung politischer Informationen.
- Kapitel 2: Medienwirkungsforschung: Dieses Kapitel gibt eine Einführung in die Medienwirkungsforschung und erläutert verschiedene Thesen, die versuchen, die Auswirkungen von Medieninhalten auf die Rezipienten zu erklären. Neben der Katharsisthese werden auch andere relevante Thesen wie die Stimulationsthese und die Habituierungsthese vorgestellt.
- Kapitel 3: Filmanalyse: American History X: Dieses Kapitel analysiert den Film „American History X“ und beleuchtet die relevanten Medienwirkungsthesen im Kontext der Filmhandlung. Es werden die wichtigsten Charaktere und die Botschaft des Films dargestellt.
- Kapitel 4: Transfer der Medienwirkungsthesen: Dieses Kapitel untersucht, wie die im vorherigen Kapitel diskutierten Medienwirkungsthesen auf den Film „American History X“ und dessen Rezeption durch jugendliche Zuschauer übertragen werden können.
Schlüsselwörter
Medienwirkungsforschung, Gewalt im Spielfilm, Katharsisthese, Filmanalyse, American History X, jugendliche Zuschauer, Medienkompetenz, kritische Medienrezeption, Rezeption, Medienwirkungen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Medienwirkungsthesen werden im Kontext von „American History X“ diskutiert?
Die Arbeit untersucht die Katharsis-, Inhibitions-, Stimulations- und Habitualisierungsthesen im Hinblick auf die Wirkung von Filmgewalt.
Was besagt die Katharsisthese?
Sie geht davon aus, dass das Betrachten von Gewalt beim Zuschauer zu einem Abbau eigener Aggressionen führt – eine These, die im Fall von „American History X“ kritisch hinterfragt wird.
Warum wird die Darstellung des Rechtsradikalismus im Film kritisiert?
Kritiker bemängeln, dass die Ideologie teilweise ohne sofortige Verurteilung dargestellt wird, was bei unzureichender Reflexion stimulierend auf gefährdete Zuschauer wirken könnte.
Was ist die Bedeutung der „Bordsteinszene“?
Diese Schlüsselszene zeigt die brutale Eskalation von Gewalt und dient in der Analyse als Beispiel für die schockierende Wirkung und die Konsequenzen rechten Hasses.
Welche Anforderungen stellt der Film an den Zuschauer?
Der Film setzt eine hohe Medienkompetenz und Reflexionsfähigkeit voraus, da die eigentliche Verurteilung der Gewalt erst durch den tragischen Ausgang deutlich wird.
- Quote paper
- Natalie Metzinger (Author), 2012, Filmanalyse American History X unter Betrachtung von Medienwirkungsthesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192445