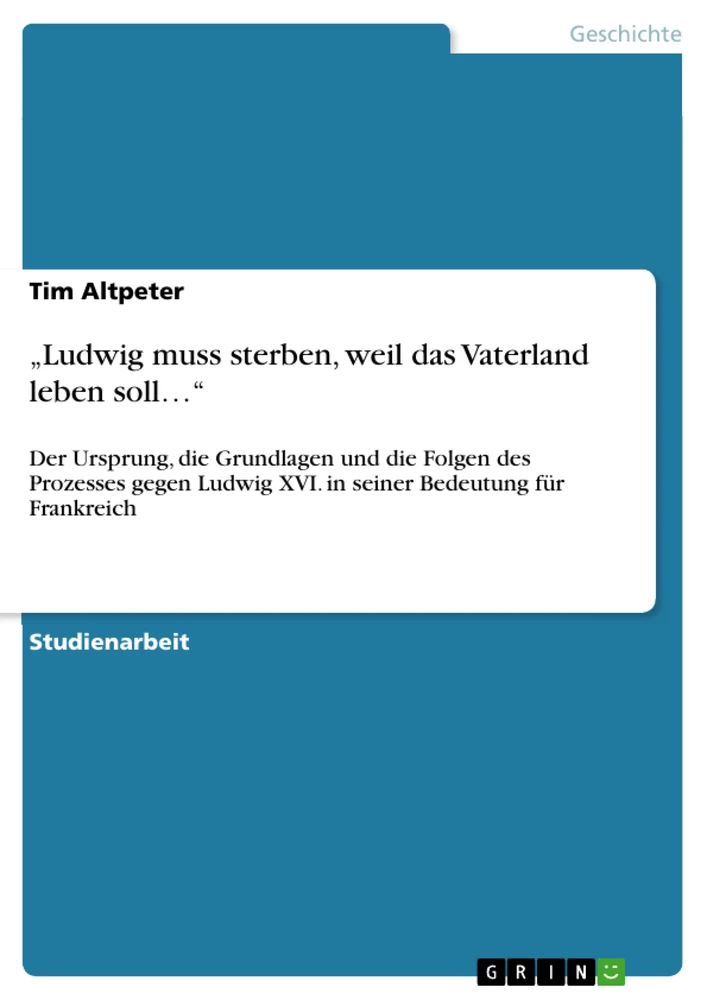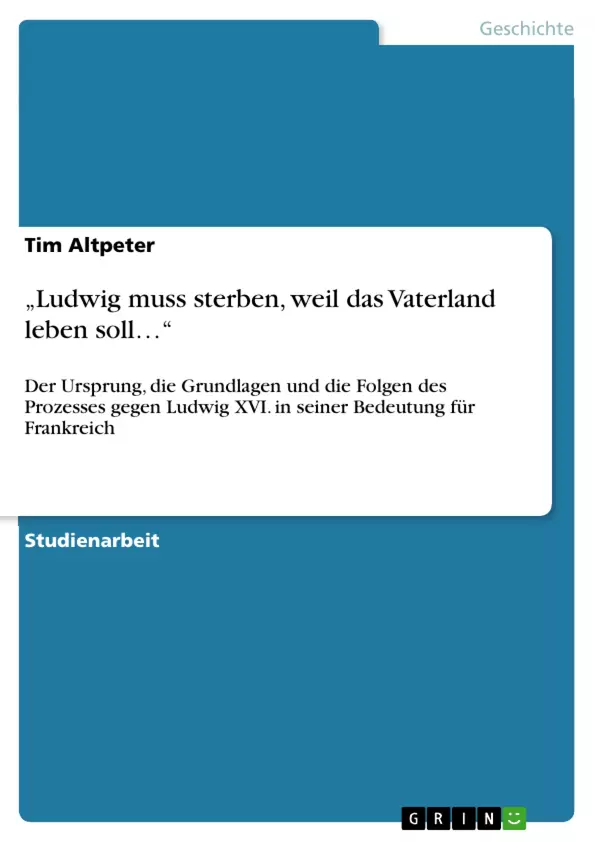Es ist erstaunlich, wie wenig sich die ältere französische Revolutionsforschung mit dem Thema des Prozesses gegen Ludwig XVI. auseinandergesetzt hat. Denn hier gipfelten alle Ereignisse, die seit der Einberufung der Generalstände im Mai 1789 stattgefunden hatten. Vielleicht liegt der Grund für die anscheinend geringe Anziehungskraft des Prozesses auf Historiker an seinem angeblich vorherbestimmten Ausgang (Sturm auf die Tuilerien, Absetzung des Königs, Proklamation der Republik, Internierung des Königs im Temple).1 Die Entscheidung über das weitere Schicksal des Königs erscheint in diesem Blickwinkel als schlichte Formalität, als vorherbestimmt und offensichtlich. Selbst die gegenrevolutionären und royalistischen Historiker wie Maistre und Bonald haben der Person des Königs nur noch wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Andere Historiker wie Aulard behandelten den Prozess nur aus der Perspektive des Parteikampfes von Girondisten und Montagnards. In keinem Fall werden die Schriften über den Prozess dem enormen symbolischen Wert, des Aufeinandertreffens von Revolution und König, gerecht. Unter den älteren französischen Historikern scheint allein Michelet dem Prozess eine derartige Wirkkraft zukommen zu lassen und widmet ihm ganze 100 Seiten in seiner Geschichte der Französischen Revolution.2 Erst im Zuge des 200jährigen Jubiläums des Prozesses 1993 schien er mit den grandiosen Werken Walzers, Lombards und Jordans wieder ins Licht der Forschung gerückt zu sein.3 Doch selbst in den aktuellen Biographien Ludwigs XVI., bleibt der Prozess eine Randerscheinung und auf wenige Seiten begrenzt.4 Die vorliegende Arbeit möchte dieser Relativierung des Prozesses entgegenwirken und zeigen, was für eine Bedeutung ihm eigentlich beizumessen ist. Dabei sollen vor allem die folgenden Fragenkomplexe gelöst werden: Erstens: War der Prozess tatsächlich vorherbestimmt und historisch unausweichlich? Warum fand er überhaupt statt, bzw. was war der historische Kontext seines Zustandekommens? Zweitens: Was waren die Grundlagen des Prozesses?
[...]
1 Ozouf, Mona, Art. „Der Prozess gegen den König“, in: Furet, François/Ozouf, Mona (Hg.), Kritisches Wörterbuch der Französischen Revolution, Band 1, Frankfurt am Main 1996, S. 160.
2 Ebd., S. 160.
3 Dazu sei auf die zahlreichen Ersterscheinungen zu diesem Thema im Jahr 1993 hingewiesen, vgl. Literatur- und Quellenverzeichnis.
4 Vgl. dazu z.B.: Taeger, Angela, Ludwig XVI. 1754-1793. König von Frankreich, Stuttgart 2006.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Ein unausweichlicher Prozess? Der Weg zum Prozess gegen Louis XVI.
- 2. Die Grundlagen des Prozesses gegen Ludwig XVI. und seine historische Perspektive
- 2.1. Kann der König verurteilt werden? Die Debatte über den juristischen Rahmen
- 2.2. Ist der König schuldig? Die Beweislast gegen Ludwig XVI. und seine Verteidigung
- 2.3. Welche Strafe soll Ludwig XVI. widerfahren? Gründe für die Todesstrafe
- 3. Der König ist tot, es lebe die Republik? Folgen und Wirkungen des Prozesses
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Prozess gegen Ludwig XVI. und widerlegt die gängige Sichtweise, dass dieser Prozess eine bloße Formalität war. Sie beleuchtet den Weg zum Prozess, seine juristischen Grundlagen, die Beweislage und die Debatte um die Todesstrafe. Zudem werden die Folgen des Prozesses für Frankreich analysiert.
- Die vermeintliche Unausweichlichkeit des Prozesses gegen Ludwig XVI.
- Die juristischen und politischen Grundlagen des Prozesses.
- Die Beweisführung und die Verteidigung Ludwigs XVI.
- Die Debatte um die Todesstrafe und die Motive der Entscheidung.
- Die langfristigen Folgen des Prozesses für die französische Geschichte.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung kritisiert die geringe Aufmerksamkeit, die der Prozess gegen Ludwig XVI. in der älteren französischen Revolutionsforschung erfahren hat. Sie argumentiert, dass der Prozess nicht als bloße Formalität abgetan werden kann, sondern einen enormen symbolischen Wert als Aufeinandertreffen von Revolution und Königtum besaß. Die Arbeit will diese Relativierung des Prozesses korrigieren und dessen Bedeutung herausstellen, indem sie die Fragen nach der Unausweichlichkeit des Prozesses, seinen Grundlagen und seinen Folgen untersucht.
1. Ein unausweichlicher Prozess? Der Weg zum Prozess gegen Louis XVI.: Dieses Kapitel untersucht die Ereignisse, die zum Prozess gegen Ludwig XVI. führten. Die gescheiterte Flucht nach Varennes wird als Wendepunkt dargestellt, der jedoch nicht deterministisch zum Prozess führte, sondern zu einer Polarisierung der französischen Gesellschaft. Die entscheidende Rolle spielten die ausländischen Mächte und die Agitationen der Emigranten, insbesondere die Pillnitzer Deklaration, die einen gegenrevolutionären Krieg befürchten ließen. Ludwig XVI. selbst befürwortete später den Krieg, teilweise um der Revolution zu entsprechen, teilweise aus eigenen strategischen Erwägungen.
2. Die Grundlagen des Prozesses gegen Ludwig XVI. und seine historische Perspektive: Dieses Kapitel analysiert die juristischen und politischen Grundlagen des Prozesses. Es befasst sich mit der Debatte um die Möglichkeit, einen König zu verurteilen, der Beweisführung gegen Ludwig XVI. und seiner Verteidigung sowie mit den Argumenten für die Todesstrafe. Ein Vergleich mit dem Prozess gegen Karl I. wird angedeutet.
3. Der König ist tot, es lebe die Republik? Folgen und Wirkungen des Prozesses: Dieses Kapitel behandelt die Folgen des Prozesses für die weitere Geschichte Frankreichs. Es untersucht den Einfluss des Prozesses auf die Revolution, das Empire, die Restauration, die Julimonarchie und das 19. Jahrhundert. Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung des Prozesses für die Konstituierung der französischen Nation aufzuzeigen und eindimensionale Ansichten über einen vorhersehbaren Untergang der Monarchie zu widerlegen.
Schlüsselwörter
Ludwig XVI., Französische Revolution, Prozess, Königtum, Republik, Revolutionärer Krieg, Pillnitzer Deklaration, Todesstrafe, Juristische Debatte, Nationale Identität, Konstituierung der Nation.
Häufig gestellte Fragen zum Prozess gegen Ludwig XVI.
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Prozess gegen Ludwig XVI. während der Französischen Revolution. Sie widerlegt die gängige Sichtweise, dass dieser Prozess eine bloße Formalität war, und beleuchtet stattdessen dessen juristische Grundlagen, die Beweislage, die Debatte um die Todesstrafe und die langfristigen Folgen für Frankreich.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die vermeintliche Unausweichlichkeit des Prozesses, die juristischen und politischen Grundlagen, die Beweisführung und Verteidigung Ludwigs XVI., die Debatte um die Todesstrafe und die Motive der Entscheidung, sowie die langfristigen Folgen des Prozesses für die französische Geschichte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und ein Fazit. Kapitel 1 untersucht den Weg zum Prozess, Kapitel 2 die juristischen und politischen Grundlagen sowie die Beweislage und die Debatte um die Todesstrafe. Kapitel 3 analysiert die Folgen des Prozesses für die französische Geschichte.
Welche Rolle spielte die gescheiterte Flucht nach Varennes?
Die gescheiterte Flucht nach Varennes wird als Wendepunkt dargestellt, der jedoch nicht deterministisch zum Prozess führte, sondern zu einer Polarisierung der französischen Gesellschaft beitrug. Die ausländischen Mächte und die Agitationen der Emigranten, insbesondere die Pillnitzer Deklaration, spielten ebenfalls eine entscheidende Rolle.
Wie wird die juristische Debatte um den Prozess dargestellt?
Die Arbeit befasst sich eingehend mit der Debatte um die Möglichkeit, einen König zu verurteilen, analysiert die Beweisführung gegen Ludwig XVI. und seine Verteidigung und untersucht die Argumente für die Todesstrafe. Ein Vergleich mit dem Prozess gegen Karl I. wird angedeutet.
Welche Folgen hatte der Prozess für Frankreich?
Das dritte Kapitel untersucht den Einfluss des Prozesses auf die weitere Geschichte Frankreichs, von der Revolution über das Empire und die Restauration bis hin zur Julimonarchie und dem 19. Jahrhundert. Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung des Prozesses für die Konstituierung der französischen Nation aufzuzeigen und eindimensionale Ansichten über einen vorhersehbaren Untergang der Monarchie zu widerlegen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ludwig XVI., Französische Revolution, Prozess, Königtum, Republik, Revolutionärer Krieg, Pillnitzer Deklaration, Todesstrafe, Juristische Debatte, Nationale Identität, Konstituierung der Nation.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit widerlegt die Sichtweise, dass der Prozess gegen Ludwig XVI. eine bloße Formalität war. Sie betont dessen enormen symbolischen Wert als Aufeinandertreffen von Revolution und Königtum und hebt die Bedeutung des Prozesses für die Konstituierung der französischen Nation hervor.
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts (B.A.) Geschichte Tim Altpeter (Autor:in), 2012, „Ludwig muss sterben, weil das Vaterland leben soll…“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192449