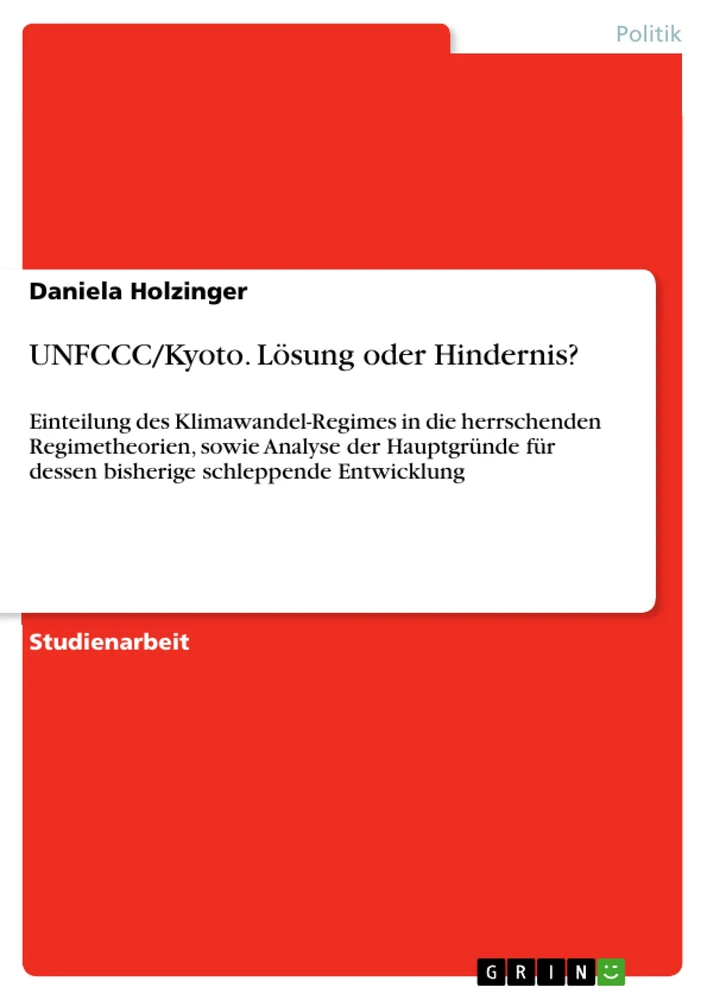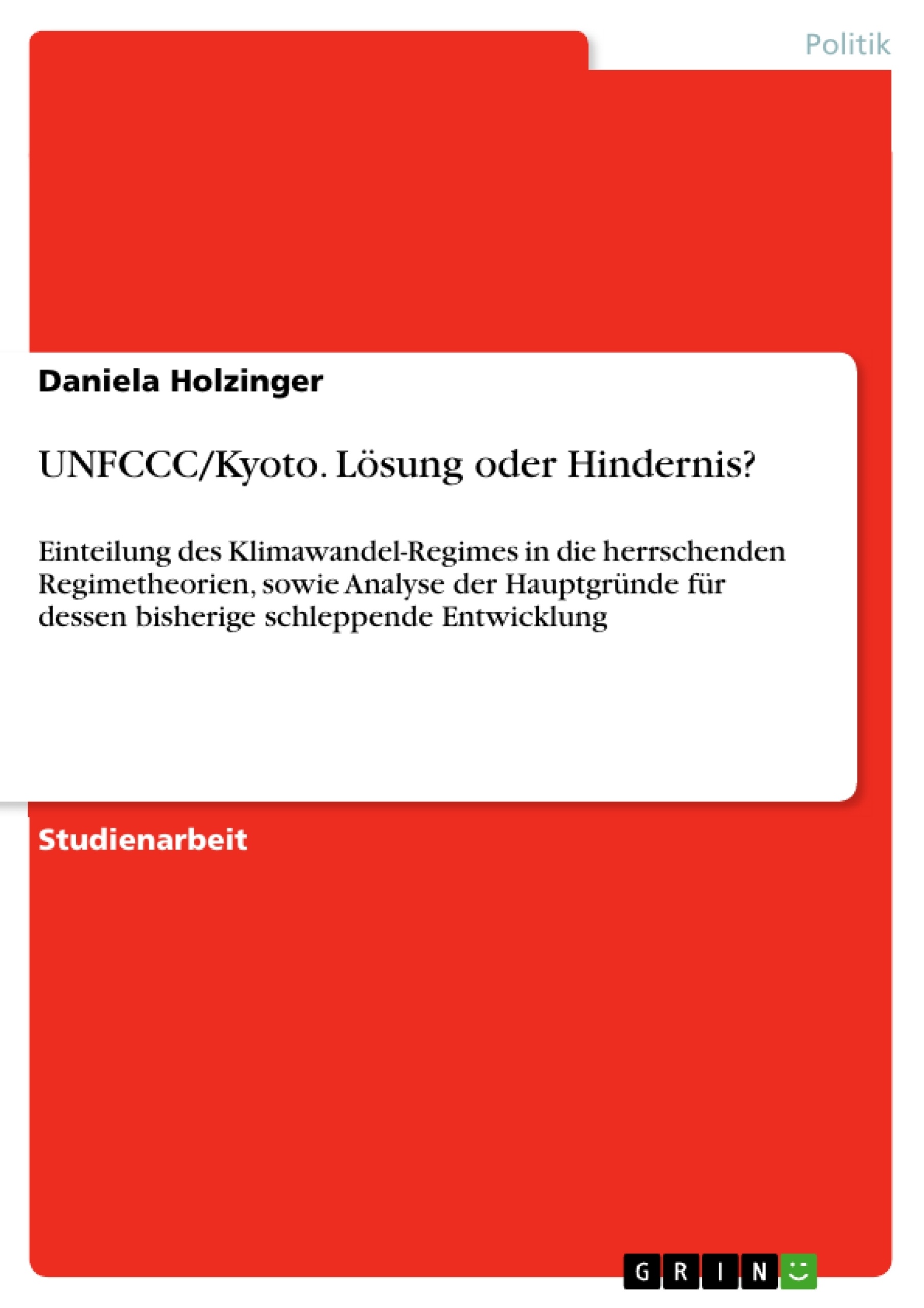Wie lässt sich das internationale Klimawandel-Regime in die herrschenden Regimetheorien einordnen bzw. inwiefern spielten die Faktoren Hegemon/Macht, Interessen sowie Wissen eine Rolle bei der Herausbildung des Regimes? Was stellen die Hauptgründe für die bisherige schleppende Integration der größten Emittenten, im Speziellen der USA, in das internationale Klimawandelregime dar?
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- Die Ausgangslage
- Forschungsleitende Fragestellungen
- Vorgehensweise
- 2. Theorien „Sozialer Dilemmata“
- „Soziale Dilemmata“ It. Kollock (1998)
- „Dilemmas of common interests“ It. Stein (1982)
- 3. Internationalen „Regimetheorien“
- Realismus - Institutionalismus - Kognitivismus
- „Macht als kausaler Faktor“ It. Habeeb (1988)
- Arbeitshypothese
- 4. Das internationale Klimaregime der UN
- Die Verhandlungen zur FCCC 1992
- Die Verhandlungen zum Kyoto-Protokoll 1997
- Der Kampf um das „Leadership“ im Klimaregime
- 5. Die USA als „,,issue-specific-power“
- „Commitment“ - „Control“ - „Alternatives“
- 6. Resümee
- 7. Literatur- und Quellenverzeichnis
- 8. Eidesstattliche Erklärung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Analyse des internationalen Klimawandelregimes im Kontext der herrschenden Regimetheorien. Sie untersucht die Funktionsweise des UNFCCC/Kyoto-Abkommens und analysiert die Hauptgründe für die bisherige, schleppende Entwicklung des Regimes. Das Hauptziel der Arbeit ist es, zu verstehen, ob das UNFCCC/Kyoto-Abkommen eine Lösung für den Klimawandel darstellt oder eher ein Hindernis ist.
- Analyse des UNFCCC/Kyoto-Abkommens anhand von Regimetheorien
- Identifizierung der Hauptgründe für die langsame Entwicklung des Klimaregimes
- Beurteilung der Effektivität des Abkommens im Kampf gegen den Klimawandel
- Bewertung der Rolle der USA im internationalen Klimaregime
- Untersuchung des Konzepts der „issue-specific-power“ im Kontext des Klimawandels
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die aktuelle Situation des Klimawandels und die Ergebnisse der Klimakonferenz COP-17 in Durban dar. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die das internationale Klimaregime vor sich hat und definiert die Forschungsleitenden Fragestellungen der Arbeit. Kapitel 2 beschäftigt sich mit den Theorien „Sozialer Dilemmata“, die als theoretischer Rahmen für die Analyse des Klimawandels dienen. Kapitel 3 analysiert die relevanten Regimetheorien (Realismus, Institutionalismus, Kognitivismus) und stellt eine Arbeitshypothese auf. Kapitel 4 beleuchtet die Geschichte des internationalen Klimaregimes der UN und untersucht die Verhandlungen zur FCCC und dem Kyoto-Protokoll. Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Rolle der USA im internationalen Klimaregime und dem Konzept der „issue-specific-power“.
Schlüsselwörter
Klimawandel, UNFCCC, Kyoto-Protokoll, Regimetheorien, Internationale Beziehungen, Soziale Dilemmata, Macht, Leadership, USA, „issue-specific-power“, Emissionsreduktion, Treibhausgase, Klimaregime.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Kyoto-Protokolls?
Das Ziel ist die völkerrechtlich verbindliche Reduktion der Emissionen von Treibhausgasen zur Bekämpfung des Klimawandels.
Warum ist die Integration der USA in das Klimaregime schwierig?
Die Arbeit analysiert dies anhand des Konzepts der "issue-specific-power" und untersucht Faktoren wie nationale Interessen und Machtstrukturen.
Welche Regimetheorien werden in der Arbeit genutzt?
Es werden der Realismus, der Institutionalismus und der Kognitivismus herangezogen, um das internationale Klimaregime zu erklären.
Was versteht man unter einem "Sozialen Dilemma" im Klimaschutz?
Es beschreibt die Situation, in der individuelle (nationale) Interessen im Widerspruch zum kollektiven Ziel des globalen Klimaschutzes stehen.
Ist das UNFCCC-Abkommen eine Lösung oder ein Hindernis?
Die Seminararbeit untersucht kritisch, ob die bestehenden Strukturen effektiv genug sind oder durch langsame Prozesse eher als Hindernis wirken.
- Quote paper
- Daniela Holzinger (Author), 2012, UNFCCC/Kyoto. Lösung oder Hindernis?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192495