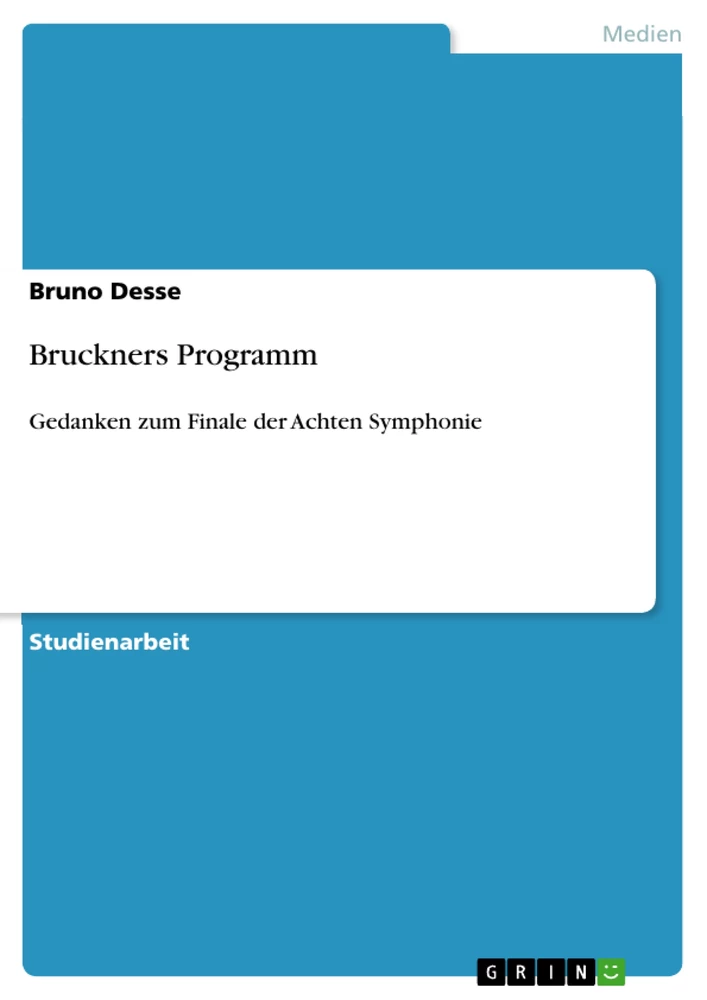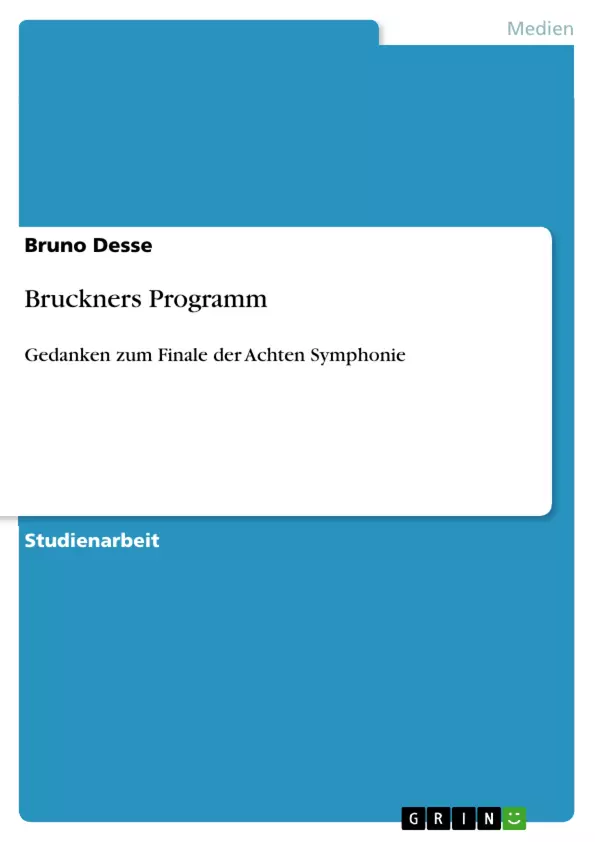Bruckners Symphonisches Schaffen als absolute Musik zu bezeichnen, scheint eine gesicherte musikwissenschaftliche These zu sein. Im Komplex aus der herrschenden Ästhetik der Romantik, der Schopenhauerschen Philosophie und maßgeblich durch E.T.A. Hoffmann geprägten „Metaphysik der Musik“, Hanslicks Idee einer „reinen, absoluten Tonkunst“, den „Neudeutschen“ um Wagner und der Programmatik eines Liszt und Berlioz, sowie der Stellung an der Spitze der Avantgarde von Bruckners Musik zu seinen Lebzeiten, wurde das Oeuvre von der Forschung überwiegend in ein Feld gerückt, das sich programmatische Interpretationen verbittet.
Dennoch ist die Existenz eines Programms – eine genauere Klärung des Begriffs wird noch zu unternehmen sein – namentlich zur Vierten und Achten Symphonie nicht zu leugnen. Dass diesen durch ihren fragmentarischen Charakter und ihren Eklektizismus so mancher Aspekt abgeht, der allgemein als notwendig für die Bezeichnung der Programmusik erachtet wird, berechtigt keineswegs dazu, diese Tatsache mehr oder weniger unter den Tisch zu kehren, wie es in der Bruckner-Forschung nur allzuoft geschehen ist. Ganz im Gegenteil muss das „Programm“ gerade dann, wenn es sich nicht in eingebrachte Denk- und Kompositionsmuster einfügt und daher weitere Fragen aufwirft, für die Interpretation Berücksichtigung finden. So wird sich auch zeigen, dass Bruckners literarische Hinterlassenschaft sehr wohl signifikative Bedeutung für eine Deutung der Achten Symphonie besitzt, zwar nicht als wörtliche Bedeutungszuweisung – aber als
ideengeschichtliches Dokument.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ideengeschichtliche Voraussetzungen
- Konzeption des Programms
- Funktion des Programms
- Gestalt des Programms
- Wesen des Programms
- Programmmusik und Charakterstück
- Methodische Voraussetzungen
- Analyse
- Deutung
- Schlusswort
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Finale der Achten Symphonie von Anton Bruckner und untersucht, ob und inwiefern ein „Programm“ im Sinne einer programmatischen Interpretation im Werk vorhanden ist. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, Bruckners symphonisches Schaffen im Kontext der ästhetischen Debatten des 19. Jahrhunderts zu betrachten und dabei sowohl die Ideen der „absoluten Musik“ als auch die programmatischen Strömungen zu berücksichtigen.
- Die Konzeption des Programms und seine Beziehung zur Komposition der Symphonie
- Die Rolle von literarischen Elementen in der Interpretation von Bruckners Musik
- Die Verbindung von „programmatischen“ und „absoluten“ Aspekten in Bruckners Symphonik
- Die ideengeschichtlichen und methodischen Voraussetzungen für die Interpretation programmatischer Musik
- Die Analyse des Finales der Achten Symphonie unter Berücksichtigung der semiotischen Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel stellt die These auf, dass Bruckners symphonisches Schaffen nicht ausschließlich als „absolute Musik“ betrachtet werden kann. Es wird die Existenz eines „Programms“ im Finale der Achten Symphonie thematisiert und der Ansatz der Arbeit erläutert.
- Ideengeschichtliche Voraussetzungen: Dieses Kapitel untersucht die theoretischen und ästhetischen Strömungen des 19. Jahrhunderts, die für die Interpretation von Bruckners Werk relevant sind. Es werden die Konzepte von „Programmusik“ und „absoluter Musik“ diskutiert, sowie die Bedeutung von literarischen Elementen in der Musikinterpretation.
- Methodische Voraussetzungen: Hier wird die Analysemethode vorgestellt, die in der Arbeit angewandt wird. Es werden die Aspekte der Analyse und der Deutung von Musik erläutert und die semiotische Theorie als Interpretationsansatz präsentiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Anton Bruckner, Achte Symphonie, Programmmusik, absolute Musik, Ideengeschichte, Semiotik, Analyse, Deutung, Finale, Verklärung, 19. Jahrhundert, Romantik, E.T.A. Hoffmann, Schopenhauer, Liszt, Berlioz, Wagner, Hanslick, Constantin Floros, Carl Dahlhaus.
Häufig gestellte Fragen
Ist Anton Bruckners Musik „absolute Musik“?
Obwohl die Forschung Bruckner oft der absoluten Musik zuordnet, zeigt diese Arbeit, dass besonders in der Vierten und Achten Symphonie programmatische Elemente vorhanden sind.
Was versteht man unter „Programmmusik“?
Programmmusik ist Musik, die einem außermusikalischen Plan folgt, etwa einer literarischen Vorlage oder einer konkreten ideengeschichtlichen Vorstellung.
Welche Bedeutung hat das Finale der Achten Symphonie?
Das Finale wird hier als ideengeschichtliches Dokument interpretiert, das über eine rein formale Analyse hinausgeht und semantische Deutungen zulässt.
Welchen Einfluss hatte Schopenhauer auf Bruckner?
Die Schopenhauersche Philosophie prägte die Ästhetik der Romantik und das Verständnis von Musik als „Metaphysik“, was für die Deutung von Bruckners Werk zentral ist.
Was ist eine semiotische Musikinterpretation?
Dabei wird Musik als ein System von Zeichen betrachtet, die bestimmte Bedeutungen oder Gefühle transportieren und entschlüsselt werden können.
- Arbeit zitieren
- M.A. Bruno Desse (Autor:in), 2009, Bruckners Programm, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192552