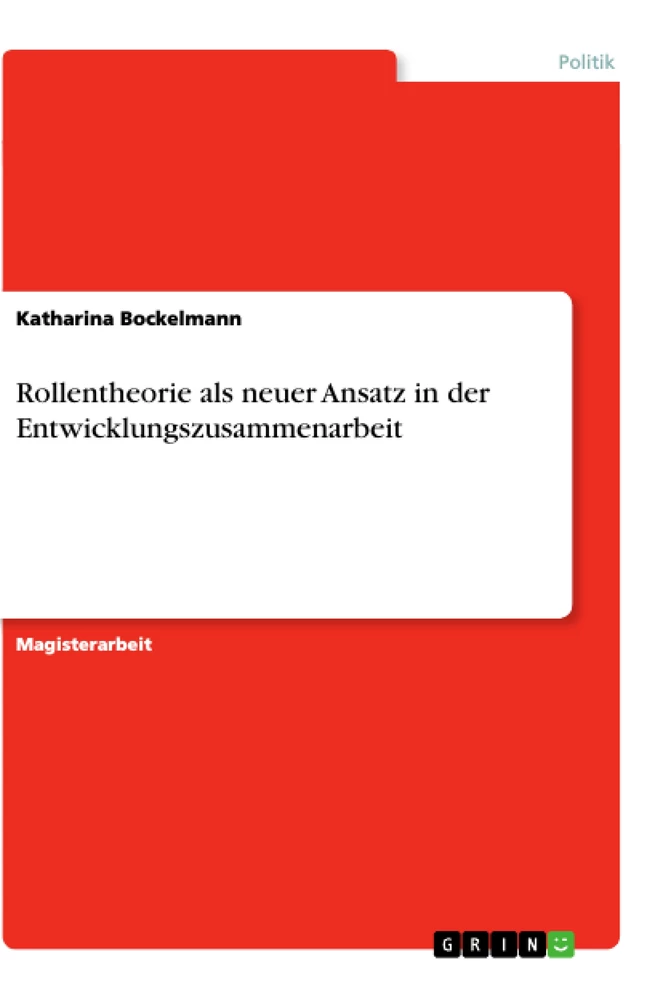In den 1990er Jahren kam es auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit zu einer massiven Veränderung. Bis zu diesem Zeitpunkt waren überwiegend Länder als Geber aktiv, die gemeinhin als „Industriestaaten“ galten und sich im Development Assistance Committee (DAC) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) organisiert hatten. Gegen Ende des letzten Jahrtausends betraten jedoch Staaten als Geber die Bühne der Entwicklungszusammenarbeit, die noch selber in großem Umfang Unterstützungsleistungen erhielten. Diese so genannten „neuen“ Geber, zu denen vor allem aufstrebende Wirtschaftsmächte wie zum Beispiel China und Brasilien zählen, sind bis heute nicht im DAC organisiert und sind damit auch an keine der von den „alten“ Gebern formulierten Richtlinien bezüglich der Mittelvergabe auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit gebunden. Eine Beschränkung ihrer Förderung auf Länder, die sich zur Umsetzung eines demokratischen Wandels verpflichten, besteht somit zum Beispiel für sie nicht. Damit stellt sich die Frage, woran sich diese Staaten bei ihrer Mittelvergabe orientieren, das heißt welchen Ländern sie Unterstützung zukommen lassen. Einen in dieser Hinsicht sehr vielversprechenden Ansatzpunkt bildet die Analyse der national role conceptions der „neuen“ Geber auf dem Feld der Entwicklungszusammenarbeit. Es ist möglich, dass anhand der Untersuchung der eigenen Vorstellungen dieser Staaten über ihre Funktion, Position sowie Rechte und Pflichten auf diesem Gebiet, eine Aussage über ihre Mittelvergabe getroffen werden kann. Die vorliegende Forschungsarbeit soll sich der Analyse dieses Zusammenhangs widmen. Konkret gilt es dabei zu untersuchen, ob sich die Ausrichtung der national role conception auf die Ausrichtung der Mittelvergabe auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit auswirkt. Somit lautet die Forschungsfrage dieser Arbeit: „Hat die Ausrichtung der national role conception Einfluss auf die Ausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit eines ʽneuenʼ Gebers?“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung und Relevanz der Untersuchung
- Theorie, Methodik und Aufbau der Arbeit
- Literaturlage und Forschungsstand
- Theoretische Grundlagen
- Die Entwicklung der Rollentheorie
- Zur theoretischen Grundlage der Untersuchung
- Theoretische Eingrenzung und Abgrenzung der Rollentheorie
- Einordnung der Rollentheorie in das Theoriespektrum der Internationalen Beziehungen
- Abgrenzung der Rollentheorie
- Methodik
- Auswahl des Politikfeldes
- Eingrenzung der Untersuchungsländer
- Hypothesenauswahl
- Konzeptspezifikation
- Begriffsdefinitionen
- Indikatorenauswahl
- Auswahl des Vergleichsdesigns
- Fallauswahl
- Kontextvariablen
- Die Ausrichtung der national role conceptions Brasiliens und Südafrikas
- Die Entwicklungszusammenarbeit Brasiliens und Südafrikas
- Brasiliens Entwicklungszusammenarbeit
- Brasilien als „neuer“ Geber in der Entwicklungszusammenarbeit
- Der Aufbau der Entwicklungszusammenarbeit Brasiliens
- Die Verteilung der brasilianischen Entwicklungszusammenarbeit
- Südafrikas Entwicklungszusammenarbeit
- Südafrika als „neuer“ Geber in der Entwicklungszusammenarbeit
- Der Aufbau der Entwicklungszusammenarbeit Südafrikas
- Die Verteilung der südafrikanischen Entwicklungszusammenarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entwicklungszusammenarbeit Brasiliens und Südafrikas im Kontext der Rollentheorie. Sie zielt darauf ab, das Geberverhalten der beiden „neuen“ Geber anhand eines vergleichenden Ansatzes zu analysieren. Die Untersuchung befasst sich mit der Frage, inwieweit die Rollentheorie als neuer Ansatz in der Entwicklungszusammenarbeit geeignet ist, das Geberverhalten von Brasilien und Südafrika zu erklären.
- Die Entwicklung der Rollentheorie als theoretisches Framework für die Analyse von Geberverhalten
- Die spezifischen Herausforderungen und Chancen der Entwicklungszusammenarbeit für Brasilien und Südafrika
- Der Vergleich der „national role conceptions“ der beiden Länder
- Die Analyse der Politiken und Strategien der Entwicklungszusammenarbeit Brasiliens und Südafrikas
- Die Bewertung der Wirksamkeit und der Auswirkungen der Entwicklungszusammenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung führt in die Fragestellung der Untersuchung ein, erläutert ihre Relevanz und stellt den theoretischen, methodischen sowie den strukturellen Rahmen der Arbeit dar. Außerdem wird ein Überblick über die bestehende Literatur und den Forschungsstand gegeben.
- Kapitel 2: Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung der Rollentheorie und ihrer Bedeutung als theoretische Grundlage für die Untersuchung. Es erfolgt eine Einordnung der Rollentheorie in das Theoriespektrum der Internationalen Beziehungen sowie eine Abgrenzung gegenüber anderen Theorien.
- Kapitel 3: Methodik: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Untersuchung, die Auswahl des Politikfeldes, die Eingrenzung der Untersuchungsländer, die Hypothesenauswahl, die Konzeptspezifikation, die Auswahl des Vergleichsdesigns und die Fallauswahl.
- Kapitel 4: Die Entwicklungszusammenarbeit Brasiliens und Südafrikas: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklungszusammenarbeit Brasiliens und Südafrikas im Detail. Es behandelt die Besonderheiten der beiden Länder als „neue“ Geber, den Aufbau ihrer Entwicklungszusammenarbeit und die Verteilung ihrer finanziellen und technischen Unterstützung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich zentralen Themen der Entwicklungszusammenarbeit, der Rollentheorie, der internationalen Beziehungen, der vergleichenden Politikforschung, des Geberverhaltens, der nationalen Rollenkonzeptionen, sowie der Entwicklungszusammenarbeit Brasiliens und Südafrikas. Besondere Bedeutung kommt dabei den empirischen Forschungsdaten und den konkreten Erfahrungen der beiden Länder im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit zu.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Rollentheorie in den Internationalen Beziehungen?
Die Rollentheorie untersucht die "National Role Conceptions" – also das Selbstverständnis eines Staates über seine Funktionen, Rechte und Pflichten im globalen System.
Wer sind die „neuen“ Geber in der Entwicklungszusammenarbeit?
Dazu zählen aufstrebende Mächte wie China, Brasilien und Südafrika, die nicht im DAC der OECD organisiert sind und eigene Kriterien für die Mittelvergabe anwenden.
Wie unterscheidet sich die Hilfe Brasiliens von der Südafrikas?
Die Arbeit analysiert die spezifischen Rollenbilder beider Länder und wie diese ihre regionale oder globale Ausrichtung der Unterstützung beeinflussen.
Warum sind neue Geber nicht an die OECD-Richtlinien gebunden?
Da sie keine Mitglieder des Development Assistance Committee (DAC) sind, müssen sie keine Bedingungen wie demokratischen Wandel an ihre Förderungen knüpfen.
Beeinflusst das Rollenbild eines Staates seine Mittelvergabe?
Ja, die Forschungsfrage der Arbeit lautet genau so: Es wird untersucht, ob die nationale Rollenkonzeption die strategische Ausrichtung der Entwicklungszusammenarbeit bestimmt.
- Arbeit zitieren
- Katharina Bockelmann (Autor:in), 2011, Rollentheorie als neuer Ansatz in der Entwicklungszusammenarbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192619