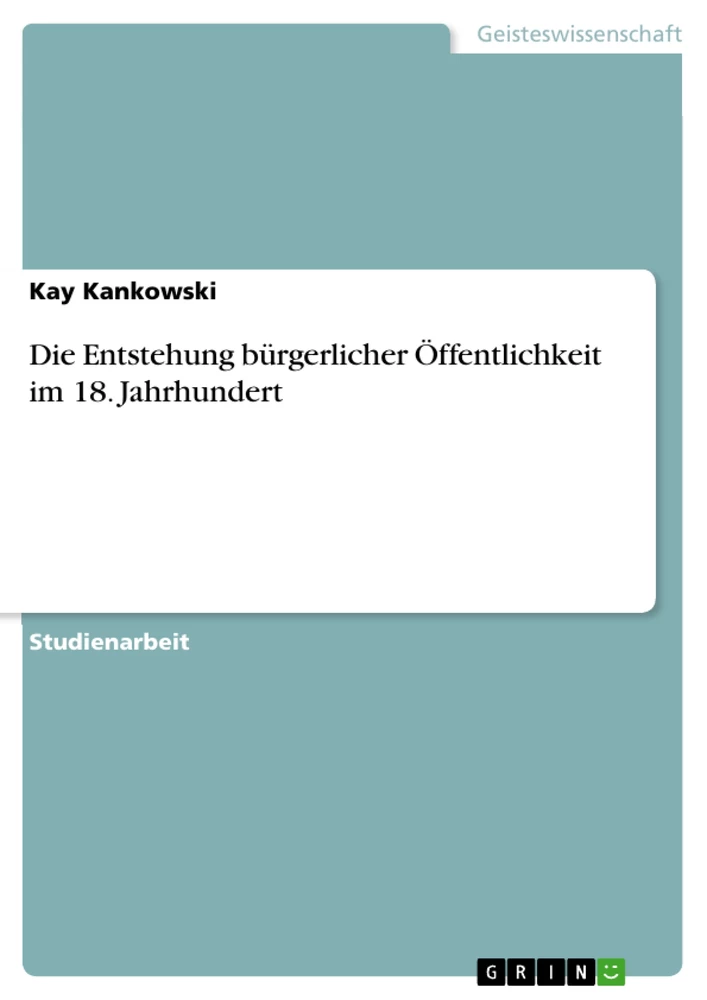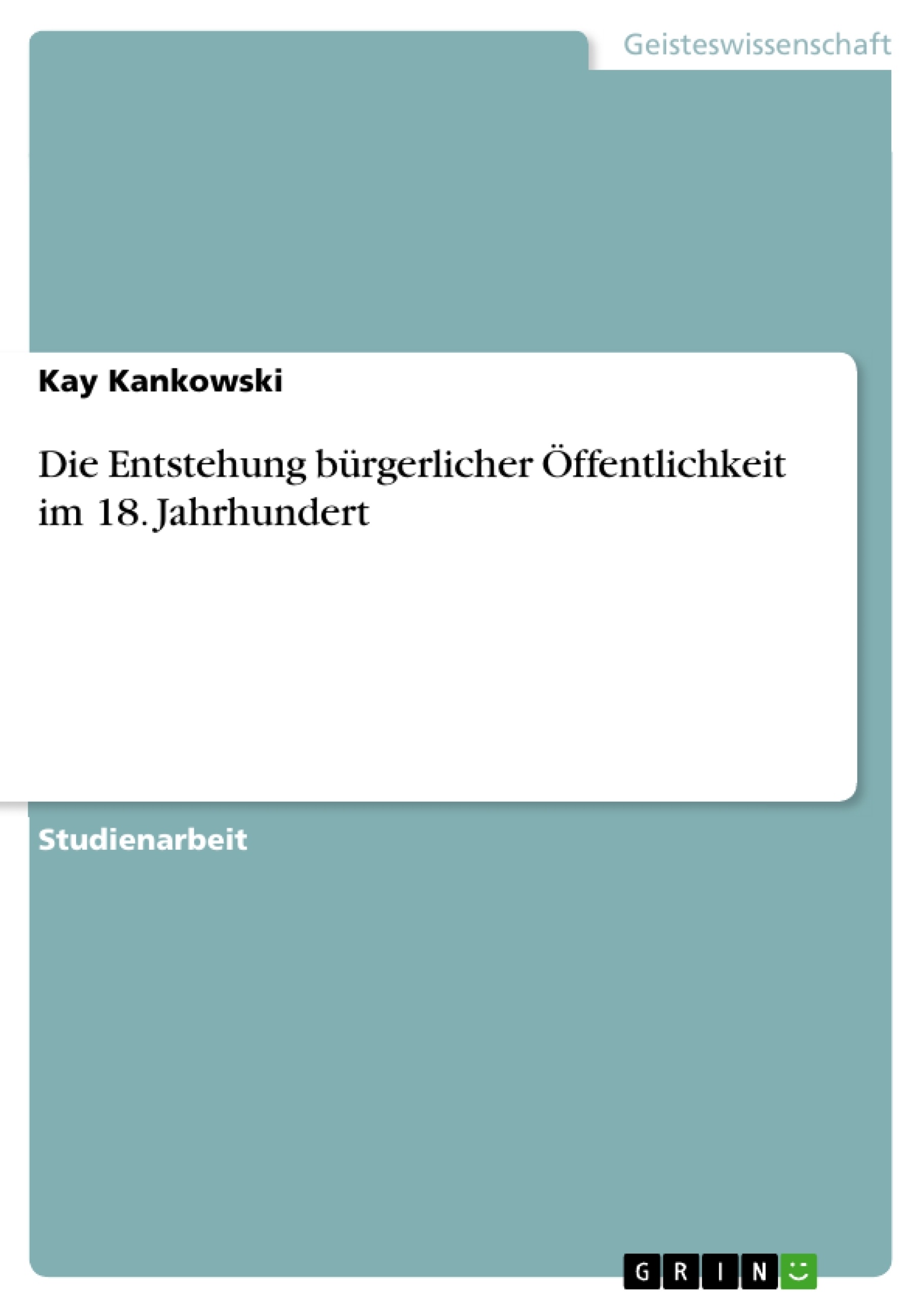Von der politischen, öffentlichen Gewalt ausgeschlossen, jedoch ökonomisch mächtig, beginnt das Bürgertum, sich auf sich selbst zu besinnen und definiert im öffentlichen Diskurs sein Selbstverständnis. Einen Teil dessen formuliert es in Wertvorstellungen und Idealen, die als bürgerliche Werte und Tugenden von universal-menschlicher Gültigkeit zu Handlungsmaximen erhoben werden und fortan geradezu als Kennzeichen bürgerlichen Lebens gelten.
Ein wechselseitiger, sich dialektisch durchdringender Prozess von Wertefindung, Diskussion, Verhandlung und (Neu-) Definition setzt ein, und zwar in aller Öffentlichkeit. Denn wo sonst wäre dies möglich? Wo sonst, außer im Kaffeehaus, in den Artikeln der Zeitschriften, beim Spazierengehen, im Theater, bei Konzerten oder im Salon ist Begegnung mit ‚seinesgleichen’, mit der bürgerlichen Welt möglich?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entstehung bürgerlicher Öffentlichkeit
- Habermas' Modell bürgerlicher Öffentlichkeit
- Bürgerliche Öffentlichkeit als Gegenspieler zur Obrigkeit
- Institutionen bürgerlicher Öffentlichkeit
- Moralische Wochenzeitschriften - Medium der Bildung und des Räsonierens
- Kaffeehäuser als Orte öffentlicher Debatte
- Neues Bürgertum
- Bürgerliche Werte
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung der bürgerlichen Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert, insbesondere im Kontext der Aufklärung. Sie analysiert die Bedingungen und Prozesse, die zur Bildung dieser neuen sozialen Formierung führten, sowie deren Auswirkungen auf die gesellschaftliche Entwicklung.
- Die Rolle der Aufklärung und ihrer Ideen im Entstehungsprozess der bürgerlichen Öffentlichkeit
- Die Entwicklung des neuen Bürgertums als Akteur der Aufklärung und Träger der bürgerlichen Öffentlichkeit
- Die Funktion und Bedeutung von Institutionen wie moralischen Wochenzeitschriften und Kaffeehäusern für die Ausformung der bürgerlichen Öffentlichkeit
- Die Bedeutung des Diskurses und der öffentlichen Meinung für die Gestaltung der bürgerlichen Öffentlichkeit
- Die Werte und Ideale, die das bürgerliche Gesellschaftsmodell prägten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der öffentlichen Be- und Verhandlung von Werten in der modernen Gesellschaft heraus und führt die Entstehung der bürgerlichen Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert als wichtiges Moment dieser Entwicklung ein. Kapitel 2 beleuchtet die Entstehung der bürgerlichen Öffentlichkeit anhand von Habermas' Idealmodell und zeichnet die Herausbildung des neuen Bürgertums als Gegenspieler zur Obrigkeit nach. Kapitel 3 untersucht zwei exemplarische Institutionen, die die bürgerliche Öffentlichkeit prägten: moralische Wochenzeitschriften als Medien der Bildung und des Räsonierens sowie Kaffeehäuser als Orte der öffentlichen Debatte. Die Kapitel 4 und 5 präsentieren einen Überblick über unterschiedliche Positionen in der Literatur zum Begriff Bürgertum und bürgerliche Werte.
Schlüsselwörter
Bürgerliche Öffentlichkeit, Aufklärung, Neues Bürgertum, Moralische Wochenzeitschriften, Kaffeehäuser, öffentlicher Diskurs, Werte, Ideale.
Häufig gestellte Fragen zur Entstehung bürgerlicher Öffentlichkeit
Was versteht man unter der bürgerlichen Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert?
Die bürgerliche Öffentlichkeit entstand im 18. Jahrhundert als Raum für Diskurs und Selbstvergewisserung des Bürgertums, das zwar ökonomisch mächtig, aber von politischer Gewalt ausgeschlossen war.
Welche Rolle spielten Kaffeehäuser für die öffentliche Debatte?
Kaffeehäuser dienten als zentrale Orte der Begegnung, an denen bürgerliche Werte diskutiert, verhandelt und neu definiert wurden.
Was sind moralische Wochenzeitschriften?
Diese Zeitschriften waren wichtige Medien der Aufklärung, die der Bildung und dem öffentlichen Räsonieren über Moral und Tugend dienten.
Welches Modell von Habermas wird zur Analyse verwendet?
Es wird das Idealmodell von Jürgen Habermas herangezogen, das die bürgerliche Öffentlichkeit als Gegenspieler zur staatlichen Obrigkeit beschreibt.
Welche Werte kennzeichnen das bürgerliche Selbstverständnis?
Bürgerliche Werte und Tugenden wurden als universal-menschlich gültige Handlungsmaximen erhoben und prägten das gesellschaftliche Modell.
- Quote paper
- Kay Kankowski (Author), 2012, Die Entstehung bürgerlicher Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192628