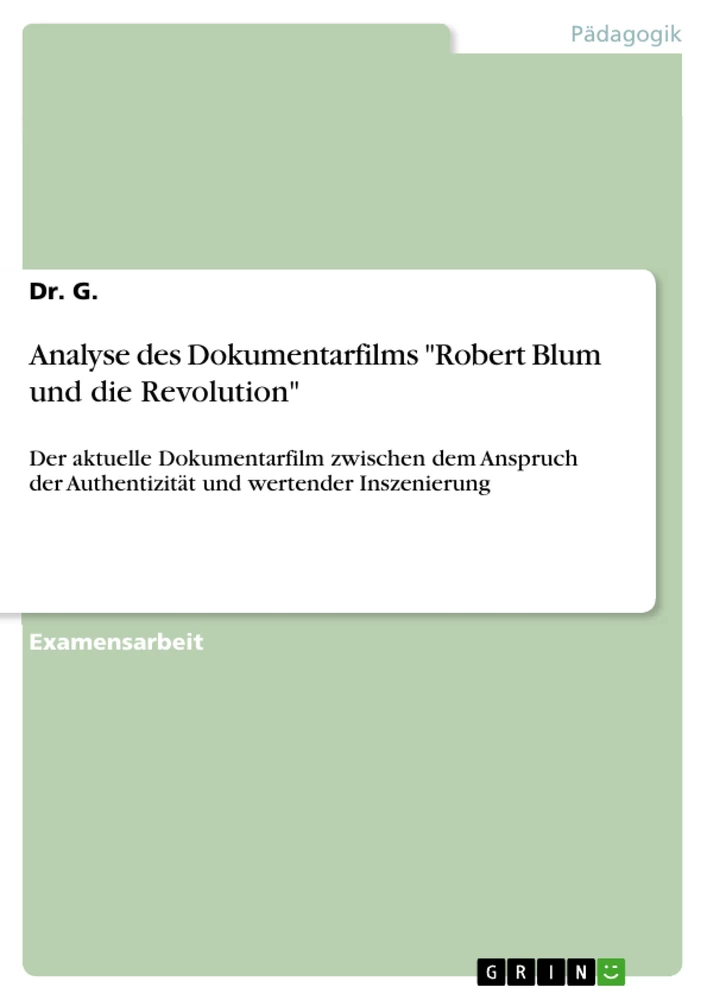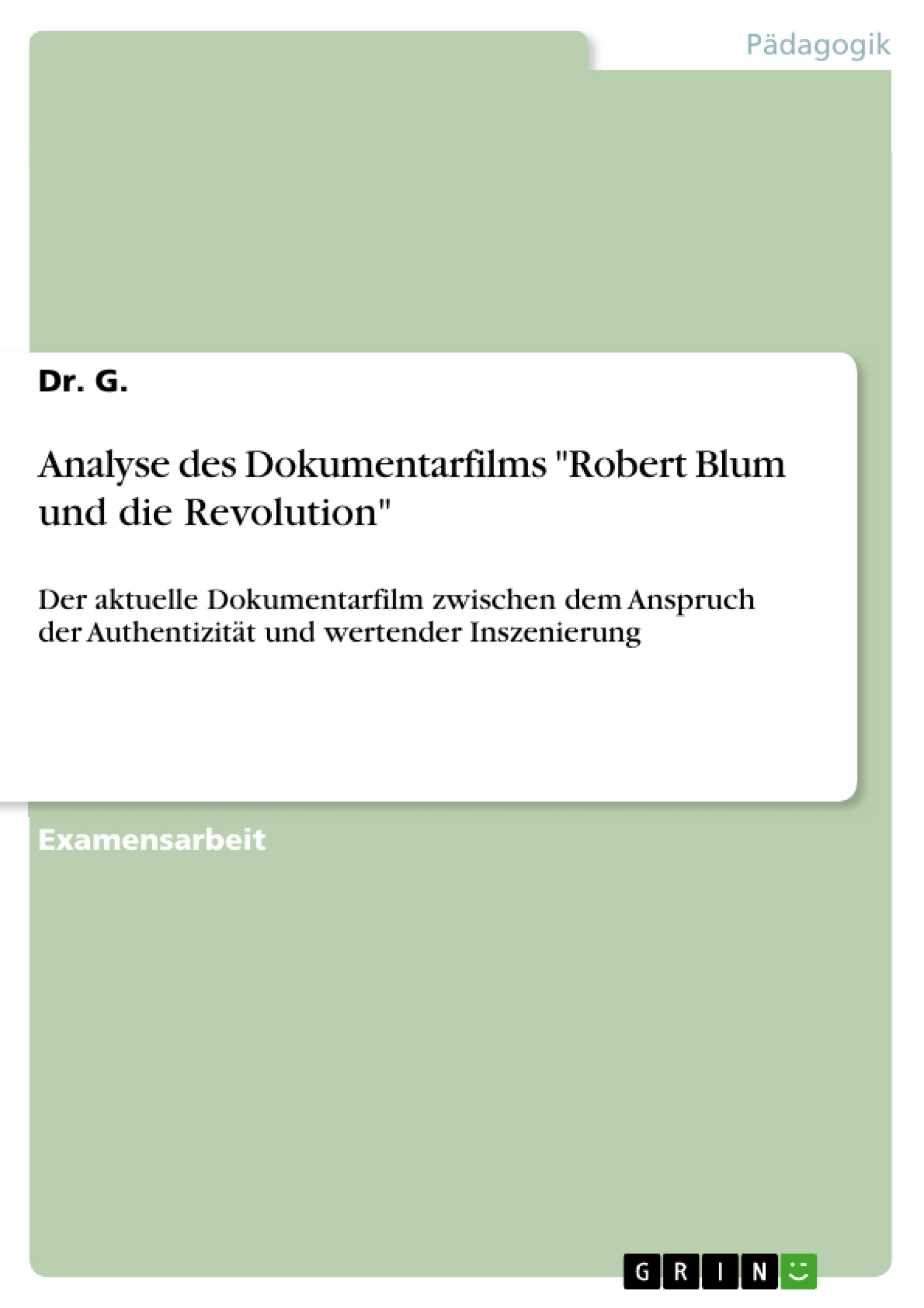Geschichte ist allgegenwärtig. Sie begegnet uns in Form nationaler Erinnerungskultur, gesellschaftlich und politisch verankerten Traditionen oder auch ganz lapidar im familiären Umfeld. Weit einflussreicher als solche übergeordneten Elemente der Geschichtswahrnehmung wirken sich jedoch medial inszenierte Einflüsse historischen Inhaltes aus. Filme prägen die gesellschaftliche Vorstellung vergangener Ereignisse sehr viel stärker und entfalten erheblich größere Anziehungskraft auf besonders jüngere Rezipienten als es der Geschichtsunterricht tut. Seit dessen existenzieller Krise in den 1970er Jahren begreift sich die Geschichtsdidaktik als wissenschaftliche Disziplin, „die über Bildungs- und Selbstbildungsprozesse, Lehr- und Lernprozesse an und durch Geschichte nachdenkt und damit die Entstehung, Beschaffenheit, Funktion und Beeinflussung von Geschichtsbewusstsein im gesellschaftlichen und historischen Zusammenhang thematisiert“ . Essentieller Bestandteil eines solch reflektierten Umgangs mit Geschichtsbildern ist es also, auch und besonders Filme als einflussreichste Quelle für die gesellschaftliche und eigene Vergangenheitswahrnehmung ausmachen und differenziert analysieren sowie deuten zu können.
In der vorliegenden Unterrichtssequenz soll versucht werden, mit einem Grundkurs Geschich-te die augenscheinlich objektivste Filmgattung, nämlich die des Dokumentarfilms, ihres ihr innewohnenden Anspruchs auf Objektivität zu entkleiden und einen implizit immer vorhandenen intentionalen Charakter offenzulegen. Dokumentationen mit geschichtlicher Thematik sind seit den 90er Jahren ein fester Bestandteil des öffentlichen Diskurses über Vergangenes und oftmals einzige Quelle für die historische Meinungsbildung vieler BürgerInnen geworden. Ihnen wird noch sehr viel mehr als Historischen Spielfilmen ein möglicher Erkenntniswert hinsichtlich der Ansicht „wie es wirklich war“ unterstellt und sie selbst gern als didaktische Reserve, Erleichterung oder Zusammenfassung am Ende einer Unterrichtsreihe genutzt. Die Dekonstruktion eines solchen Dokumentarfilms offenbart dessen übergeordnete Aussage-absicht und verdeutlicht den Schülerinnen und Schülern, dass mediale Formate nicht nur augenscheinlich werten, sondern auch unterschwellig einen inszenierenden Charakter aufweisen können. Dies soll innerhalb der vorliegenden Unterrichtssequenz über die Analyse filmischer Mittel und deren anschließende Deutung im Hinblick auf ihre wertende Wirkung geschehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Filmarbeit im Geschichtsunterricht
- Theoretische Grundlagen
- Eigenschaften des Dokumentarfilms
- Problemstellungen des Genres am Beispiel Guido Knopps
- Verwendungsmöglichkeiten im Unterricht
- Begründung des Unterrichtsvorhabens
- Thematisierung und didaktische Zugangsweise
- Angestrebte Kompetenzentwicklung
- Die Wichtigkeit von Medienkompetenz
- Herleitung der Erkenntnisabsicht
- Individuelle Kompetenzentwicklung der Lernenden
- Indikatoren zur Überprüfung der Kompetenzentwicklung
- Rahmenlehrplanbezug
- Aus den Kompetenz- und Durchführungsschwerpunkten abgeleitete Hypothesen
- Planung der Unterrichtssequenz
- Allgemeine Unterrichtsvoraussetzungen
- Spezielle Unterrichtsvoraussetzungen
- Sachstruktureller Entwicklungsstand
- Sachanalyse
- Generelle methodisch-didaktische Überlegungen
- Synopse der geplanten Unterrichtssequenz
- Allgemeine Unterrichtsvoraussetzungen
- Durchführung und Analyse ausgewählter Stunden der Sequenz
- Didaktisch-methodische Überlegungen zur 1. Stunde
- Erläuterung
- Didaktisch-methodische Überlegungen zur 7. Stunde
- Überblick zu didaktisch-methodischen Überlegungen der 2. bis 5. Stunde
- Didaktisch-methodische Überlegungen zur 6. Stunde
- Auswertung und Gesamtreflexion der Unterrichtssequenz
- Ergebnisse des Kompetenzrasters
- Indikatorengeleiteter Vergleich des Vorausurteils mit den sequenzbasierten Erkenntnissen
- Gesamtreflexion
- Persönliches Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese schriftliche Prüfungsarbeit analysiert die Verwendung des Dokumentarfilms „Die Deutschen - Robert Blum und die Revolution“ im Geschichtsunterricht. Die Arbeit zielt darauf ab, die didaktischen Möglichkeiten und Herausforderungen des Dokumentarfilms im Kontext der Vermittlung von Geschichtswissen zu untersuchen.
- Der kritische Umgang mit Dokumentarfilmen als Quelle historischer Informationen
- Die Dekonstruktion der scheinbaren Objektivität von Dokumentarfilmen
- Die Entwicklung von Medienkompetenz bei Schülerinnen und Schülern
- Die Rolle von Intention und Inszenierung in der filmischen Darstellung von Geschichte
- Die Vermittlung von historischem Wissen durch filmische Medien
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und beleuchtet die Bedeutung von Filmen als Einflussfaktoren auf die Geschichtswahrnehmung.
- Der Abschnitt „Theoretische Grundlagen“ erörtert die Eigenschaften des Dokumentarfilms und seine Verwendungsmöglichkeiten im Geschichtsunterricht. Dabei wird insbesondere auf die vermeintliche Objektivität des Genres und die Notwendigkeit eines kritischen Umgangs mit dokumentarischen Filmen eingegangen.
- Die „Begründung des Unterrichtsvorhabens“ erläutert die didaktische Zugangsweise, die angestrebte Kompetenzentwicklung der Lernenden und den Bezug zum Rahmenlehrplan.
- Der Abschnitt „Planung der Unterrichtssequenz“ beinhaltet die Analyse der Unterrichtsvoraussetzungen, die methodisch-didaktischen Überlegungen und die Synopse der geplanten Unterrichtssequenz.
- Die „Durchführung und Analyse ausgewählter Stunden der Sequenz“ beleuchtet die didaktisch-methodischen Überlegungen und die Auswertung einzelner Stunden der Unterrichtssequenz.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Dokumentarfilm, Geschichtsunterricht, Medienkompetenz, kritische Medienanalyse, Inszenierung, Authentizität, historisches Wissen, didaktische Ansätze und die Verwendung filmischer Medien im Bildungsprozess.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Analyse des Films "Robert Blum und die Revolution"?
Ziel ist es, die vermeintliche Objektivität des Dokumentarfilms zu dekonstruieren und den Schülern zu zeigen, dass auch Dokumentationen intentionale und inszenierte Charaktere besitzen.
Warum ist Medienkompetenz im Geschichtsunterricht wichtig?
Filme prägen das Geschichtsbild oft stärker als Schulbücher. Medienkompetenz befähigt Lernende, historische Darstellungen kritisch zu hinterfragen und filmische Mittel als Werkzeuge der Beeinflussung zu erkennen.
Welche Rolle spielt Robert Blum in der Dokumentation?
Robert Blum dient als zentrale Figur, um die Ereignisse der Revolution darzustellen. Die Analyse untersucht, wie seine Person filmisch inszeniert wird, um bestimmte historische Botschaften zu vermitteln.
Was kritisiert die Arbeit an Dokumentarfilmen im Stil von Guido Knopp?
Die Arbeit thematisiert Problemstellungen des Genres, wie sie oft bei Knopp-Produktionen auftreten, insbesondere die Vermischung von Fakten mit dramatischer Inszenierung, die den Anspruch auf Objektivität gefährden kann.
Wie wird die Kompetenzentwicklung der Schüler überprüft?
Die Überprüfung erfolgt durch ein Kompetenzraster und Indikatoren, die messen, inwieweit die Schüler in der Lage sind, filmische Mittel zu deuten und die Intention des Autors offenzulegen.
- Arbeit zitieren
- Dr. G. (Autor:in), 2012, Analyse des Dokumentarfilms "Robert Blum und die Revolution", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192742