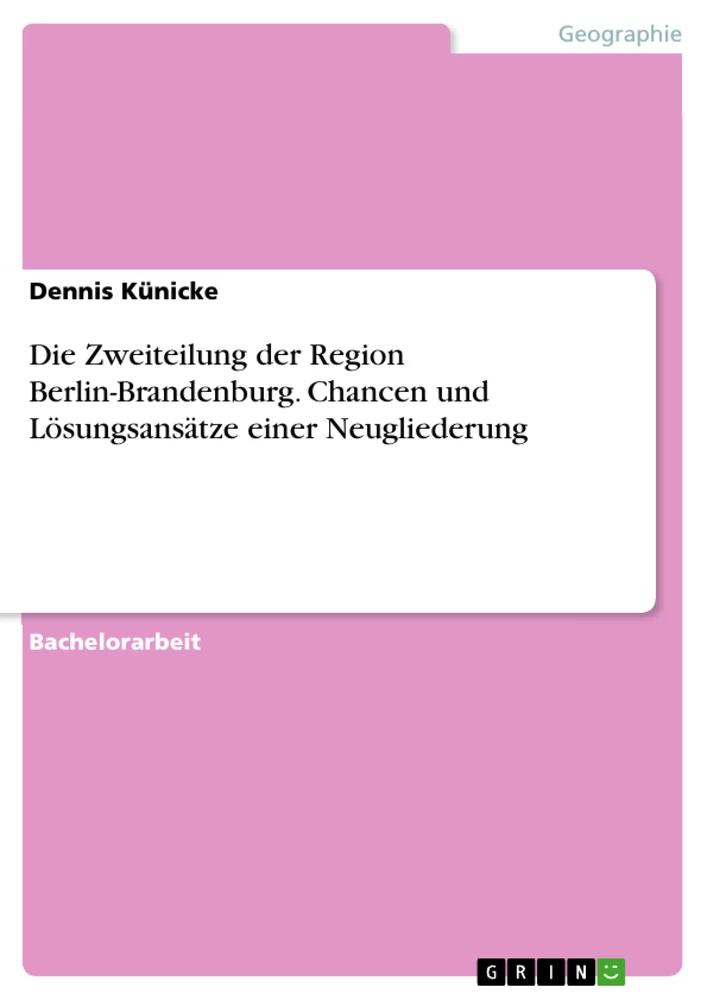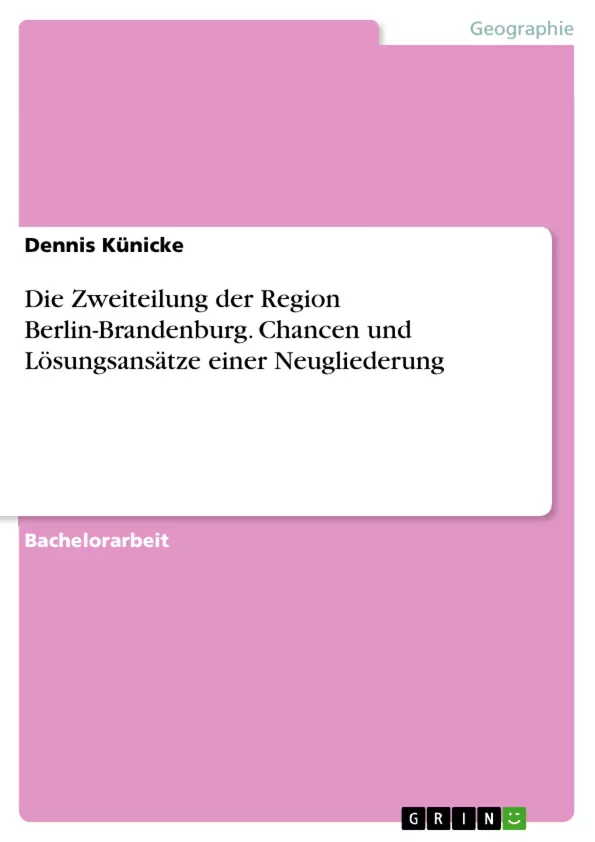Wenn man den Teletext des Fernsehsenders Rundfunk Berlin Brandenburg die Regionalnachrichten liest, kommt man oftmals durcheinander. Es findet keinerlei Trennung zwischen Nachrichten, die das Land Berlin betreffen, zu denen die das Land Brandenburg betreffen, statt. Alltäglich begegnen den Einwohnern des Landes Berlins und denen des Berliner Umlandes ähnliche Verquickungen. Sei es die Berliner S‐Bahn, die bis Potsdam fährt oder sei es die Ankunft auf den künftig zentralen Hauptstadtflughafen Schönefeld nach einer Flugreise – Berlin‐Brandenburg wächst immer mehr zusammen.
Bereits der deutsch-deutsche Einigungsvertrag sah eine "mögliche Neugliederung des Raumes Berlin/Brandenburg" als, durch die deutsche Einheit, aufgeworfene Frage an. Obgleich der Bundesgesetzgeber längst den beiden Ländern die Möglichkeit geboten hat, zu fusionieren, ist diese "kleine Einheit" bislang ausgeblieben. Zwar gab es 1996 einen Volksentscheid über die Frage einer Länderneugliederung. Doch wurde dieser Vorschlag von einer Mehrheit der Brandenburger abgelehnt. Dass aus der aktuellen politischen Zweiteilung der Region auf diversen Politikfeldern Probleme entstehen, sah man zuletzt im Frühjahr des Jahres 2009, als Brandenburgs Justizminister Dietmar Schöneburg die Unterbringung von Berliner Häftlingen in den unterausgelasteten brandenburgischen Gefängnissen, anstelle eines Berliner Neubaus, anbot. Die Berliner Justizsenatorin Gisela von der Aue, lehnte dieses Angebot, mit dem Verweis auf rechtliche Hindernisse, ab und hält weiter an einem Gefängnisneubau fest.
Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die Probleme der jetzigen Zweiteilung der Region zu benennen und die Chancen des Lösungsansatzes einer Neugliederung zu beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- 1. EINLEITUNG
- 2. HISTORISCHER ABRISS
- 2.1 POLITISCH-TERRITORIALE ENTWICKLUNG BRANDENBURGS BIS 1990
- 2.1.1 Die Gründungsjahre
- 2.1.2 Die Herrschaft der Hohenzollern
- 2.1.3 Brandenburg während der Weimarer Demokratie und der NS-Diktatur
- 2.1.4 Brandenburg nach 1945
- 2.2 POLITISCH-TERRITORIALE ENTWICKLUNG BERLINS BIS 1990
- 2.2.1 Die Gründungsjahre Berlins
- 2.2.2 Berlins Aufstieg unter den Hohenzollern
- 2.2.3 Berlin unter der Weimarer Demokratie und der NS-Zeit
- 2.2.4 Berlin nach 1945
- 2.3 ZWISCHENBILANZ - HISTORISCHER ABRISS
- 3. DIE NEUGLIEDERUNG DES RAUMES BERLIN-BANDENBURG
- 3.1 DER BEGRIFF DER NEUGLIEDERUNG
- 3.2 VERFASSUNGSRECHTLICHE GRUNDLAGEN EINER NEUGLIEDERUNG DES RAUMES BERLIN-BRANDENBURG
- 3.2.1 Art. 29 GG - Grundnorm einer Neugliederung des Bundesgebietes
- 3.2.1.1 Historische Entwicklung des Art. 29 GG
- 3.2.1.2 Aufbau und Zielrichtung des Art. 29 GG
- 3.2.2 Art. 118a GG - Grundlage einer Fusion der Länder Berlin und Brandenburg
- 3.2.2.1 Entstehungsgeschichte des Art. 118a GG
- 3.2.2.2 Aufbau und Zielrichtung des Art. 118a GG
- 3.2.3 Ermächtigungsgrundlagen auf Landesebene
- 3.2.3.1 Art. 116 BbgVerf
- 3.2.3.2 Art. 96 VVB
- 3.2.4 Zwischenbilanz - Rechtliche Grundlagen
- 3.3 ABWÄGUNG DER VOR- UND NACHTEILE EINER FUSION
- 3.3.1 wirtschafts- und finanzpolitische Aspekte einer Fusion
- 3.3.1.1 Ausgangslage für das Land Berlin
- 3.3.1.2 Ausgangslage für das Land Brandenburg
- 3.3.1.3 finanz- und wirtschaftspolitische Perspektiven einer Fusion
- 3.3.1.4 Bundespolitische Interessenslage
- 3.3.2 Machtpolitische und demokratische Aspekte einer Fusion
- 3.3.2.1 Machtpolitische Argumentation
- 3.3.2.2 Minderung des Gewichtes der Bürger
- 3.3.3 Zwischenbilanz - Abwägung der Argumente
- 3.4 DER ERSTE ANLAUF ZU EINER FUSION IM JAHR 1996
- 3.4.1 Prozess der Verhandlungen über die Bedingungen einer Fusion
- 3.4.2 Aufbau und Inhalt der Fusionsverträge
- 3.4.2.1 Neugliederungsvertrag
- 3.4.2.2 Staatsvertrag zur Regelung der Volksabstimmung
- 3.4.3 Der Volksentscheid
- 3.4.3.1 Der Volksentscheid im Land Berlin
- 3.4.3.2 Der Volksentscheid im Land Brandenburg
- 3.4.4 Ursachen des Scheiterns
- 4. KOOPERATION ALS ALTERNATIVE ZUR NEUGLIEDERUNG
- 4.1 BEGRIFF DES KOOPERATIVEN FÖDERALISMUS
- 4.2 STAND UND PERSPEKTIVE DER ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN BERLIN UND BRANDENBURG
- 5. BILANZ UND PERSPEKTIVE
- 6. QUELLENVERZEICHNIS
- ANLAGE A - EXPERTENINTERVIEW
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Neugliederung des Raumes Berlin-Brandenburg, einem Thema, das in den 1990er Jahren große politische Aufmerksamkeit erregte. Im Zentrum steht die Frage, ob eine Fusion der beiden Länder unter den damaligen Rahmenbedingungen sinnvoll gewesen wäre. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung beider Länder, die rechtlichen Grundlagen einer Fusion, die Vor- und Nachteile der Neugliederung sowie die Alternative der Kooperation zwischen Berlin und Brandenburg.
- Historische Entwicklung von Berlin und Brandenburg bis 1990
- Rechtliche Grundlagen der Neugliederung
- Wirtschafts- und finanzpolitische Aspekte der Fusion
- Machtpolitische und demokratische Aspekte der Fusion
- Kooperation als Alternative zur Neugliederung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 2 gibt einen historischen Abriss der politischen und territorialen Entwicklung von Berlin und Brandenburg bis 1990.
- Kapitel 3 analysiert die rechtlichen Grundlagen einer Neugliederung des Raumes Berlin-Brandenburg, insbesondere Art. 29 GG und Art. 118a GG.
- Kapitel 3.3 betrachtet die Vor- und Nachteile einer Fusion aus wirtschafts- und finanzpolitischer sowie machtpolitischer und demokratischer Sicht.
- Kapitel 3.4 beleuchtet den ersten Anlauf zu einer Fusion im Jahr 1996, einschließlich der Verhandlungen, der Fusionsverträge und des Volksentscheides.
- Kapitel 4 widmet sich der Kooperation als Alternative zur Neugliederung, insbesondere dem Konzept des kooperativen Föderalismus.
Schlüsselwörter
Neugliederung, Berlin-Brandenburg, Fusion, Art. 29 GG, Art. 118a GG, wirtschaftspolitische Aspekte, finanzpolitische Aspekte, Machtpolitik, Demokratie, kooperativer Föderalismus, Volksentscheid
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde die Länderfusion von Berlin und Brandenburg 1996 abgelehnt?
Während die Berliner mehrheitlich zustimmten, lehnte die Mehrheit der Brandenburger die Fusion beim Volksentscheid ab, unter anderem aus Sorge vor finanziellen Nachteilen.
Was regelt Artikel 29 des Grundgesetzes?
Art. 29 GG ist die Grundnorm für die Neugliederung des Bundesgebietes, um leistungsfähige Ländergrößen zu schaffen.
Was ist der Unterschied zwischen Neugliederung und Kooperation?
Neugliederung bedeutet eine politische Fusion zu einem Bundesland; Kooperation bezeichnet die Zusammenarbeit zweier eigenständiger Länder (kooperativer Föderalismus).
Welche wirtschaftlichen Vorteile hätte eine Fusion?
Vorteile wären eine gemeinsame Planung (z.B. Infrastruktur, Flughäfen), Einsparungen in der Verwaltung und eine stärkere Position im Bundesrat.
Was ist Artikel 118a des Grundgesetzes?
Dieser Artikel wurde speziell geschaffen, um die Fusion der Länder Berlin und Brandenburg durch eine Vereinbarung der Länder ohne Bundesgesetz zu ermöglichen.
- Citation du texte
- Dennis Künicke (Auteur), 2011, Die Zweiteilung der Region Berlin-Brandenburg. Chancen und Lösungsansätze einer Neugliederung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192749