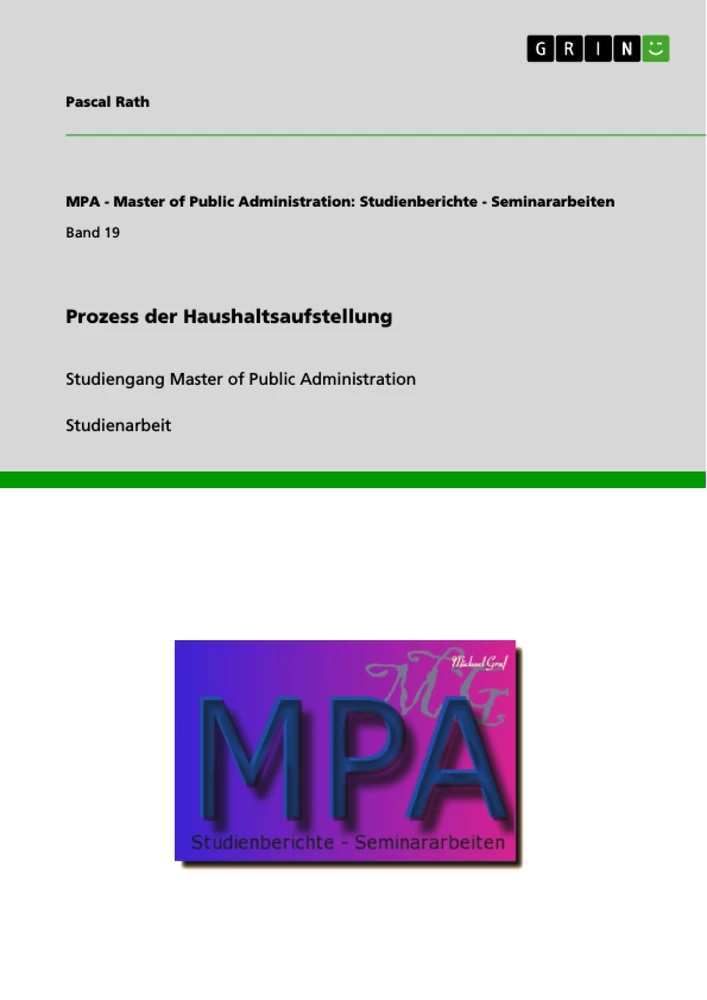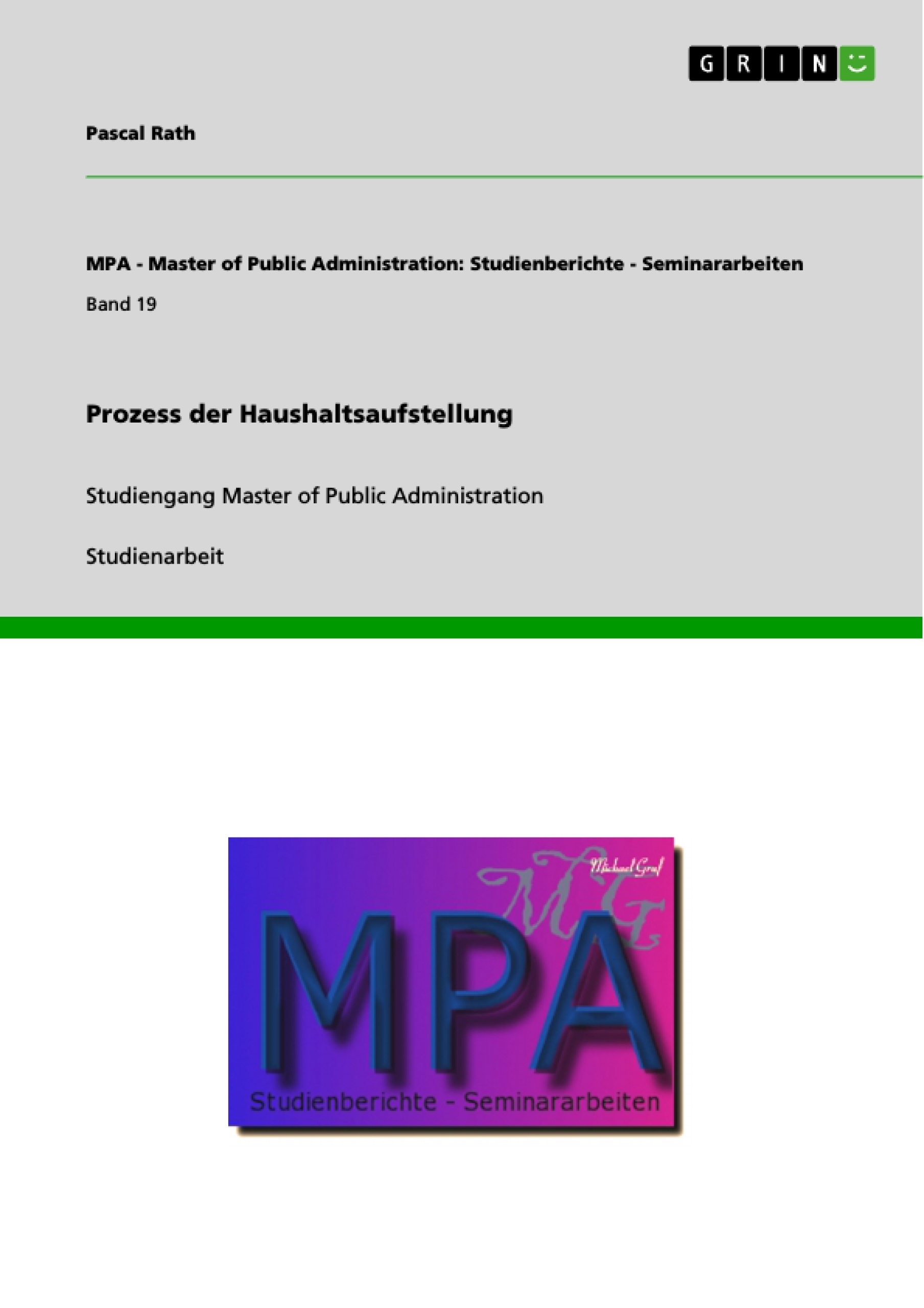Einleitung
Die öffentliche Verwaltung steht in einem Zielkonflikt zwischen unterschiedlichen finanziellen Interessen auf der einen Seite und den begrenzten Finanzmitteln auf der anderen Seite. Der Haushaltsplan ist ein zentrales Steuerungsinstrument für die Umsetzung der unterschiedli-chen Interessen. Er ist die Grundlage für das fiskalische Handeln. Entsprechend bedeutsam sind die Aufstellung des Haushalts und die Position des Kämmerers in der Verwaltungshie-rarchie. Zutreffen mag diese Einordnung durch das Zitat des niedersächsischen Finanzminis-ters Möllring bestätigen werden: „Der Ministerpräsident kann mich zwar entlassen, aber er kann nicht in mein Ressort hineinfunken“.
Der föderalen Struktur der Bundesrepublik und dem Selbstverwaltungsrecht der Kommunen ist es geschuldet, dass die Haushaltsaufstellung nach keinem einheitlichen Muster erfolgt. Neben dem nachfolgend als klassisch beschriebenen Prozess der Haushaltsaufstellung, finden sich heute auch Ansätze mit einer stärkeren Bürgerbeteiligung oder Outputorientie-rung.
Die vorliegende Arbeit verfolgt im Rahmen der Aufgabenstellung einen deskriptiven Ansatz. Aufgrund des beschränkten Umfanges dieser Arbeit wird der klassische Prozess ausführli-cher, die neueren Prozesse in ihren Besonderheiten beschrieben. Dabei wird die These auf-gestellt, dass der Prozess abhängig von der Art der Haushaltssteuerung ist. Zu Beginn soll eine Prozessdefinition als Grundlage für die Betrachtung eingeführt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Prozessdefinition
- 3. Klassischen Haushaltsaufstellungsprozess
- 3.1 Mittelanmeldung der Fachbereiche
- 3.2 Abstimmung zwischen Fachbereich und Kämmerei
- 3.3 Entwurf des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung
- 3.4 Einbringung des Haushalts in die Volksvertretung
- 4. Outputorientierte Haushalt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Prozess der Haushaltsaufstellung im Kontext der öffentlichen Verwaltung. Sie untersucht, wie die unterschiedlichen Interessen und begrenzten Finanzmittel durch den Haushaltsplan gesteuert werden. Dabei werden sowohl der klassische, inputorientierte Prozess als auch der outputorientierte Ansatz der Haushaltssteuerung beleuchtet.
- Die Rolle des Haushaltsplans als zentrales Steuerungsinstrument
- Der klassische Haushaltsaufstellungsprozess in der Kameralistik
- Die Bedeutung der Input- und Outputsteuerung im Verwaltungsprozess
- Die Integration des New Public Management-Ansatzes in die Haushaltsaufstellung
- Die Herausforderungen und Chancen der Bürgerbeteiligung im Haushaltsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Haushaltsaufstellung in der öffentlichen Verwaltung ein. Es beleuchtet den Zielkonflikt zwischen unterschiedlichen finanziellen Interessen und begrenzten Ressourcen. Die Bedeutung des Haushaltsplans als zentrales Steuerungsinstrument für die Umsetzung dieser Interessen wird herausgestellt.
Kapitel zwei definiert den Begriff des Prozesses und skizziert seine Anwendung im modernen Verwaltungsmanagement. Es werden die einzelnen Schritte eines Prozesses sowie die Bedeutung von Eingaben, Teilprozessen und Ergebnissen erklärt.
Kapitel drei fokussiert den klassischen Prozess der Haushaltsaufstellung in der Kameralistik. Es werden die einzelnen Teilprozesse, von der Mittelanmeldung der Fachbereiche über die Abstimmung mit der Kämmerei bis hin zur Einbringung des Haushalts in die Volksvertretung, detailliert beschrieben.
Kapitel vier befasst sich mit der outputorientierten Haushaltssteuerung. Im Gegensatz zum inputorientierten Ansatz wird der Fokus hier auf die Verwaltungsleistungen und die Erreichung von Leistungszielen gelegt.
Schlüsselwörter
Haushaltsaufstellung, Haushaltsplan, Kameralistik, Inputsteuerung, Outputsteuerung, Verwaltung, New Public Management, Bürgerbeteiligung, Finanzmittel, Interessensausgleich, Volksvertretung, Kommunalaufsicht, Haushaltssatzung, Prozessmanagement
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Funktion eines Haushaltsplans?
Der Haushaltsplan dient als zentrales Steuerungsinstrument für die Umsetzung unterschiedlicher finanzieller Interessen in der öffentlichen Verwaltung und bildet die Grundlage für das fiskalische Handeln.
Welche Rolle spielt der Kämmerer im Prozess der Haushaltsaufstellung?
Der Kämmerer nimmt eine bedeutende Position in der Verwaltungshierarchie ein. Seine Eigenständigkeit wird oft durch das Zitat verdeutlicht, dass selbst ein Ministerpräsident ihm nicht direkt in sein Ressort „hineinfunken“ kann.
Wie läuft der klassische Prozess der Haushaltsaufstellung ab?
Der klassische Prozess umfasst die Mittelanmeldung der Fachbereiche, die Abstimmung zwischen Fachbereich und Kämmerei, den Entwurf des Haushaltsplans sowie die Einbringung in die Volksvertretung.
Was unterscheidet die inputorientierte von der outputorientierten Haushaltssteuerung?
Während die klassische Steuerung (Input) auf die bereitgestellten Ressourcen schaut, fokussiert sich der outputorientierte Ansatz auf die tatsächlichen Verwaltungsleistungen und die Erreichung von Leistungszielen.
Gibt es Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung im Haushaltsprozess?
Ja, moderne Ansätze der Haushaltsaufstellung integrieren verstärkt die Bürgerbeteiligung, um den Prozess transparenter und partizipativer zu gestalten.
- Arbeit zitieren
- Pascal Rath (Autor:in), 2012, Prozess der Haushaltsaufstellung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192777