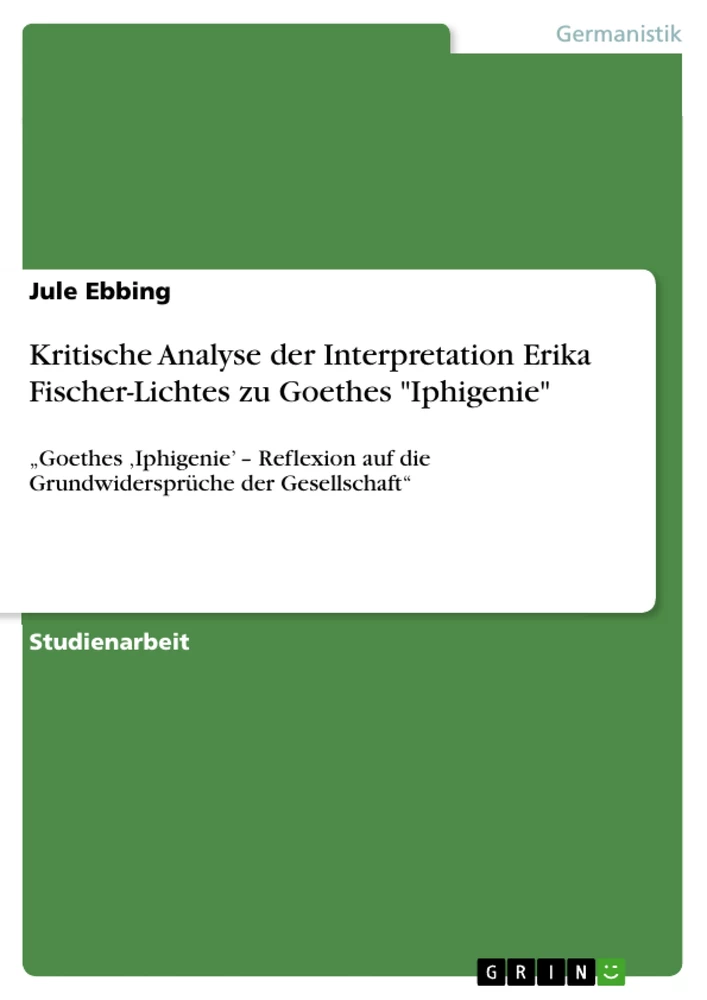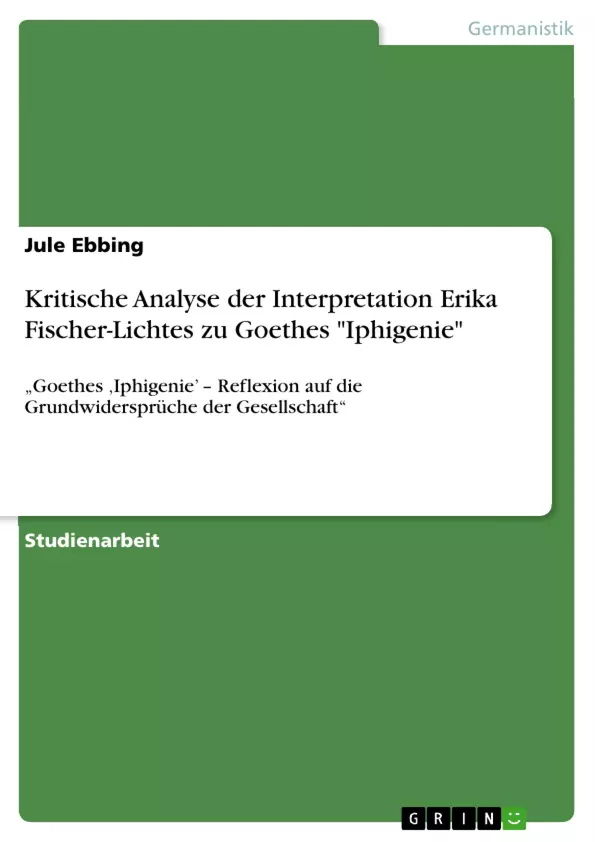Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit Johann Wolfgang Goethes „Iphigenie auf Tauris“ und ihrer Rezeption durch Erika Fischer-Lichte „Goethes ‚Iphigenie’ – Reflexion auf die Grundwidersprüche der Gesellschaft“.
In der Arbeit werden zunächst die theoretischen Hintergründe der Interpretation von Fischer-Lichte beleuchtet und ihre Methoden der Analyse erläutert, um nachfolgend ihre Argumentationsstruktur und die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen näher zu betrachten.
Abschließend erfolgt eine Beurteilung ihrer Interpretation.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Hintergründe und Methoden der Interpretation
- Die Kontroverse Ivo/Lorenz und ihre Rezeption durch Fischer-Lichte
- Methoden der Interpretation
- Argumentationsstruktur
- Personenkonstellationen in der „Iphigenie“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Interpretation von Goethes "Iphigenie auf Tauris" durch Erika Fischer-Lichte und analysiert deren theoretische Hintergründe sowie methodische Vorgehensweise. Ziel ist es, die Argumentationsstruktur von Fischer-Lichte zu verstehen und zu beurteilen.
- Die Kontroverse um den Bildungswert der "Iphigenie" im Deutschunterricht
- Die Kritik an der Interpretation von Ivo und Lorenz
- Die Rolle der Sprechakte in der Dramenanalyse
- Die Analyse von Personenkonstellationen und zwischenmenschlichen Beziehungen
- Die Bedeutung von "fremd" vs. "vertraut" und "übergeordnet" vs. "gleichgeordnet" im Drama
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel beleuchtet die Arbeit die theoretischen Hintergründe von Fischer-Lichtes Interpretation und die von ihr verwendeten Methoden der Analyse. Dabei wird die Kontroverse um die Rezeption der "Iphigenie" durch Ivo und Lorenz im Detail dargestellt, die unterschiedliche Positionen zum Bildungswert des Dramas vertreten. Fischer-Lichte kritisiert Ivos Interpretation als unzureichend, da sie keine umfassende Strukturanalyse beinhaltet. Lorenz hingegen sieht in der "Iphigenie" ein unrealistisches Idealbild ohne Relevanz für soziale Situationen. Fischer-Lichte beanstandet auch dessen vereinfachtes Literaturverständnis.
Im zweiten Kapitel werden die Methoden der Interpretation von Fischer-Lichte vorgestellt. Sie führt eine Strukturanalyse durch, die auf vier Thesen basiert und die Bedeutung der Sprechakte im Drama untersucht. Die Sprechakte werden als performative und propositionale Sätze verstanden, die die Beziehung zwischen Sprecher und Hörer und den Inhalt der Kommunikation aufzeigen. Die Analyse fokussiert auf die unterschiedlichen Personenkonstellationen im Drama und die zwischenmenschlichen Beziehungen, die durch "Oppositionspaare" wie "fremd" vs. "vertraut" und "untergeordnet/übergeordnet" vs. "gleichgeordnet" gekennzeichnet sind.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Argumentationsstruktur von Fischer-Lichte, die sich mit verschiedenen Personenkonstellationen im Drama befasst. Die Beziehungen zwischen den Skythen und zwischen den Griechen werden im Hinblick auf die Sprechakte analysiert. Die Beziehung zwischen Thoas und Arkas repräsentiert das Verhältnis zwischen Herrscher und Volk, während die Beziehung zwischen Orest und Pylades die "ideale Sprechsituation" darstellt. Die Beziehung der Tantaliden untereinander wird durch die "Tat" bestimmt, die zu einer "Pervertierung der zwischenmenschlichen Beziehungen" führt.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beleuchtet die Interpretation von Goethes "Iphigenie auf Tauris" durch Erika Fischer-Lichte, wobei die "Iphigenie" als ein Spiegelbild der Widersprüche in der Gesellschaft betrachtet wird. Die Analyse konzentriert sich auf die theoretischen Hintergründe der Interpretation, die Methoden der Strukturanalyse, die Analyse von Personenkonstellationen und die Rolle der Sprechakte in der Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der Interpretation von Erika Fischer-Lichte zu Goethes Iphigenie?
Fischer-Lichte betrachtet das Drama als Reflexion auf die Grundwidersprüche der Gesellschaft und nutzt dafür eine detaillierte Strukturanalyse.
Welche Rolle spielen "Sprechakte" in dieser Analyse?
Sprechakte werden als performative Sätze untersucht, die die Beziehung zwischen Sprecher und Hörer sowie die soziale Position der Figuren im Drama definieren.
Wie bewertet Fischer-Lichte die Kontroverse um den Bildungswert des Stücks?
Sie kritisiert bestehende Interpretationen (wie die von Ivo und Lorenz) als unzureichend oder zu idealistisch und fordert eine Analyse, die soziale Realitäten miteinbezieht.
Was sind die zentralen Personenkonstellationen laut der Arbeit?
Die Analyse fokussiert auf Oppositionspaare wie "fremd vs. vertraut" und "übergeordnet vs. gleichgeordnet", etwa im Verhältnis zwischen Thoas und Iphigenie.
Was versteht man unter der "idealen Sprechsituation" im Drama?
Dies wird am Beispiel der Beziehung zwischen Orest und Pylades erläutert, die eine Form der Kommunikation repräsentieren, die frei von hierarchischen Zwängen ist.
Warum wird die Beziehung der Tantaliden als "pervertiert" beschrieben?
Aufgrund der "Tat" (dem Fluch der Familie) sind die zwischenmenschlichen Beziehungen der Tantaliden durch Gewalt und Schuld gestört, was sich in ihrer Kommunikation niederschlägt.
- Quote paper
- Jule Ebbing (Author), 2007, Kritische Analyse der Interpretation Erika Fischer-Lichtes zu Goethes "Iphigenie", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192797