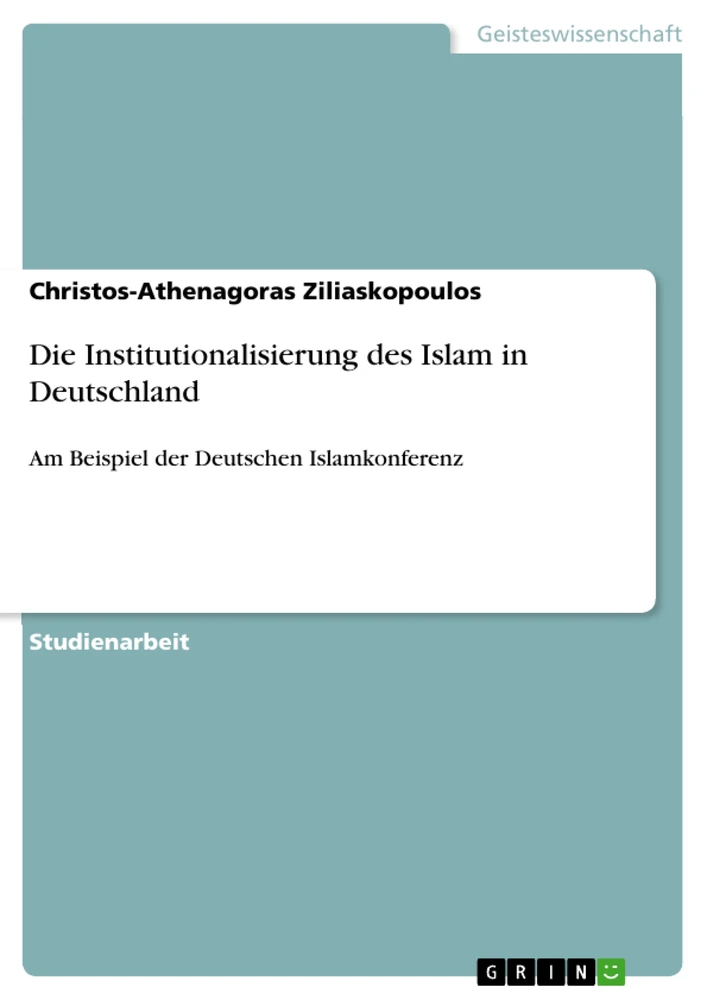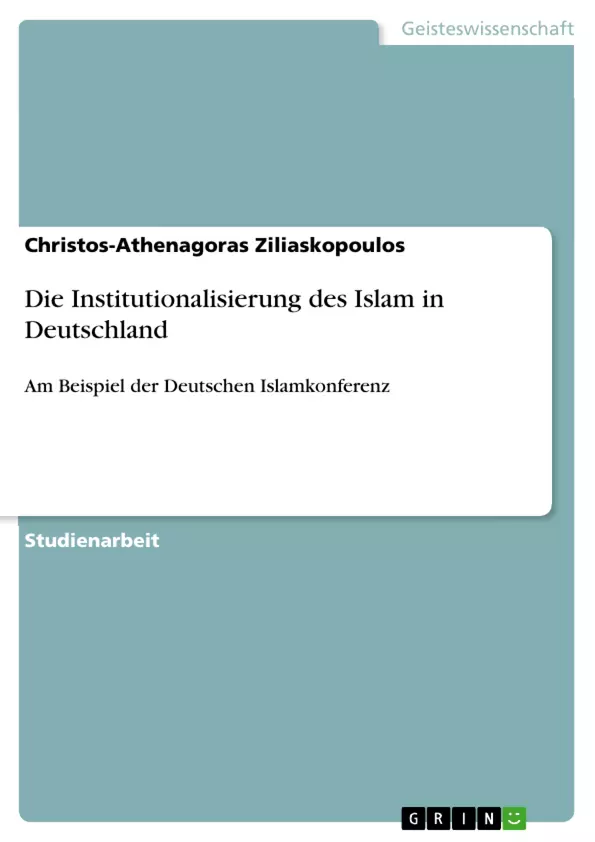Ohne darüber nachgedacht zu haben, ist Deutschland zu einem Einwandererland geworden. Mit den Menschen kam auch eine neue Religion: der Islam. Mit dem Islam sind Diskussionen, Auseinandersetzungen und Diskurse entfachtet worden. Nicht nur innerhalb der islamischen Welt findet ein Kulturkampf statt. Auch in Europa ist die Debatte darüber, was die eigene Kultur ausmacht, in vollem Gange. Am deutlichsten zeigen sich die Frontlinien am Umgang mit den Muslimen: Einem Europa, das sich durch seine christlichen Wurzeln definiert, also durch die Abgrenzung vom Islam, liegt ein anderes Konzept zugrunde als einem Deutschland, dem der Islam zumindest potentiell angehört. Wie immer die Antwort ausfällt, sie hat angesichts der demographischen Entwicklung und der weltpolitischen Lage gravierende Auswirkungen auf die Zukunft. In welchem Europa möchten wir leben? Welches Deutschland gestalten wir heute? Unsere Identität als Deutsche, Europäer, Muslime oder Christen ist vielfältiger und ambivalenter, als uns oft eingeredet wird. In Deutschland leben nominell mehr als drei Millionen Muslime. Viele von ihnen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. In zwanzig bis dreißig Jahren werden in vielen deutschen Städten ein Drittel der Bürger einen muslimischen Hintergrund haben. Bundesinnenminister Schäuble machte mit seiner Regierungserklärung im September 2006 deshalb deutlich: „Der Islam ist Teil Deutschlands und Europas. Der Islam ist Teil unserer Gegenwart und unserer Zukunft “. Die Einberufung der deutschen Islamkonferenz war daher auch eine Aufforderung zur Mitgestaltung dieser Zukunft an die Muslime in Deutschland. Ob der Islam nach Deutschland gehört oder nicht, steht also nicht länger zur Debatte. Die Zukunftsfragen sind vielmehr, wie Muslime ihre Rolle in Staat und Gesellschaft sehen, welchen Beitrag sie zur Entwicklung des demokratischen Gemeinwesens leisten können und welche Voraussetzungen hierfür geschaffen werden müssen.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einführung
- 1. Islam, Europa und Deutschland
- 1.1 Islam und Europa
- 1.2 Der Islam in Deutschland
- 1.2.1 Das Verhältnis von Staat und Religion in Deutschland
- 1.2.2 Staatsrechtliche Assymetrien zwischen Kirchen und Islam
- 1.2.3 Muslime in Deutschland
- 1.2.4 Muslimische Verbände in Deutschland
- 2. Institutionalisierung
- 2.1 Die deutsche Islamkonferenz - DIK
- Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Institutionalisierung des Islam in Deutschland und untersucht dies anhand der Deutschen Islamkonferenz. Das Ziel ist es, die Herausforderungen und Chancen der Integration von Muslimen in die deutsche Gesellschaft zu beleuchten und die Rolle der DIK in diesem Prozess zu analysieren.
- Das Verhältnis von Staat und Religion in Deutschland
- Die Herausforderungen der Integration von Muslimen in die deutsche Gesellschaft
- Die Rolle der Deutschen Islamkonferenz in der Integration von Muslimen
- Der Islam im europäischen Kontext
- Die Bedeutung von Bildung und Dialog für die Integration
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas dar und beleuchtet die wachsende Bedeutung des Islam in Deutschland. Kapitel 1 beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Islam und Europa, sowie mit der spezifischen Situation des Islam in Deutschland. Hierbei werden die staatsrechtlichen Assymetrien zwischen Kirchen und Islam sowie die Rolle muslimischer Verbände im Land untersucht. In Kapitel 2 wird die Deutsche Islamkonferenz vorgestellt und ihr Beitrag zur Institutionalisierung des Islam in Deutschland analysiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind die Institutionalisierung des Islam in Deutschland, die Integration von Muslimen in die deutsche Gesellschaft, die Rolle der Deutschen Islamkonferenz, das Verhältnis von Staat und Religion, Staatsrechtliche Assymetrien zwischen Kirchen und Islam, muslimische Verbände und das Zusammenleben von verschiedenen Kulturen und Religionen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Deutsche Islamkonferenz (DIK)?
Die DIK wurde 2006 einberufen, um den Dialog zwischen dem deutschen Staat und den Muslimen zu fördern und die Institutionalisierung des Islam in Deutschland voranzutreiben.
Welche staatsrechtlichen Probleme gibt es beim Islam in Deutschland?
Es bestehen staatsrechtliche Asymmetrien zwischen den christlichen Kirchen und dem Islam, insbesondere was den Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts betrifft.
Wie viele Muslime leben in Deutschland laut dem Dokument?
Zum Zeitpunkt der Erstellung lebten nominell mehr als drei Millionen Muslime in Deutschland, viele davon mit deutscher Staatsangehörigkeit.
Gehört der Islam zu Deutschland?
Das Dokument zitiert Bundesinnenminister Schäuble (2006), wonach der Islam Teil Deutschlands und Europas sowie Teil der Gegenwart und Zukunft ist.
Welche Rolle spielen muslimische Verbände?
Die Verbände fungieren als Ansprechpartner für den Staat und sind zentral für die Integration und die Gestaltung des demokratischen Gemeinwesens.
- Quote paper
- Christos-Athenagoras Ziliaskopoulos (Author), 2012, Die Institutionalisierung des Islam in Deutschland , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192871