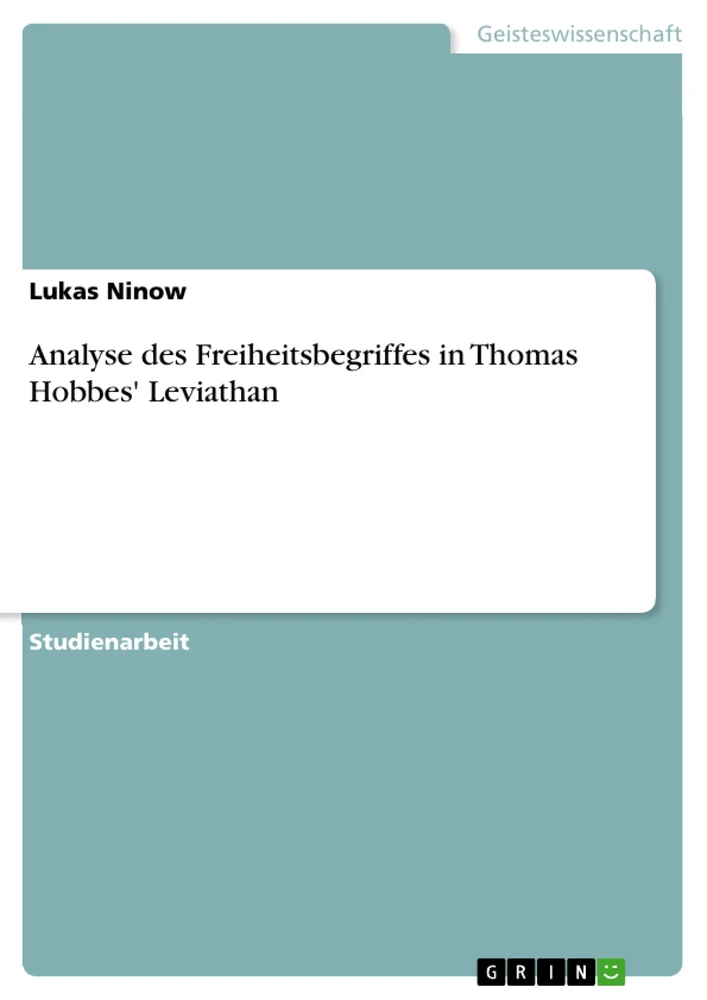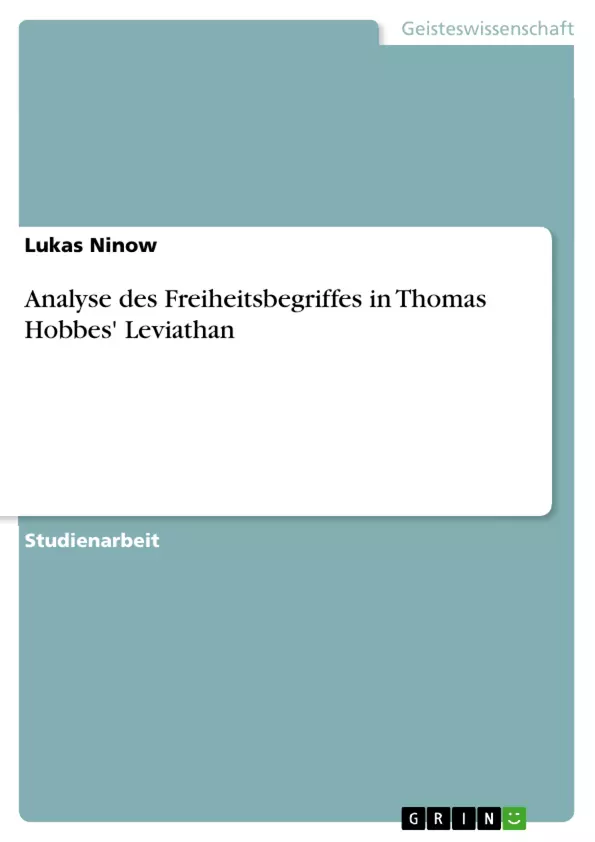Hobbes definiert liberty als "absence of external impediments". Diese Definition ist aber inkonsistent mit seinem Gebrauch des Begriffes, insbesondere im Zusammenhang mit seinen Erläuterungen des second law of nature. Die These dieser Hausarbeit ist, dass es im Leviathan zwei verschiedene Freiheitsbegriffe gibt, dass Hobbes' Theorie aber, wenn man diese beiden zugrunde legt, frei von schwereren Inkonsistenzen ist. Um das zu zeigen, werden beide Freiheitsbegriffe analysiert: Es wird anhand seiner Definitionen geklärt, was unter "corporal liberty" zu verstehen ist und aus allen Textstellen, die damit nicht vereinbar sind, rekonstruiert, was er meint, wenn er dort von liberty spricht. Dafür ist ein längerer Exkurs nötig, in dem analysiert wird, was Hobbes unter obligation versteht und wie sie zustande kommt. Dabei wird auch untersucht, ob es eine obligation gibt, sich an die laws of nature zu halten und weshalb es eine obligation gibt, die civil laws einzuhalten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Corporal liberty
- Liberty as non-obligation
- Obligation
- Gibt es eine obligation, sich an die laws of nature zu halten?
- Es gibt eine obligation, die civil laws zu befolgen
- Fortsetzung: Liberty as non-obligation
- Das Verhältnis der beiden Arten von liberty zueinander
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Thomas Hobbes' Konzept der Freiheit (liberty) im Leviathan und argumentiert, dass es im Leviathan zwei unterschiedliche Freiheitsbegriffe gibt. Die Arbeit untersucht zuerst Hobbes' explizite Definition von liberty, die als corporal liberty bezeichnet wird. Anschließend werden die Konsequenzen dieser Definition und ihre Anwendung in verschiedenen Situationen beleuchtet. Schließlich werden die Unterschiede zwischen corporal liberty und einem zweiten, impliziten Freiheitsbegriff, der als liberty as non-obligation bezeichnet wird, herausgearbeitet.
- Analyse von Hobbes' Definition von corporal liberty
- Untersuchung der Konsequenzen von Hobbes' Definition von corporal liberty
- Einführung des Konzepts von liberty as non-obligation
- Vergleich und Kontrast zwischen corporal liberty und liberty as non-obligation
- Diskussion der Konsistenz von Hobbes' Theorie der Freiheit im Leviathan
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beleuchtet die Besonderheiten von Hobbes' Freiheitsbegriff. Sie stellt die These auf, dass es im Leviathan zwei unterschiedliche Freiheitsbegriffe gibt. Das zweite Kapitel untersucht die Definition von corporal liberty, die Hobbes im Leviathan liefert. Es werden die beiden Definitionen von liberty analysiert und die Implikationen für den Begriff der power diskutiert. Außerdem wird die Rolle des Willens und der Angst für die Definition von corporal liberty beleuchtet.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Konzept der obligation und seinen Auswirkungen auf den Freiheitsbegriff. Es werden die beiden Arten von obligation, die sich auf die laws of nature und die civil laws beziehen, untersucht und ihre Bedeutung für die Freiheit des Einzelnen erörtert.
Das vierte Kapitel setzt sich mit dem Verhältnis zwischen den beiden Arten von liberty auseinander. Es wird die These vertreten, dass Hobbes' Theorie der Freiheit inkonsistent ist, wenn man nur corporal liberty berücksichtigt. Der Autor argumentiert, dass es einen zweiten Freiheitsbegriff, liberty as non-obligation, gibt, der das Konzept der Freiheit in Hobbes' Werk besser erklärt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Thomas Hobbes' Konzept der Freiheit im Leviathan. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: corporal liberty, liberty as non-obligation, obligation, laws of nature, civil laws, fear, power, will, deliberation, freedom, voluntary action.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Thomas Hobbes Freiheit im "Leviathan"?
Hobbes definiert Freiheit primär als "Abwesenheit äußerer Hindernisse" (corporal liberty).
Gibt es bei Hobbes zwei verschiedene Freiheitsbegriffe?
Ja, die Arbeit argumentiert, dass neben der "corporal liberty" auch ein Begriff der "liberty as non-obligation" (Freiheit als Abwesenheit von Verpflichtung) existiert.
Was ist "corporal liberty"?
Es beschreibt die physische Freiheit, sich ohne äußere Blockaden zu bewegen, was laut Hobbes auch bei Handlungen aus Angst (z.B. Überbordwerfen von Fracht) gegeben ist.
Besteht eine Verpflichtung, die Staatsgesetze (civil laws) einzuhalten?
Ja, durch den Gesellschaftsvertrag entsteht eine "obligation", die bürgerlichen Gesetze zu befolgen, was die ursprüngliche Freiheit des Naturzustands einschränkt.
Sind Furcht und Freiheit bei Hobbes vereinbar?
Ja, für Hobbes sind Handlungen, die aus Furcht begangen werden, dennoch freiwillige Handlungen und somit Ausdruck von Freiheit.
- Quote paper
- Lukas Ninow (Author), 2012, Analyse des Freiheitsbegriffes in Thomas Hobbes' Leviathan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192967