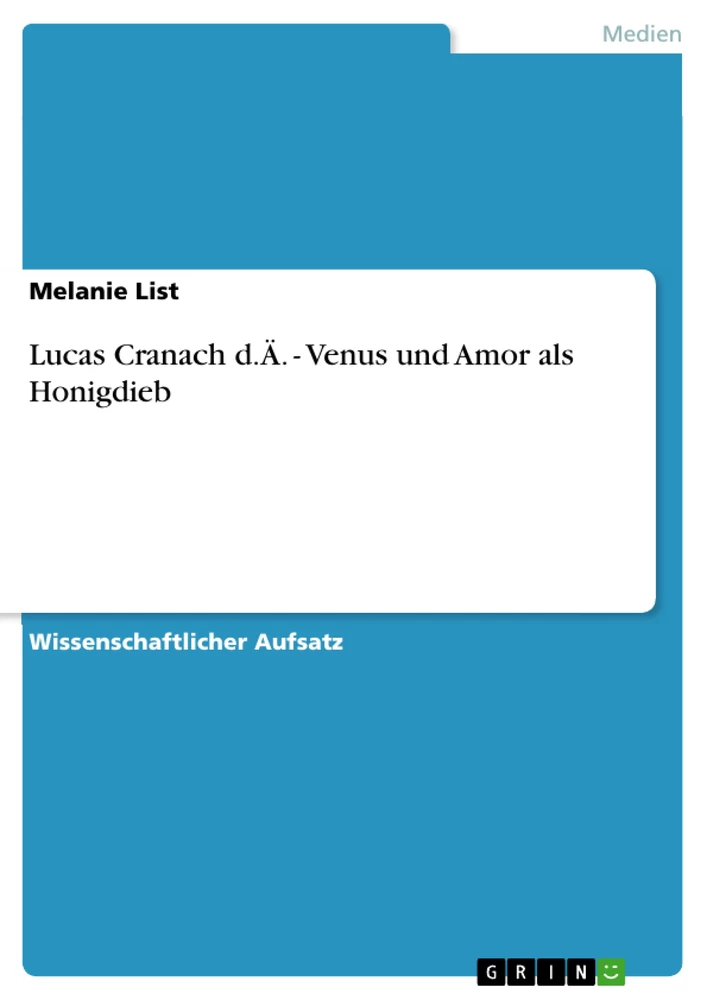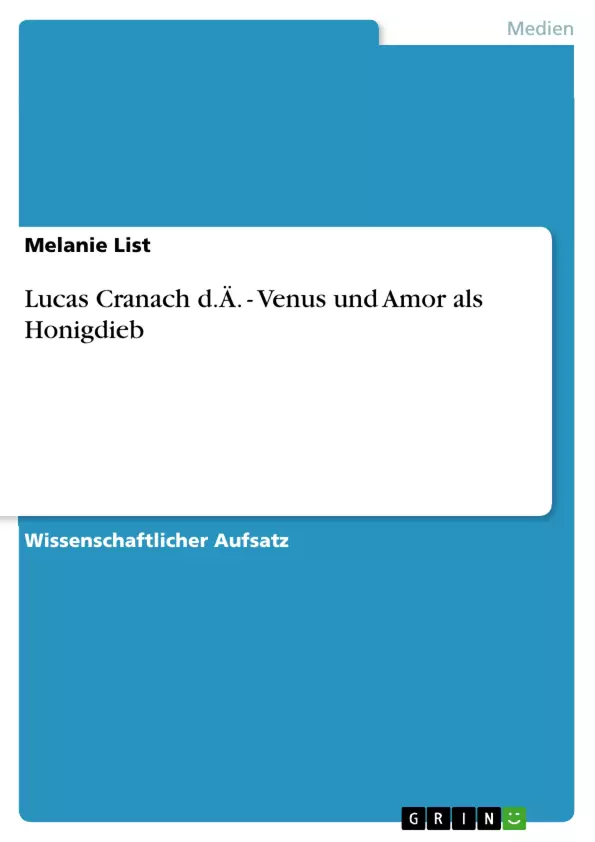Die literarische Vorlage für das Motiv, das Cranach in großer Anzahl variierte, 1 liefert
Theokrit. In seinen Idyllen berichtet der Dichter, wie Amor den Honig der Bienen stielt, die
ihn daraufhin stechen. Seinen Schmerz darüber klagt er seiner Mutter Venus, der Göttin der
Schönheit und Liebe. Venus antwortet ihrem klagenden Sohn: „Du bist den Bienen gleich, da
du so klein bist und doch so große Schmerzen verursachst.“ Venus offenbart ihrem Sohn, dass
die Wunden seiner Pfeile schmerzhafter seien als die Stiche der Bienen. Theokrit legt damit
den Schwerpunkt seiner Erzählung auf die Betonung der Macht Amors und gibt dem Leser
keine moralische Lehre. Cranachs künstlerische Rezeption des Mythos setzt einen anderen
Akzent. Alle Varianten des Themas sind mit einer moralisierenden Inschrift versehen, die den
Betrachter vor der Wollust der Venus und ihren verderblichen Konsequenzen warnt. 1 Über die eigentliche Anzahl der Versionen gibt es in der Literatur unterschiedliche Angaben. Bekannt sind heute mehr als 20 verschiedenen Versionen, von denen die frühesten auf das Jahr 1527 datiert sind. J. Friedländer zählt 27, E. de Jongh geht von mindestens 22 Versionen aus.
Inhaltsverzeichnis
- Die literarische Vorlage für das Motiv, das Cranach in großer Anzahl variierte, liefert Theokrit.
- Das hochformatige Gemälde zeigt lebensgroß die nackte Gestalt der Venus mit ihrem Sohn Amor vor monochromen schwarzen Hintergrund.
- Den Sinngehalt der Darstellung klärt die Inschrift am oberen Bildrand, die visuell dominierend in heller Farbigkeit vom dunklen Grund abgesetzt ist.
- Der Dualismus des Gemäldes besteht darin, dass es einerseits als Allegorie mit moralischem Anspruch und einer deutlichen Warnung an den Betrachter auftritt, andererseits die Sinne anspricht und ganz offensichtlich das Erotische und Sinnliche vorführt.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Gemälde „Venus und Amor als Honigdieb“ von Lucas Cranach dem Älteren und beleuchtet den Zusammenhang zwischen dem literarischen Ursprung in den Idyllen des Theokrit und Cranachs künstlerischer Interpretation. Dabei steht die Frage im Vordergrund, wie Cranach den Mythos des Honigdiebstahls in eine moralisierende Allegorie verwandelt.
- Die Rezeption der Idyllen des Theokrit durch Cranach
- Die künstlerische Gestaltung der Venusfigur und ihre Beziehung zum Schönheitsideal der Renaissance
- Die Bedeutung der Inschrift und ihre Rolle als moralischer Kommentar
- Der Dualismus des Gemäldes zwischen sinnlicher Darstellung und moralischer Warnung
- Die Verbindung zwischen Kunst und Moral im 16. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel behandelt die literarische Vorlage des Gemäldes und die Rezeption der Idyllen des Theokrit durch Cranach. Es zeigt auf, wie Theokrit die Macht des Amors und seinen Schmerz über den Bienenstich betont, während Cranach seinen Fokus auf die moralische Warnung vor der Wollust und ihren Folgen legt.
- Im zweiten Kapitel wird die künstlerische Gestaltung des Gemäldes analysiert. Die lebensgroße Darstellung der Venus und Amors vor monochromen Hintergrund sowie die typischen Merkmale von Cranachs Frauenfiguren wie gelängte Gestalten, ausschwingende Hüften und stilisierte Gesichter werden untersucht. Die Bedeutung der Inschrift, die den Betrachter vor der Wollust warnt, wird erörtert.
- Das dritte Kapitel beleuchtet den Dualismus des Gemäldes. Es wird gezeigt, wie Cranach die sinnliche Darstellung der Venus und die moralisierende Inschrift miteinander verbindet und so einen spannungsgeladenen Konflikt zwischen Körperlichkeit und Moral erzeugt. Der Blick der Venus, der den Betrachter direkt anspricht, wird in diesem Zusammenhang als entscheidendes Element interpretiert.
Schlüsselwörter
Lucas Cranach, Venus und Amor als Honigdieb, Theokrit, Idyllen, Moral, Kunst, Renaissance, Schönheitsideal, Allegorie, Inschrift, Dualismus, sinnliche Darstellung, moralischer Kommentar, Körperlichkeit, Liebe, Lust, Schmerz.
- Arbeit zitieren
- Magistra Artium Melanie List (Autor:in), 2006, Lucas Cranach d.Ä. - Venus und Amor als Honigdieb, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193061