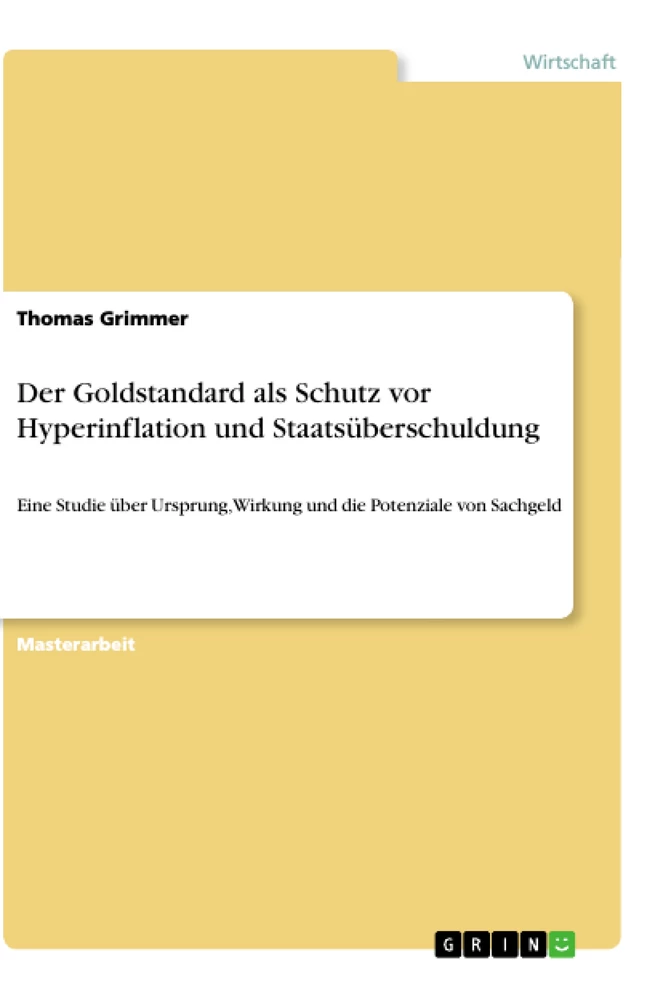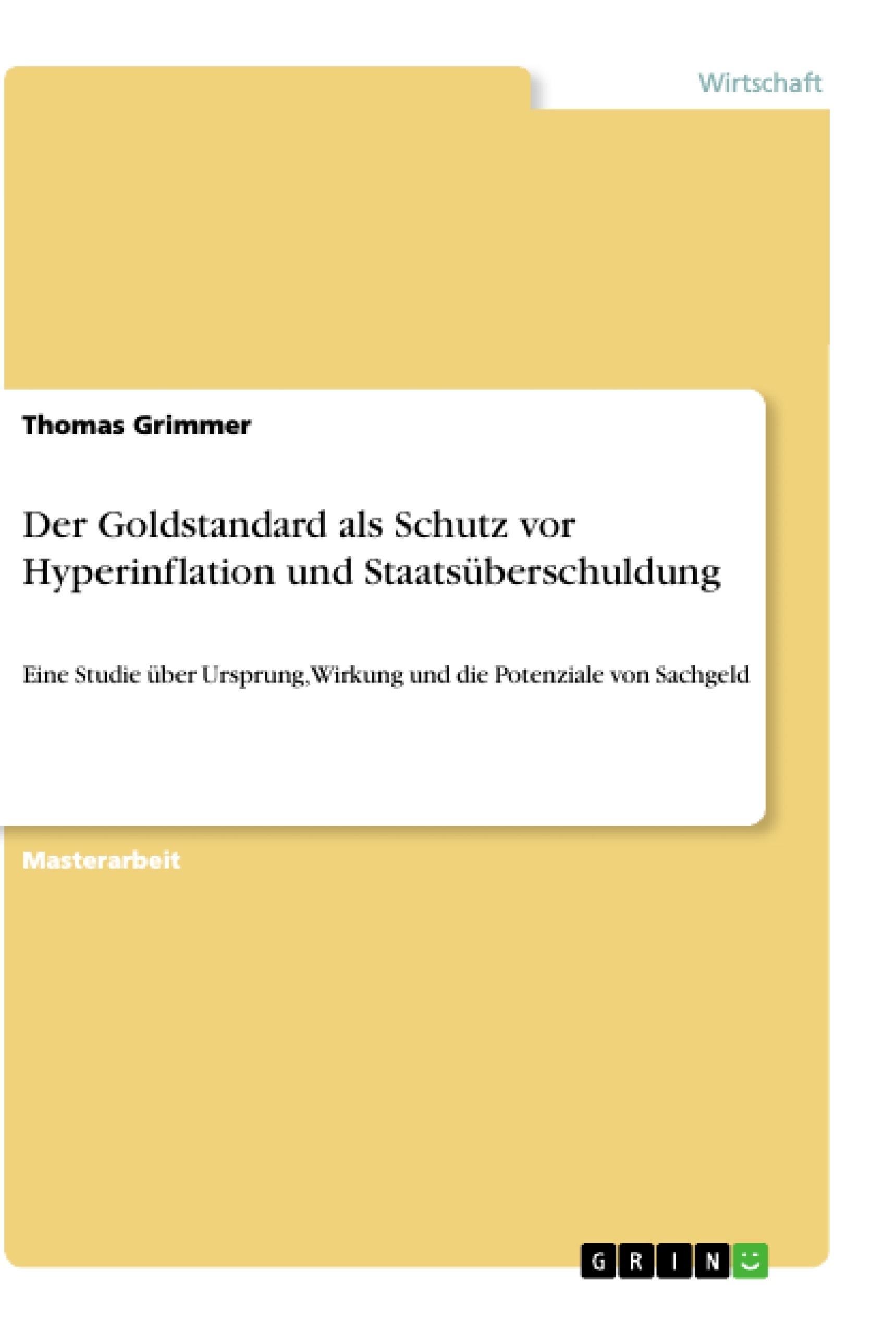In die Krise geratene Gesellschaftsformen weisen offenbar eine Gemeinsamkeit auf: den chronischen Geldmangel ihrer Regierungen, hervorgerufen durch staatliche Sozial- und Umverteilungsausgaben im weiteren Sinne. Nach den Prinzipien von J.M. Keynes entstehen aufgrund von Nachfragegenerierung durch den Staat zusätzliche Staatsschulden, wobei deren wachsende Finanzierungskosten die Basis für weitere Neuverschuldung bilden. Zentralbanken bemühen sich vergeblich um Konjunkturglättung; Regierungen sind in der Zwickmühle: Nach rasanten Aufschwüngen können sie sich keine rezessiven Abschwünge leisten, weil die Finanzierungskosten ein Mindestniveau an Steuereinnahmen erfordern und steigende Arbeitslosigkeit zu Defiziten führen würde. Eine anscheinend unumkehrbare Spirale des Wachstumszwangs wird in Gang gesetzt. Das hierzu gegensätzliche Denkmodell der Österreichischen Schule der Nationalökonomie betrachtet staatliche Interventionen als schädigenden Eingriff in den Markt und macht das bestehende System der Geldschöpfung aus dem Nichts für das folgenschwere Auf und Ab von Konjunkturzyklen verantwortlich. Die Studie befasst sich zunächst mit der Frage, woraus Geld entstanden ist und wohin es inzwischen entwickelt wurde. Danach werden die (notwendigen) Zusammenhänge zwischen Zins, Sparen, Konsum und Investitionen beleuchtet, und es wird untersucht, warum das System der heutigen Geldschöpfung Wirtschaftskrisen und Inflation hervorruft. Darauf aufbauend wird dargelegt, warum der Goldstandard mit seinen einzelnen Funktionen in der Vergangenheit das Geldsystem und die Volkswirtschaften stabilisierte. Gleichfalls werden die kritischen Punkte zum Goldstandard beleuchtet und auf ihren Gehalt untersucht. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen erfolgt eine Betrachtung und Einschätzung zu den Alternativen des Goldstandards und zum bestehenden Geldsystem.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entstehung, Bedeutung und Formen des Geldes
- 2.1. Entstehung und Tauschfunktion
- 2.2. Kaufkraft des Geldes und das Regressionstheorem
- 2.3. Formen des Geldes
- 3. Geldproduktion und wirtschaftliche Effekte im Fiat-Geldsystem
- 3.1. Übergang vom Markt- bzw. Sachgeld zum staatlichen Angebotsmonopol
- 3.2. Das heutige Fiat-Geldsystem
- 3.3. Auswirkungen der Fiat-Geldschöpfung durch Kreditvergabe
- 3.3.1. Zeitpräferenz, Sparen, Konsum und (Fehl-)Investitionen
- 3.3.2. Steigende (Staats-)Verschuldung
- 3.3.3. (Hyper)-Inflation
- 4. Analyse der Stabilisierungs- und allgemeinen Funktionsfähigkeit des Goldstandards
- 4.1. Die ökonomischen und ethischen Grundlagen von „gutem Geld“
- 4.2. Wesen, Phasen und Spielregeln des Goldstandards
- 4.3. Automatische Zahlungsbilanzausgleichsfunktion
- 4.4. Funktion der Wechselkursstabilisierung
- 4.5. Funktion der Preisstabilisierung
- 4.6. Makroökonomische Stabilisierungsfunktion
- 4.7. Widerlegung der Argumente gegen eine goldgedeckte Währung
- 5. Alternativen zum Goldstandard
- 5.1. Währungswettbewerb (à la Hayek)
- 5.2. Weltwährung / Sonderziehungsrechte des IWF
- 5.3. Schwundgeld, Regionalwährungen und Tauschringe
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Master-Thesis befasst sich mit dem Goldstandard und dessen Rolle als Stabilitätsgarant für Makroökonomie und Geldsysteme. Die Arbeit analysiert die Entstehung und die verschiedenen Formen des Geldes, untersucht die Funktionsweise des Fiat-Geldsystems und dessen wirtschaftliche Auswirkungen, und beleuchtet die Vorteile und Nachteile des Goldstandards. Außerdem werden Alternativen zum Goldstandard präsentiert und diskutiert.
- Entstehung und Entwicklung des Geldes
- Das Fiat-Geldsystem und seine Folgen
- Der Goldstandard: Geschichte, Funktionsweise und Stabilität
- Argumente für und gegen den Goldstandard
- Alternative Währungssysteme
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Entstehung, Bedeutung und Formen des Geldes
- Kapitel 3: Geldproduktion und wirtschaftliche Effekte im Fiat-Geldsystem
- Kapitel 4: Analyse der Stabilisierungs- und allgemeinen Funktionsfähigkeit des Goldstandards
- Kapitel 5: Alternativen zum Goldstandard
Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Geldes von seinen Anfängen als Tauschmittel bis zu den verschiedenen Formen, die es heute annimmt.
Dieses Kapitel untersucht, wie das heutige Fiat-Geldsystem funktioniert und welche Folgen die Geldproduktion durch Kreditvergabe hat. Dabei werden Themen wie Zeitpräferenz, Sparen, Konsum und Inflation behandelt.
In diesem Kapitel werden die ökonomischen und ethischen Grundlagen von „gutem Geld“ erläutert, und die Funktionsweise des Goldstandards sowie seine Stabilisierungseffekte werden analysiert.
Dieses Kapitel präsentiert und diskutiert verschiedene Alternativen zum Goldstandard, wie z.B. Währungswettbewerb, Weltwährung und Regionalwährungen.
Schlüsselwörter
Goldstandard, Fiat-Geldsystem, Geldproduktion, Inflation, Zeitpräferenz, Sparen, Konsum, Investition, Stabilität, Wechselkurs, Preisstabilität, Währungswettbewerb, Weltwährung, Regionalwährungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann ein Goldstandard vor Hyperinflation schützen?
Da Gold eine begrenzte natürliche Ressource ist, verhindert eine Golddeckung die willkürliche Vermehrung der Geldmenge („Geldschöpfung aus dem Nichts“) durch Staaten.
Was ist der Hauptunterschied zwischen Fiat-Geld und Sachgeld?
Sachgeld (wie Gold) besitzt einen inneren Wert, während Fiat-Geld keinen eigenen Wert hat und nur durch staatliche Verordnung und Vertrauen als Zahlungsmittel fungiert.
Welche stabilisierenden Funktionen hat der Goldstandard?
Er sorgt für automatischen Zahlungsbilanzausgleich, stabile Wechselkurse und langfristige Preisstabilität innerhalb einer Volkswirtschaft.
Warum führt das heutige Fiat-Geldsystem laut der Arbeit zu Krisen?
Künstlich niedrige Zinsen und übermäßige Kreditvergabe führen zu Fehlinvestitionen und einer unumkehrbaren Spirale aus Staatsverschuldung und Wachstumszwang.
Welche Alternativen zum Goldstandard werden diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet Modelle wie den Währungswettbewerb (nach Hayek), Weltwährungen (Sonderziehungsrechte) oder Regionalwährungen.
- Quote paper
- Thomas Grimmer (Author), 2012, Der Goldstandard als Schutz vor Hyperinflation und Staatsüberschuldung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193143