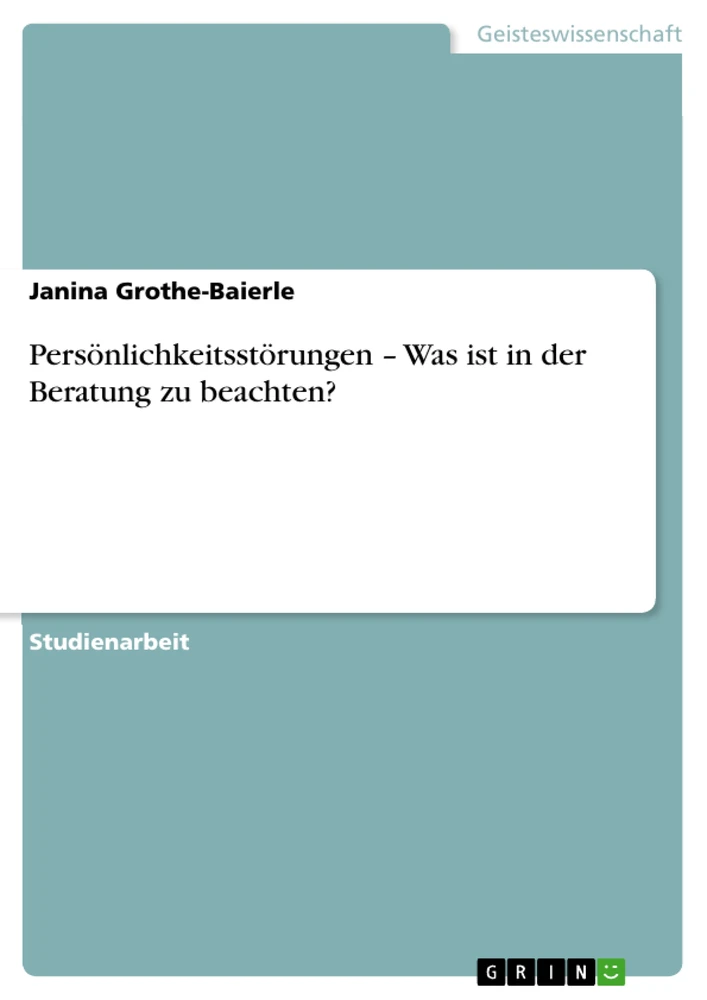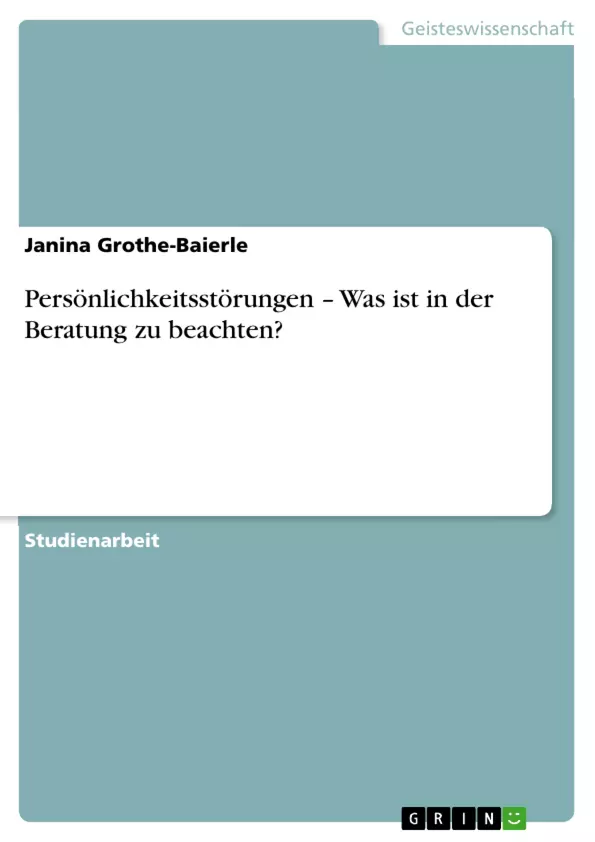In der beraterischen Praxis - wie auch im Leben - treffen wir auf verschiedene Menschen, die sich jeweils durch ihre „ganz eigene und unverwechselbare Art und Weise zu denken, zu fühlen,
wahrzunehmen und auf die Außenwelt zu reagieren“ auszeichnen. Die einzigartige Konstellationen von Emotionen, Gedanken und Reaktionen des Individuums bezeichnet man als Persönlichkeit. Eine gesunde Persönlichkeit hilft dem Individuum sich in der Gesellschaft zurechtzufinden und dabei gestalterisch und selbstbestimmt auf neue Anforderungen zu reagieren. Unter bestimmten psychosozialen und genetischen Bedingungen können Persönlichkeitszüge jedoch starr und unflexibel werden und so zu subjektivem Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Lebensbereichen des Betroffenen führen. Es entstehen Persönlichkeitsstörungen.
Die folgende Ausarbeitung soll zunächst einen Überblick zu grundsätzlichen Kriterien zur Bestimmung und Diagnose von Persönlichkeitsstörungen geben, um dann auf die verschiedenen
Merkmale einzelner Persönlichkeitsstörungen genauer einzugehen.Verschiedene Modelle zur Beschreibung und Erfassung von Persönlichkeitsstörungen werden ebenso vorgestellt wie Erkenntnisse zu psychosozialen und biologischen Hintergründen sowie zur Komorbidität und Mortalität von Persönlichkeitsstörungen. Im Anschluss werden Grenzen und Möglichkeiten der Beratung von Klienten mit Persönlichkeitsstörungen dargestellt und es wird gezeigt, welche
Faktoren eine Rolle spielen damit Beratung - insbesondere mit dieser Zielgruppe - gelingen kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Allgemeine Kriterien von Persönlichkeitsstörungen
- 3. Modelle zur Erfassung von Persönlichkeitsstörungen
- 3.1 Klinische Erscheinungsbilder der spezifischen Persönlichkeitsstörungen nach der Klassifikation des DSM-IV
- 3.1.1 Persönlichkeitsstörungen des Clusters A
- 3.1.2 Persönlichkeitsstörungen des Clusters B
- 3.1.3 Persönlichkeitsstörungen des Clusters C
- 3.2 Dimensionale Ansätze in der Persönlichkeitsforschung
- 3.1 Klinische Erscheinungsbilder der spezifischen Persönlichkeitsstörungen nach der Klassifikation des DSM-IV
- 4. Komorbidität/ "Gleichzeitigkeitsdiagnosen"
- 5. Mortalität
- 6. Ätiologie von Persönlichkeitsstörungen
- 6.1 Biologische Störungsmodelle
- 6.2 Psychosoziale Faktoren
- 6.3 Das Vulnerabilität-Stress-Modell
- 7. Bedeutung von Persönlichkeitsstörungen für die Beratung
- 7.1 Argumente für eine psychotherapeutische Behandlung
- 7.2 Möglichkeiten der Beratung
- 7.3 Wirkfaktoren gelingender Beratung in Verbindung mit Persönlichkeitsstörungen
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung bietet einen Überblick über Persönlichkeitsstörungen, ihre Diagnose und Beratung. Ziel ist es, grundlegende Kriterien zur Bestimmung und Diagnose zu erläutern und die Merkmale einzelner Störungen zu beschreiben. Verschiedene Erklärungsmodelle, Komorbidität, Mortalität und die Bedeutung für die Beratung werden behandelt.
- Kriterien und Diagnose von Persönlichkeitsstörungen
- Klinische Erscheinungsbilder verschiedener Persönlichkeitsstörungen (DSM-IV Cluster-Modell)
- Biologische und psychosoziale Faktoren in der Ätiologie
- Komorbidität und Mortalität
- Beratung von Klienten mit Persönlichkeitsstörungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Persönlichkeitsstörungen ein und beschreibt die Bedeutung der individuellen Persönlichkeit für das soziale Leben. Sie hebt die Unterschiede zwischen gesunder Persönlichkeit und Persönlichkeitsstörungen hervor und benennt die Herausforderungen im Umgang mit Persönlichkeitsstörungen in der Beratung. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Ziele des folgenden Textes, der sich mit der Diagnose, den Ursachen und den Möglichkeiten der Beratung im Kontext von Persönlichkeitsstörungen auseinandersetzen wird.
2. Allgemeine Kriterien von Persönlichkeitsstörungen: Dieses Kapitel definiert Persönlichkeitsstörungen gemäß ICD-10, indem es auf die deutliche Abweichung von kulturellen Normen in mindestens zwei Bereichen (Kognition, Affektivität, Impulskontrolle und zwischenmenschliche Beziehungen) hinweist. Es betont die Unflexibilität und Unangepasstheit der Persönlichkeitszüge, die zu sozialen und persönlichen Beeinträchtigungen führen. Der Unterschied zwischen Persönlichkeitszügen und Symptomen wird erläutert, wobei die Ich-Syntonie von Persönlichkeitszügen hervorgehoben wird, im Gegensatz zur Ich-Dystonie von Symptomen. Schließlich werden wichtige diagnostische Ausschlusskriterien besprochen, wie das Ausscheiden anderer psychischer Störungen oder organischer Erkrankungen als Ursache.
3. Modelle zur Erfassung von Persönlichkeitsstörungen: Dieses Kapitel beschreibt die kategorialen Diagnosesysteme ICD-10 und DSM-IV, die in der klinischen Praxis Anwendung finden. Es fokussiert auf das Cluster-Modell des DSM-IV zur Darstellung spezifischer Persönlichkeitsstörungen und erläutert, dass diese Cluster-Einteilung primär deskriptiv ist und nicht umfassend empirisch validiert wurde. Die Notwendigkeit dimensionaler Modelle als Ergänzung oder Ersatz zu den kategorialen Ansätzen wird hervorgehoben, um die Limitationen der rein kategorialen Klassifikation zu überwinden.
6. Ätiologie von Persönlichkeitsstörungen: Dieses Kapitel erörtert die Ursachen von Persönlichkeitsstörungen, indem es biologische Störungsmodelle und psychosoziale Faktoren diskutiert. Die Komplexität der Ätiologie wird betont, wobei sowohl genetische Prädispositionen als auch umweltbedingte Einflüsse eine Rolle spielen. Es werden wahrscheinlich die verschiedenen Modelle im Detail erklärt, und möglicherweise das Vulnerabilitäts-Stress-Modell als integratives Modell präsentiert. Die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Faktoren werden detailliert analysiert und diskutiert.
7. Bedeutung von Persönlichkeitsstörungen für die Beratung: Dieses Kapitel widmet sich der Beratung von Klienten mit Persönlichkeitsstörungen. Es beleuchtet die Argumente für eine psychotherapeutische Behandlung und stellt verschiedene Beratungsansätze vor. Ein Schwerpunkt liegt auf den Wirkfaktoren, die den Erfolg von Beratungsmaßnahmen beeinflussen. Die spezifischen Herausforderungen bei der Arbeit mit dieser Klientengruppe und die Notwendigkeit angepasster Methoden werden detailliert dargestellt.
Schlüsselwörter
Persönlichkeitsstörungen, ICD-10, DSM-IV, Cluster-Modell, Dimensionale Ansätze, Ätiologie, Biologische Faktoren, Psychosoziale Faktoren, Komorbidität, Mortalität, Beratung, Psychotherapie, Wirkfaktoren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Persönlichkeitsstörungen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über Persönlichkeitsstörungen. Sie beinhaltet eine Einleitung, ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Die Arbeit behandelt die Kriterien und Diagnose von Persönlichkeitsstörungen, klinische Erscheinungsbilder (basierend auf dem DSM-IV Cluster-Modell), biologische und psychosoziale Faktoren in der Ätiologie, Komorbidität und Mortalität sowie die Beratung von Klienten mit Persönlichkeitsstörungen.
Welche Klassifikationssysteme werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die kategorialen Diagnosesysteme ICD-10 und DSM-IV, wobei der Fokus auf dem Cluster-Modell des DSM-IV liegt. Die Limitationen der rein kategorialen Klassifikation werden angesprochen und die Notwendigkeit dimensionaler Modelle als Ergänzung hervorgehoben.
Welche Aspekte der Ätiologie von Persönlichkeitsstörungen werden beleuchtet?
Die Arbeit diskutiert sowohl biologische Störungsmodelle (genetische Prädispositionen) als auch psychosoziale Faktoren (Umwelteinflüsse) in der Ätiologie von Persönlichkeitsstörungen. Die Komplexität der Ätiologie und das Zusammenspiel verschiedener Faktoren werden betont. Möglicherweise wird das Vulnerabilitäts-Stress-Modell als integratives Modell vorgestellt.
Wie wird das Thema Beratung im Kontext von Persönlichkeitsstörungen behandelt?
Die Arbeit widmet sich der Beratung von Klienten mit Persönlichkeitsstörungen. Sie beleuchtet Argumente für eine psychotherapeutische Behandlung, stellt verschiedene Beratungsansätze vor und konzentriert sich auf die Wirkfaktoren, die den Erfolg von Beratungsmaßnahmen beeinflussen. Die spezifischen Herausforderungen bei der Arbeit mit dieser Klientengruppe und der Bedarf an angepassten Methoden werden detailliert dargestellt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die folgenden Kapitel: Einleitung, Allgemeine Kriterien von Persönlichkeitsstörungen, Modelle zur Erfassung von Persönlichkeitsstörungen (inkl. detaillierter Betrachtung der DSM-IV Cluster und dimensionale Ansätze), Komorbidität/Gleichzeitigkeitsdiagnosen, Mortalität, Ätiologie von Persönlichkeitsstörungen (biologische und psychosoziale Faktoren, Vulnerabilität-Stress-Modell), Bedeutung von Persönlichkeitsstörungen für die Beratung (Argumente für Therapie, Beratungsansätze, Wirkfaktoren) und Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Persönlichkeitsstörungen, ICD-10, DSM-IV, Cluster-Modell, Dimensionale Ansätze, Ätiologie, Biologische Faktoren, Psychosoziale Faktoren, Komorbidität, Mortalität, Beratung, Psychotherapie, Wirkfaktoren.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, einen Überblick über Persönlichkeitsstörungen, ihre Diagnose und Beratung zu geben. Sie erläutert grundlegende Kriterien zur Bestimmung und Diagnose und beschreibt die Merkmale einzelner Störungen. Verschiedene Erklärungsmodelle, Komorbidität, Mortalität und die Bedeutung für die Beratung werden behandelt.
- Quote paper
- Janina Grothe-Baierle (Author), 2012, Persönlichkeitsstörungen – Was ist in der Beratung zu beachten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193159