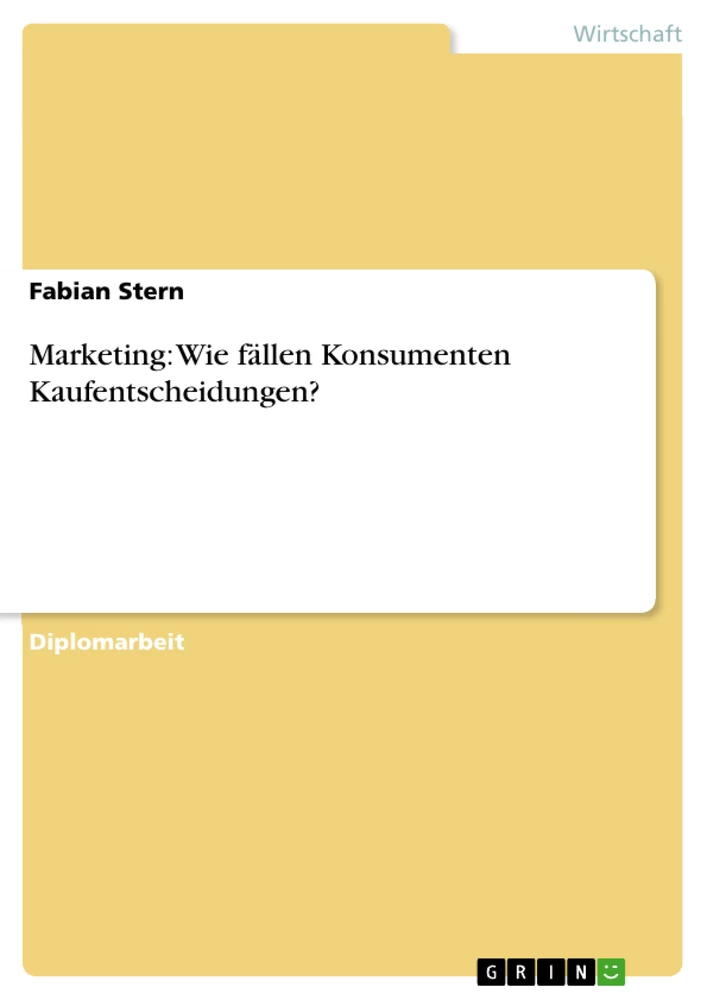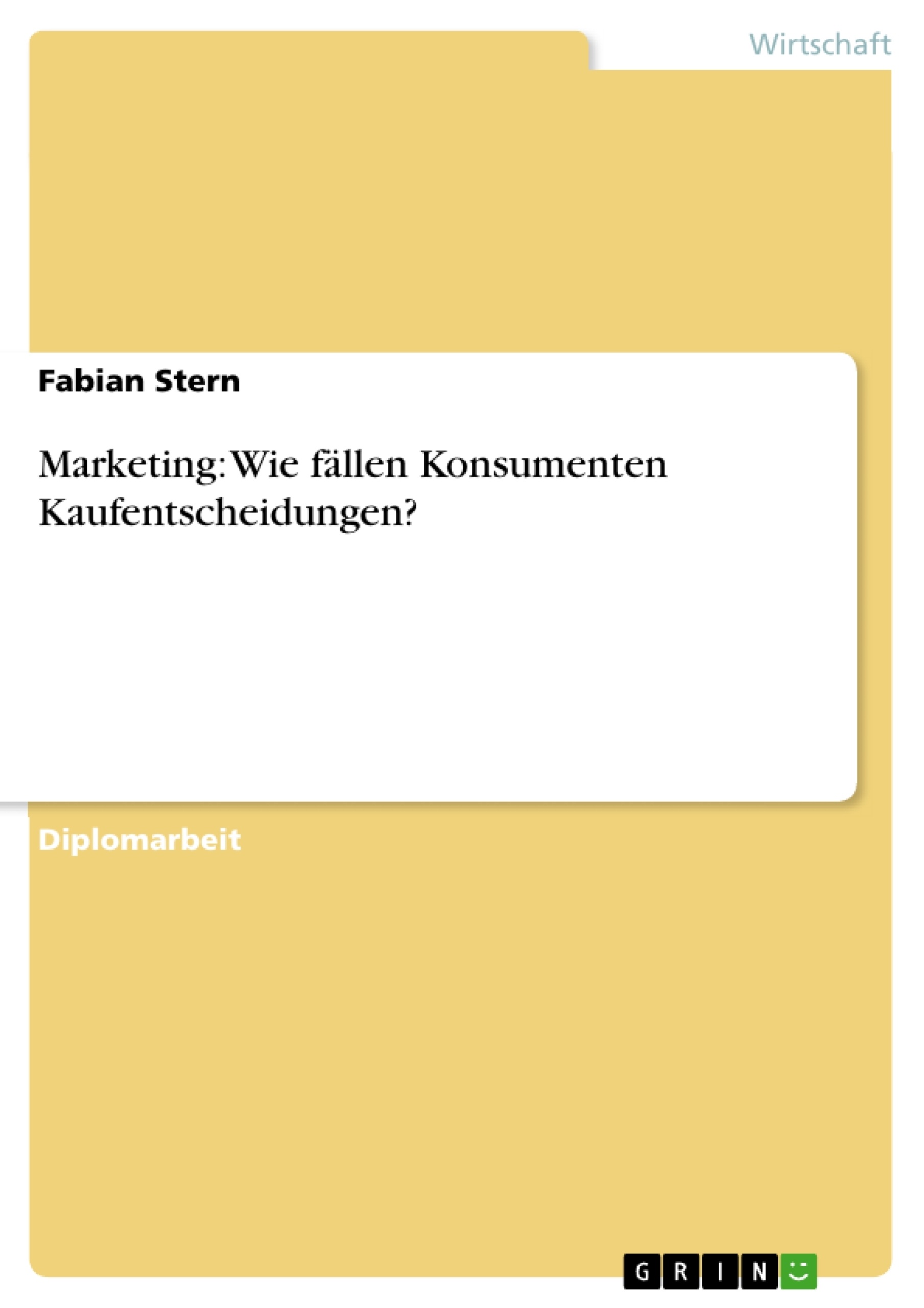1. Problemstellung
Konsumenten sehen sich heute einer immer größer werdenden Auswahl an Kaufmöglichkeiten gegenübergestellt. So stieg laut einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (Gfk) aus dem Jahr 2007 das Angebot bedarfsoptimierter Produkte
im deutschen Food Bereich seit 2003 um 33% an1. Diese Erkenntnis wird in weiteren
Studien auch für andere Länder und Industrien bestätigt2.
Einhergehend mit der Angebotsvielfalt ist eine erhöhte Komplexität der
Kaufentscheidung. Diese lässt es immer schwieriger werden, die Vorgänge
nachzuvollziehen, die sich beim Kauf eines Produktes im Kopf des Konsumenten
abspielen. Die seit Mitte des 20. Jahrhunderts stattfindende Erforschung des Gebiets der
Kaufentscheidungstheorie von Privatpersonen soll nun in dieser Arbeit vorgestellt
werden. Der Fokus wird in diesem Zusammenhang auf den betriebswirtschaftlichen, für
das Marketing relevanten Zweig der Theorie gelegt.
Ziel ist dabei, zum Einen einen Überblick der vorhandenen Theorien zu geben, welche
sich mit der Beschreibung der Vorgänge in der sogenannten black box des
Konsumenten befassen. Zum Anderen geht es um die Beantwortung einer für die
Betriebswirtschaft und insbesondere für das Marketing zentralen Fragestellung: Wie
fällen Konsumenten Kaufentscheidungen?
Die Relevanz der formulierten Problemstellung ergibt sich für die Betriebswirtschaft
aus zweierlei Hinsicht. Erstens erhöht eine Antwort die Planungssicherheit eines
Unternehmens. Budgets lassen sich einfacher kalkulieren und allokieren, wenn eine
fundierte Berechnung des Return on Investment der Marketingausgaben vorliegt.
Begünstigt wird diese Berechnung in diesem Fall dadurch, dass eine genauere
Vorhersage getroffen werden kann, welches Produkt oder welche Marke in einem
gegebenen Umfeld gekauft wird.3 Zweitens ergibt sich durch das Verständnis über den
Vorgang der Kaufentscheidung die Möglichkeit einer zielgerichteten Optimierung des
Produktangebots auf Seiten des Unternehmens. Wissen über relevante Produktattribute sowie Vorgehensweisen bei ihrer Bewertung unterstützten Marketiers bei der
Präsentation des Produktangebots.
Der Aufbau der Arbeit erfolgt in Anlehnung an Lye et al4 und unterteilt das Gebiet der
Kaufentscheidungstheorie in behavioristische (Kapitel 2) und naturalistische (Kapitel 3)
Forschungsrichtung. Kapitel 2 beinhaltet dabei, neben der Darstellung grundsätzlicher
Ziele einer Kaufentscheidung, eine Kategorisierung behavioristischer Modelle, welche
auf Basis vier zentraler Kriterien...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung
- 2. Behavioristische Entscheidungstheorie
- 2.1. Ziele der Kaufentscheidung
- 2.2. Kriterien der Kaufentscheidung
- 2.3. Behavioristische Modelle der Kaufentscheidung
- 2.3.1. Additive Modelle
- 2.3.2. Satisficing
- 2.3.3. Conjunctive und Disjunctive Modelle
- 2.3.4. Frequenz guter und schlechter Eigenschaften
- 2.3.5. Lexikografisches Modell
- 2.3.6. Elimination-by-aspects
- 2.4. Weiterentwicklung der behavioristischen Kaufentscheidungstheorie
- 2.4.1. Abhängiges Entscheidungsverhalten
- 2.4.2. Rationalitätseinschränkungen
- 2.5. Zwischenfazit
- 3. Naturalistische Entscheidungstheorie
- 3.1. Image Theory
- 3.1.1. Elemente der Image Theory
- 3.1.2. Image Theory als Kaufentscheidungstheorie
- 3.1. Image Theory
- 4. Empirische Validierung von Theorien zur Kaufentscheidung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen Überblick über Theorien der Kaufentscheidung, konzentriert sich auf den betriebswirtschaftlichen und marketingrelevanten Aspekt und untersucht, wie Konsumenten Kaufentscheidungen treffen. Ziel ist es, die Vorgänge in der "Black Box" des Konsumenten zu beschreiben und die Planungssicherheit von Unternehmen zu erhöhen, indem Vorhersagen über Kaufverhalten ermöglicht werden. Die Arbeit analysiert bestehende Theorien und ihre Anwendung in der Praxis.
- Behavioristische Entscheidungstheorie und ihre Modelle
- Die Rolle von Zielen und Kriterien bei Kaufentscheidungen
- Naturalistische Entscheidungstheorien, insbesondere die Image Theory
- Empirische Validierung von Kaufentscheidungstheorien
- Anwendung der Theorien im Marketingkontext
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung: Die Arbeit untersucht die zunehmende Komplexität von Kaufentscheidungen aufgrund des wachsenden Angebots an Produkten. Sie beleuchtet die Relevanz des Verständnisses von Kaufentscheidungen für die Betriebswirtschaft, insbesondere für die Marketingplanung und die Optimierung des Produktangebots. Die zunehmende Angebotsvielfalt, beispielsweise im deutschen Food-Bereich, führt zu einer erhöhten Komplexität der Kaufentscheidungen, die eine genauere Untersuchung erfordert. Die Arbeit fokussiert auf die betriebswirtschaftliche Relevanz, insbesondere für das Marketing, und zielt darauf ab, die Vorgänge in der "Black Box" des Konsumenten zu verstehen und zu erklären.
2. Behavioristische Entscheidungstheorie: Dieses Kapitel beschreibt die behavioristische Entscheidungstheorie und ihre verschiedenen Modelle zur Erklärung von Kaufentscheidungen. Es analysiert Ziele und Kriterien, die Konsumenten bei Kaufentscheidungen berücksichtigen, und stellt verschiedene Modelle wie additive Modelle, Satisficing, conjunctive und disjunctive Modelle, das lexikografische Modell und Elimination-by-aspects vor. Die Modelle werden im Detail erläutert und anhand von Grafiken veranschaulicht. Zusätzlich werden die Weiterentwicklungen der Theorie, insbesondere abhängiges Entscheidungsverhalten und Rationalitätseinschränkungen, betrachtet. Die Kapitel verdeutlicht, wie diese Modelle helfen, die Entscheidungsfindung des Konsumenten besser zu verstehen und vorherzusagen.
3. Naturalistische Entscheidungstheorie: Dieses Kapitel widmet sich der naturalistischen Entscheidungstheorie und im Speziellen der Image Theory. Es erläutert die Elemente der Image Theory, wie z.B. die verschiedenen Images und deren Einfluss auf die Kaufentscheidung. Die Darstellung umfasst die einzelnen Schritte des Entscheidungsprozesses und erklärt, wie die Image Theory als Kaufentscheidungstheorie eingesetzt werden kann. Die Bedeutung von "Screening" und "Choice" wird hervorgehoben und der Einfluss dieser Faktoren auf die Kaufentscheidung detailliert beschrieben. Durch die Kombination von Grafiken und Texten wird ein umfassendes Bild der Theorie vermittelt und ihre Anwendbarkeit illustriert.
4. Empirische Validierung von Theorien zur Kaufentscheidung: Dieses Kapitel befasst sich mit der empirischen Überprüfung der im vorherigen Kapitel vorgestellten Theorien. Es wird untersucht, inwiefern die verschiedenen Modelle die Realität abbilden und welche empirischen Belege für ihre Gültigkeit vorliegen. Dieser Teil der Arbeit verbindet die theoretischen Überlegungen mit praktischen Anwendungen und zeigt die Grenzen und Möglichkeiten der verschiedenen Theorien auf. Die empirischen Ergebnisse werden analysiert und im Kontext der gesamten Arbeit diskutiert. Eine detaillierte Analyse der Resultate und deren Implikationen für das Verständnis von Kaufentscheidungen ist hier der Kernpunkt.
Schlüsselwörter
Kaufentscheidung, Behavioristische Entscheidungstheorie, Naturalistische Entscheidungstheorie, Image Theory, Konsumentenverhalten, Marketing, Produktwahl, Entscheidungsmodelle, Rationalität, Empirische Validierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Theorien der Kaufentscheidung"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über Theorien der Kaufentscheidung, mit Fokus auf betriebswirtschaftliche und marketingrelevante Aspekte. Sie untersucht, wie Konsumenten Kaufentscheidungen treffen, um die Vorgänge in der "Black Box" des Konsumenten zu beschreiben und die Planungssicherheit von Unternehmen durch Vorhersagen des Kaufverhaltens zu erhöhen. Die Arbeit analysiert bestehende Theorien und ihre praktische Anwendung.
Welche Theorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt hauptsächlich die behavioristische und die naturalistische Entscheidungstheorie. Im Detail werden verschiedene Modelle der behavioristischen Entscheidungstheorie erklärt, darunter additive Modelle, Satisficing, konjunktive und disjunktive Modelle, das lexikografische Modell und Elimination-by-aspects. Die Weiterentwicklungen der behavioristischen Theorie, wie abhängiges Entscheidungsverhalten und Rationalitätseinschränkungen, werden ebenfalls berücksichtigt. Aus der naturalistischen Entscheidungstheorie wird die Image Theory im Detail vorgestellt und analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Problemstellung, 2. Behavioristische Entscheidungstheorie, 3. Naturalistische Entscheidungstheorie, 4. Empirische Validierung von Theorien zur Kaufentscheidung und 5. Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Kaufentscheidungstheorien und deren Anwendung.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Komplexität von Kaufentscheidungen im Kontext des wachsenden Produktangebots zu verstehen und zu erklären. Durch die Analyse bestehender Theorien soll die Vorhersagbarkeit des Konsumentenverhaltens verbessert und die Planungssicherheit von Unternehmen, insbesondere im Marketing, erhöht werden.
Wie wird die Image Theory behandelt?
Die Image Theory wird im Kapitel zur naturalistischen Entscheidungstheorie ausführlich beschrieben. Es werden die Elemente der Image Theory, wie verschiedene Images und deren Einfluss auf die Kaufentscheidung, erläutert. Der Prozess der Kaufentscheidung wird anhand der Image Theory schrittweise dargestellt, inklusive der Bedeutung von "Screening" und "Choice".
Welche Rolle spielen empirische Daten?
Ein eigenes Kapitel befasst sich mit der empirischen Validierung der vorgestellten Theorien. Es wird untersucht, inwieweit die Modelle die Realität abbilden und welche empirischen Belege für ihre Gültigkeit existieren. Die Analyse der empirischen Ergebnisse zeigt die Grenzen und Möglichkeiten der verschiedenen Theorien auf.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Kaufentscheidung, Behavioristische Entscheidungstheorie, Naturalistische Entscheidungstheorie, Image Theory, Konsumentenverhalten, Marketing, Produktwahl, Entscheidungsmodelle, Rationalität, Empirische Validierung.
Wie werden die behavioristischen Modelle der Kaufentscheidung dargestellt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene behavioristische Modelle detailliert, einschließlich ihrer Stärken und Schwächen. Diese Modelle werden durch Grafiken veranschaulicht und anhand von Beispielen erklärt. Der Fokus liegt auf dem Verständnis, wie diese Modelle helfen, die Entscheidungsfindung des Konsumenten besser zu verstehen und vorherzusagen.
Welche Bedeutung hat die Problemstellung?
Die Problemstellung betont die zunehmende Komplexität von Kaufentscheidungen aufgrund des wachsenden Angebots, insbesondere im deutschen Food-Bereich. Sie unterstreicht die Relevanz des Verständnisses von Kaufentscheidungen für die Betriebswirtschaft, speziell für die Marketingplanung und die Optimierung des Produktangebots.
Gibt es ein Fazit?
Ja, die Arbeit schließt mit einem Fazit ab, das die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst und einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen gibt.
- Citar trabajo
- Fabian Stern (Autor), 2010, Marketing: Wie fällen Konsumenten Kaufentscheidungen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193188