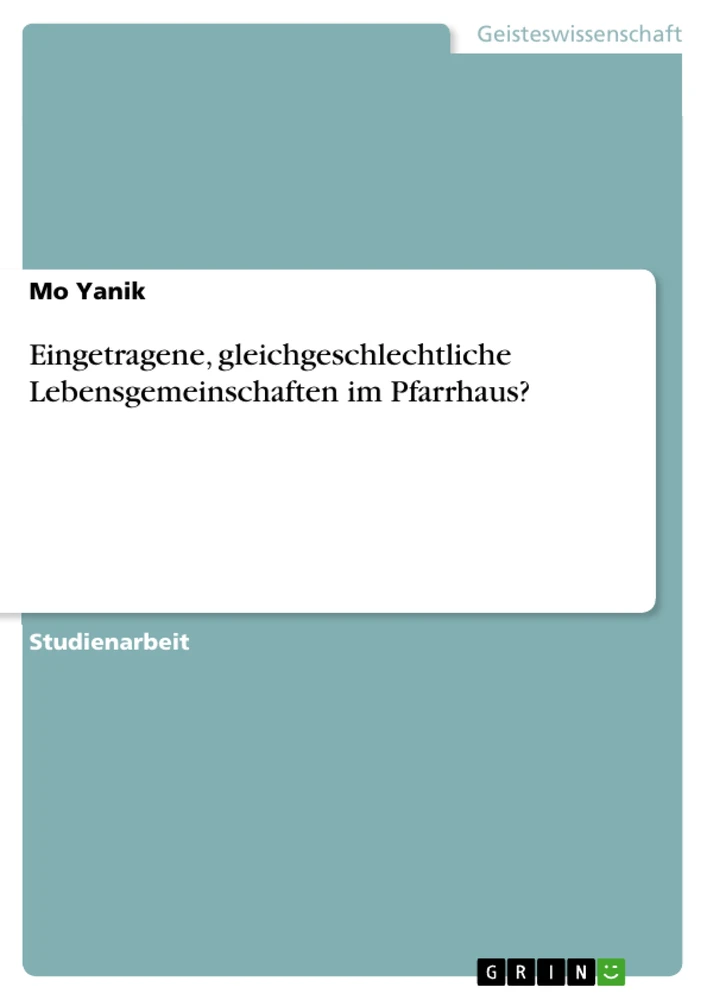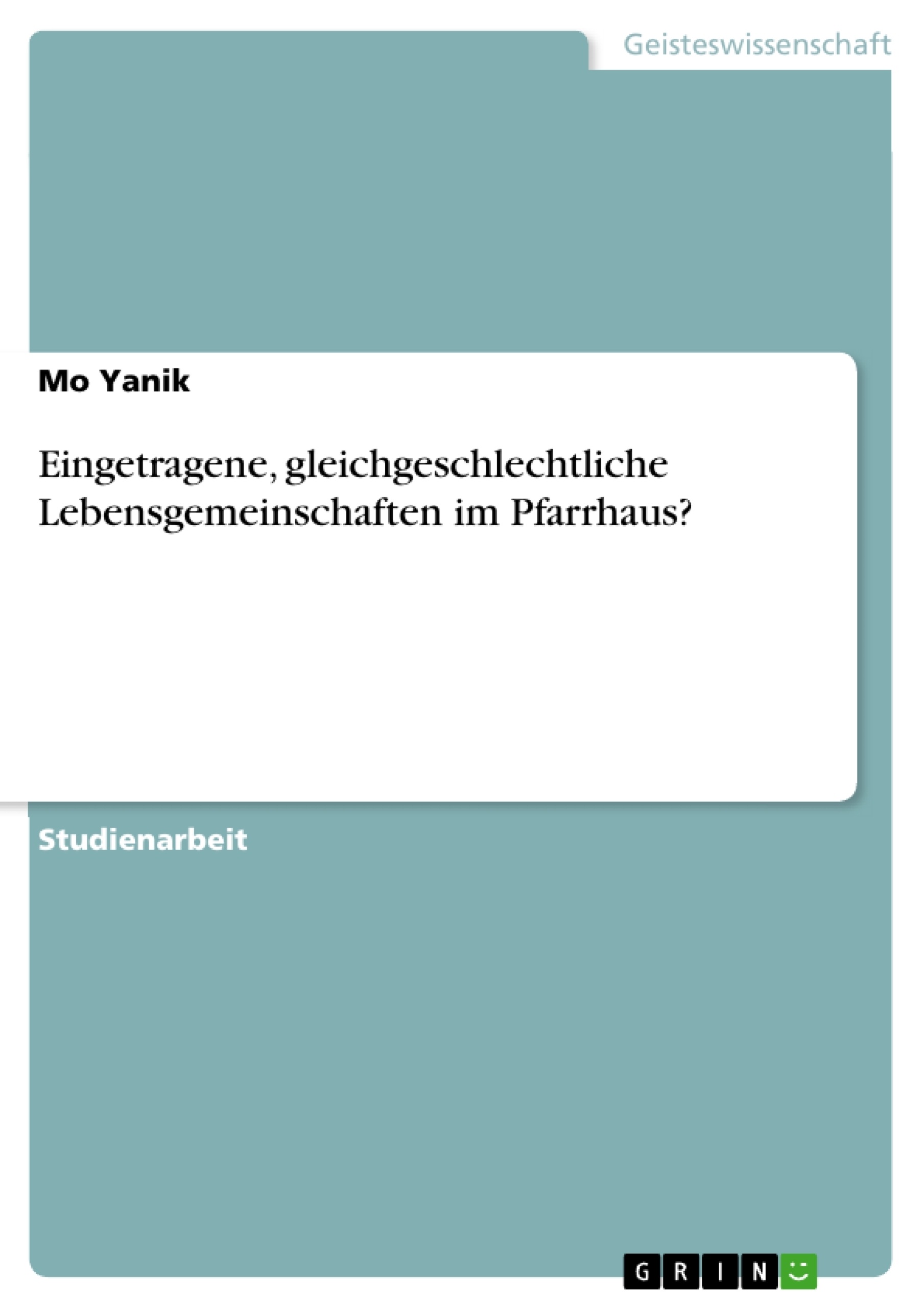Das hier vorliegende Papier ist das Ergebnis einer Debatte, die immer größere mediale Präsenz gefunden hat. Es geht um die souveräne Frage, ob es – innerhalb Deutschlands – kirchenrechtlich möglich bzw. tolerierbar ist, dass sich eine evangelische Pfarrerin bzw. ein evangelischer Pfarrer in einer gleichgeschlechtlichen, eingetragene Lebensgemeinschaft befindet und durch Zusammenleben im Pfarrhaus öffentlich zeigt, dass sie oder er homosexuell ist (und eine Pfarrstelle innehat).
Anlass und Ursache dieser Debatte sind natürlich konkrete Wünsche von homosexuellen Pfarrerinnen und Pfarrern, die im Zuge des gesellschaftlichen Paradigmenwechsels (angestossen durch die Streichung des § 175 aus dem Strafgesetzbuch in den 1960er bzw. 1970er Jahren) ihr coming out öffentlich gemacht haben, mit ihren Lebenspartnern im Pfarrhaus zusammenzuwohnen oder weiterführend Kinder zu adoptieren und Vergleichbares. Einige Fälle sind, wie sollte es anders sein, als skandalon in die Öffentlichkeit geraten und erhöhten dadurch den Druck auf die Kirche. Es wurde ein Entscheidungszwang ausgelöst, sodass sich die Kirche positionieren musste.
Die PRO-Seite nutzte als Hauptargument, dass die Kirche „mit der Zeit gehen muss“ und sich den Lebensumständen und gesellschaftlich akzeptierten Konventionen anpassen sollte. Die CONTRA-Seite stellte sich dem entgegen: dies sei kein kirchlich akzeptierbarer Lebensstil für PfarrerInnen. Beide Seiten versuchen ihre Argumentationen theologisch zu manifestieren. Nachfolgend möchte ich ein religionswissenschaftliches Resümee dieser Debatte ziehen. Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur eine geschlechtliche Form in der Pluralform personenbezogener Substantive verwendet, die neutral verstanden wird. Wenn von Pfarrern die Rede ist, bedeutet dies, dass sowohl Frauen als auch Männer gemeint sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtlicher Hintergrund
- Inkrafttreten des LPartG und die Folgen
- Kirchliche Reaktionen und kirchenrechtliche Situation
- Beispiel der Pfarrerin Katrin Jell
- Inkrafttreten des LPartG und die Folgen
- Positionen und theologische Argumente
- Pro
- Landeskirche Sachsen
- Erklärung des Landesbischofs
- AG „Homosexualität in biblischem Verständnis“
- Contra
- Markersbacher Initiative
- Sächsische Bekenntnisinitiative
- Pro
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Publikation befasst sich mit der kirchenrechtlichen Diskussion über die Lebensweise von evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern in gleichgeschlechtlichen, eingetragenen Lebensgemeinschaften. Die Arbeit analysiert die Reaktionen der Kirche auf den gesellschaftlichen Paradigmenwechsel in Bezug auf Homosexualität und untersucht die theologischen Argumente, die für und gegen die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften innerhalb der Kirche vorgebracht werden. Dabei werden konkrete Beispiele aus dem kirchlichen Diskurs in Deutschland beleuchtet.
- Kirchliches Recht und Homosexualität
- Öffentlicher Diskurs und gesellschaftliche Entwicklungen
- Theologische Argumentationen zur Homosexualität
- Konkrete Fallbeispiele aus dem evangelischen Kirchenkontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik und den Kontext der Arbeit vor. Das erste Kapitel widmet sich dem geschichtlichen Hintergrund und beleuchtet die Auswirkungen des Inkrafttretens des Lebenspartnerschaftsgesetzes (LPartG) auf die Kirche, insbesondere die kirchenrechtliche Situation. Das zweite Kapitel präsentiert verschiedene Positionen und theologische Argumente, die in der Debatte um gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften im Pfarrhaus vertreten werden. Dabei werden sowohl Argumente der Befürworter als auch der Gegner der Akzeptanz von Homosexualität in der Kirche detailliert dargelegt.
Schlüsselwörter
Evangelische Kirche, Homosexualität, Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft, Pfarrhaus, Kirchenrecht, Theologische Argumentation, Öffentlicher Diskurs, LPartG, § 175 StGB, gesellschaftlicher Paradigmenwechsel.
Häufig gestellte Fragen
Dürfen homosexuelle Pfarrer im Pfarrhaus zusammenleben?
Dies ist Gegenstand einer intensiven kirchenrechtlichen Debatte. Die Arbeit untersucht, ob eingetragene Lebenspartnerschaften im Pfarrhaus tolerierbar sind und wie die Kirche auf diesen gesellschaftlichen Wandel reagiert.
Welchen Einfluss hatte das Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) auf die Kirche?
Das Inkrafttreten des LPartG löste in der Kirche einen Entscheidungszwang aus, sich zu homosexuellen Lebensgemeinschaften von Geistlichen öffentlich zu positionieren.
Was sind die Hauptargumente der Befürworter (Pro-Seite)?
Befürworter argumentieren, dass die Kirche sich gesellschaftlich akzeptierten Konventionen anpassen und "mit der Zeit gehen" müsse, um relevant zu bleiben.
Welche theologischen Gegenargumente (Contra-Seite) gibt es?
Die Contra-Seite, etwa die sächsische Bekenntnisinitiative, vertritt die Ansicht, dass homosexuelle Lebensstile nicht mit dem kirchlichen Leitbild für Pfarrer vereinbar seien.
Welche Rolle spielt der Paragraph 175 StGB in der Debatte?
Die Streichung des § 175 in den 60er/70er Jahren gilt als historischer Auslöser für den gesellschaftlichen Paradigmenwechsel, der letztlich auch die Forderungen innerhalb der Kirche nach Akzeptanz verstärkte.
- Quote paper
- Mo Yanik (Author), 1999, Eingetragene, gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften im Pfarrhaus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193229