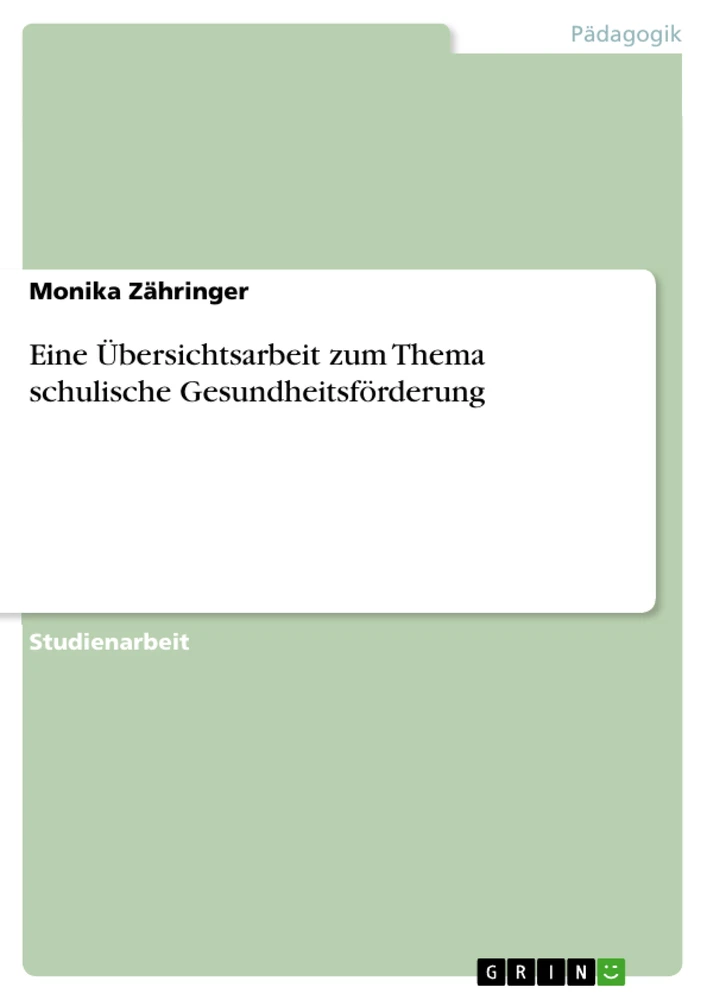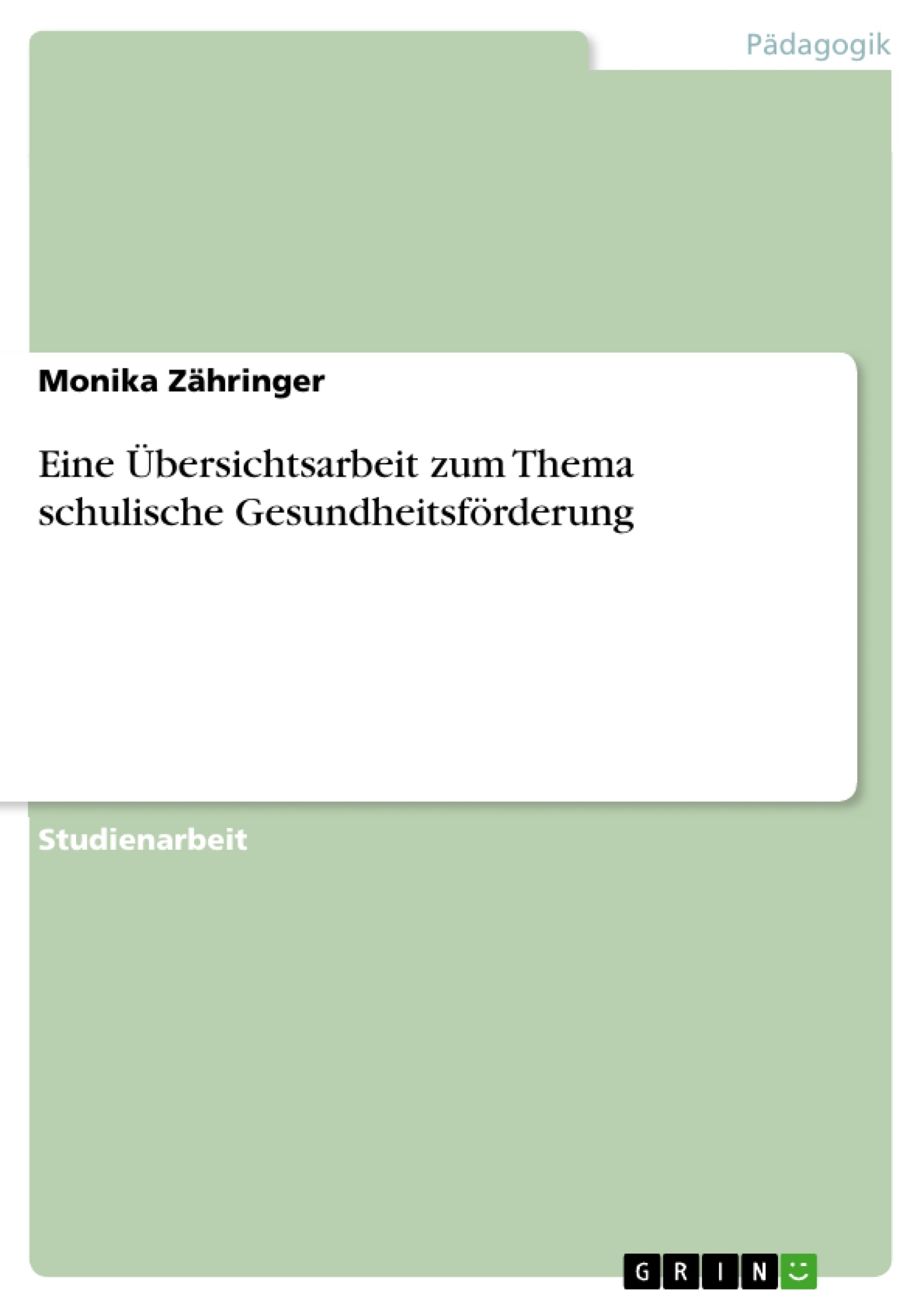Die ursprüngliche Bedeutung des Worts Schule (aus dem Lateinischen „scola“) führt durch eine wörtliche Übersetzung zum Begriff der „Muse“, bzw. „über freie Zeit verfügen“(vgl. Ipfling, 2002). Heutzutage verbinden wir den Schulbegriff vielmehr mit einer Institution, in der planmäßiges und gemeinsames Unterrichten von Kindern und Jugendlichen stattfindet. Im Mittelpunkt steht hierbei die Aufgabe der Bildung und Erziehung der heranwachsenden Generationen (vgl. Meyer, 1997). In diesem Kontext gilt es, Kinder und Jugendliche unter anderem mit allen nützlichen und notwendigen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten auszustatten, womit Lesen, Schreiben mathematische Fähigkeiten und Fremdsprachenkenntnisse gemeint sind (vgl. Ipfling, 2002). Unter Anleitung speziell ausgebildeter Experten werden Schülerinnen und Schüler auf das spätere Arbeitsleben bzw. eine Weiterqualifikation durch gesellschaftlich dafür vorgesehene Einrichtungen vorbereitet (vgl. Ulich, 2000). Allerdings hat sich dieses ursprüngliche Bild der Schule im Laufe der letzten Jahre geändert. Schon seit 1992 gehört die Gesundheitserziehung laut dem Bericht der Kultusministerkonferenz zum Pflichtprogramm an allgemeinbildenden Schulen. Die Gesundheitserziehung, die Teil einer umfassenden Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsförderung darstellt, gehört seither zum wesentlichen Bestandteil des Bildungs- und Erziehungsauftrages an Schulen. (vgl. Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder, 1992). Auch die verlängerten Ausbildungszeiten führen dazu, dass vielfältige psychosoziale Führungsaufgaben an Schulen an Bedeutung gewinnen. Ohne die enge Zusammenarbeit mit den Eltern und ausschließlich auf traditionellen Prinzipien der rein kognitiven Wissensvermittlung basierend, könnte die Schule diese Aufgaben nicht mehr länger bewältigen (vgl. Paulus, 2005). Neben den verlängerten Ausbildungszeiten zeigen auch die von der WHO veröffentlichten Zahlen zur Kinder- und Jugendgesundheit in Deutschland einen negativen Trend. Nur eine Minderheit der Heranwachsenden ist fast jeden Tag mindestens eine Stunde körperlich aktiv und erfüllt damit die aktuelle Empfehlung der WHO zum Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen (vgl. Sygusch et al., 2009).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung in die Thematik und Problemdarstellung.
- 2. Begriffsbestimmung und Abgrenzung....
- 2.1 Definition Gesundheit
- 2.2 Definition der Gesundheitsförderung
- 2.3 Der Setting-Ansatz.
- 3. Handlungsbedarf..
- 3.1 Gesundheitsstatus und Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen .....
- 3.2 Die Bedeutung und Notwendigkeit körperlich-sportlicher Aktivität im Kindes- und Jugendalter.
- 4. Gesundheitsförderung im Setting Schule…........
- 4.1 Schule als zentrales Setting für Gesundheitsförderung bei Kindern und Jugendlichen ..
- 4.2 Abgrenzung Gesundheitsförderung in der Schulen und Gesundheitsfördernde Schule
- 4.2.1 Gesundheitsförderung in der Schule
- 4.2.2 Die Gesundheitsfördernde Schule.
- 4.3 Strukturen und Inhalte der Gesundheitsfördernden Schule....
- 4.4 Wirksamkeit der Maßnahmen..
- 4.4.1Wirksamkeit der Sport- und Bewegungsförderung
- 5. Bewegungskonzepte im Setting Schule
- 5.1 Sportunterricht, ein geeignetes Setting für Bewegungsförderung?? .
- 6. Schlussfolgerung.....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Übersichtsarbeit beleuchtet die Bedeutung von Gesundheitsförderung im schulischen Setting. Sie analysiert den aktuellen Handlungsbedarf, insbesondere im Hinblick auf den Gesundheitszustand und das Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen. Im Fokus stehen dabei die Konzepte und Strukturen der Gesundheitsfördernden Schule sowie die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Sport- und Bewegungsförderung. Die Arbeit stellt zudem die Rolle des Sportunterrichts im Kontext der Gesundheitsförderung in Frage.
- Gesundheitsförderung im schulischen Kontext
- Handlungsbedarf und Notwendigkeit von Gesundheitsförderung bei Kindern und Jugendlichen
- Konzept der Gesundheitsfördernden Schule
- Wirksamkeit von Sport- und Bewegungsförderung
- Rolle des Sportunterrichts bei der Gesundheitsförderung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der schulischen Gesundheitsförderung ein und beschreibt den aktuellen Handlungsbedarf. Kapitel 2 definiert die zentralen Begriffe „Gesundheit“ und „Gesundheitsförderung“ und erläutert den Setting-Ansatz. Kapitel 3 beleuchtet den Gesundheitszustand und das Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen sowie die Bedeutung körperlich-sportlicher Aktivität in diesem Alter. In Kapitel 4 wird die Schule als zentrales Setting für Gesundheitsförderung bei Kindern und Jugendlichen vorgestellt, wobei die Abgrenzung zwischen Gesundheitsförderung in der Schule und der Gesundheitsfördernden Schule im Vordergrund steht. Kapitel 5 diskutiert Bewegungskonzepte im schulischen Setting und hinterfragt die Eignung des Sportunterrichts für die Bewegungsförderung.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter sind: Schulische Gesundheitsförderung, Gesundheitsförderung, Bewegungsverhalten, Kinder und Jugendliche, Gesundheitsfördernde Schule, Sportunterricht, Handlungsbedarf, Wirksamkeit, Bewegungskonzepte.
- Citar trabajo
- Monika Zähringer (Autor), 2012, Eine Übersichtsarbeit zum Thema schulische Gesundheitsförderung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193247