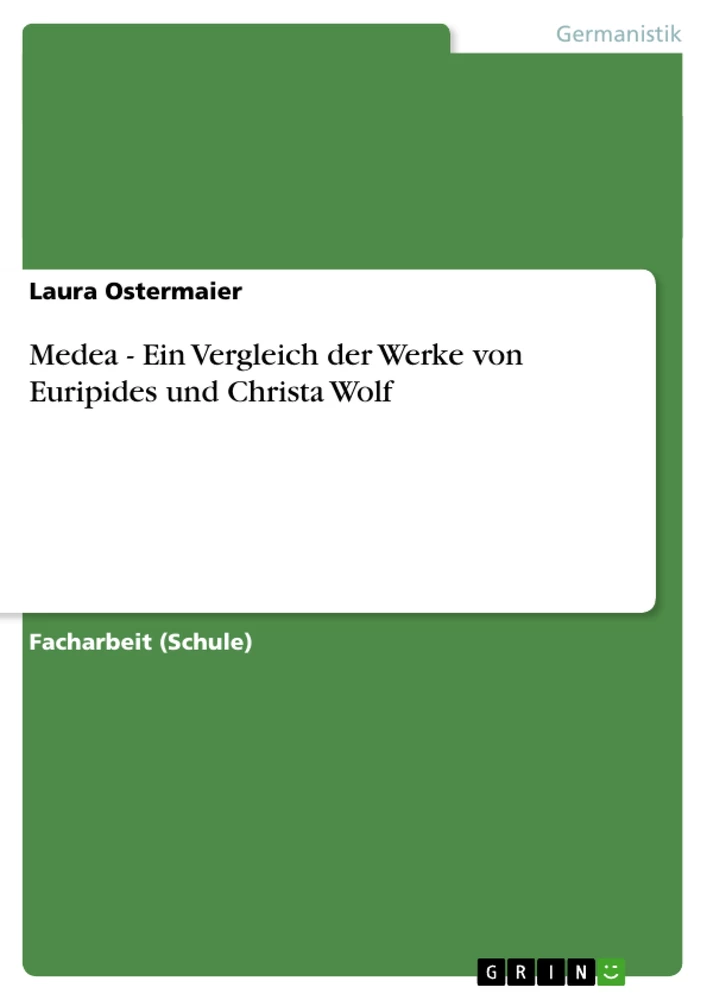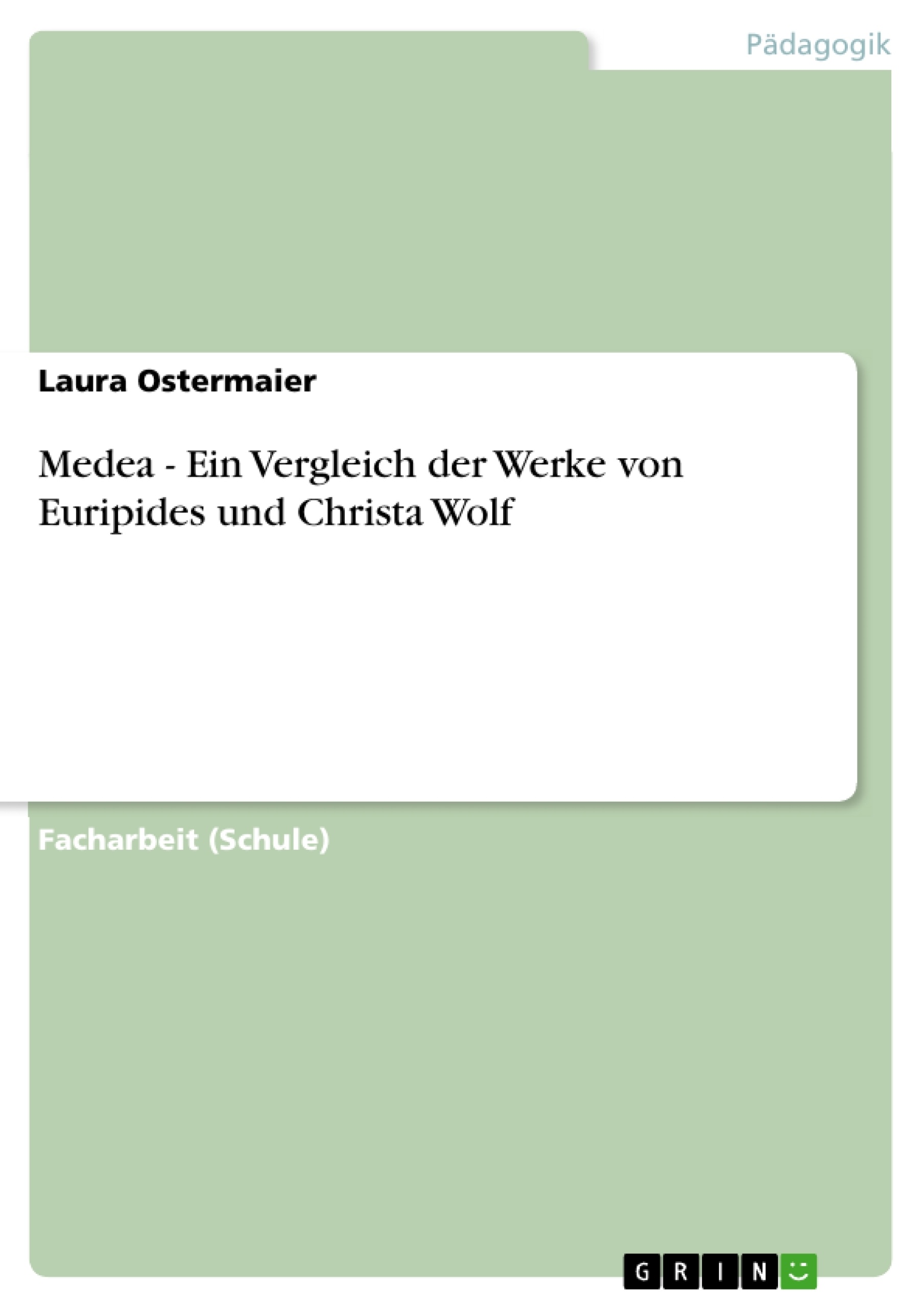Einleitungsgedanke: Der Medea-Mythos
Medea, ein Mythos, der die Menschen seit bereits über zweieinhalbtausend Jahren bewegt und fasziniert: Durch alle Epochen setzte Medea ihre ikonographische Präsenz durch1. So inspirierte sie seit ihrer ersten Erwähnung an der Schwelle des 7. vorchristlichen Jahrhunderts in der Theogonie Hesiods2 immer wieder zum Neuerzählen ihrer Geschichte.
Der Sage nach ist Medea eine kolchische Königstochter, die dem Führer des Argonautenzuges Jason, einem Königssohn aus Iolkos, mit ihren Zauberkräften hilft, das Goldene Vlies zu entführen, weswegen er nach Kolchis gesandt worden war. Medea verliebt sich in Jason und flieht nach dem Verrat an ihrem Vaterland mit ihm. Nachdem die beiden auch aus Iolkos vertrieben werden, als Opfer einer Intrige des Pelias, Jasons Onkel, finden sie in Korinth Asyl. Dort werden sie freundlich empfangen von König Kreon. Sie leben hier einige Jahre lang glücklich bis Jason sich in die Königstochter Kreusa, auch Glauke genannt, verliebt und seine gedemütigte Gattin Medea verlässt. Daher sinnt diese auf Rache. Euripides, welcher 431 v.Chr. das erste Drama über Medea verfasste, dichtete ihr den Mord an ihren eigenen beiden Söhnen an3, mit welchem sie bezweckte, ihren untreuen Ehemann für immer zu vernichten. Dieser gelungene dramaturgische Kunstgriff ging dauerhaft in den Mythenstoff um Medea ein und wurde in späteren Medea-Bearbeitungen meist fester Bestandteil der Handlung4. So wurde aus der ursprünglich zauberkundigen Helferin eine böse Hexe und skrupellose Verbrecherin.
Doch gegen Ende der 70er Jahre setzte ein bis heute anhaltender „Medea-Boom“ ein, wobei feministisch orientierte Medea-Texte mit ungewohnten Perspektiven spielen und den Mythos neu erzählen5. So zum Beispiel die Autorin Christa Wolf: In ihrer 1996 geschriebenen Fassung der Medea hält sie sich nicht an die Vorgaben des Euripides, sondern sie nimmt Medea in Schutz.
Diese Arbeit wird nun in ihrem weiteren Verlauf die euripideische Medea mit Christa Wolfs „Medea. Stimmen“ verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitungsgedanke: Die Faszination des Medea-Mythos
- Gattungsspezifische Unterschiede zwischen Roman und gespieltem Drama
- Thematische Unterschiede
- Euripides
- Medeas besondere Aktivität im Drama: Rolle, Lebensvorstellungen, Lösungen
- Intention des Euripides
- Christa Wolf
- Medeas besondere Aktivität im Roman: Rolle, Lebensvorstellungen, Lösungen
- Bezug der Figur Medea zu Christa Wolfs Biographie
- Euripides
- Vergleich der Motive und Themen von Euripides' „Medea“ mit Christa Wolfs „Medea. Stimmen“
- Literaturbetrieb in der DDR
- Schlussgedanke: Bedeutung des letzten Ausrufes der Medea in Christa Wolfs Roman
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Unterschiede zwischen Euripides' „Medea“ und Christa Wolfs „Medea. Stimmen“, um den Einfluss der Zeit und der individuellen Perspektive auf die Darstellung des Mythos zu beleuchten. Die Analyse konzentriert sich auf die gattungsspezifischen und thematischen Unterschiede zwischen den beiden Werken.
- Gattungsbezogene Aspekte: Vergleich der literarischen Gattungen Tragödie und Roman
- Charakterisierung von Medeas Rolle und Handlungsmotive in beiden Werken
- Analyse der Intentionen der Autoren Euripides und Christa Wolf
- Zusammenhänge zwischen der Darstellung der Medea und den jeweiligen historischen Kontexten
- Untersuchung des literarischen Betriebs in der DDR im Kontext von Christa Wolfs „Medea. Stimmen“
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Einleitungsgedanke führt in den Medea-Mythos ein und beleuchtet dessen Relevanz und Bedeutung in verschiedenen Epochen.
- Kapitel 1 analysiert die gattungsspezifischen Unterschiede zwischen Euripides' Tragödie und Christa Wolfs Roman, wobei die Eigenheiten beider Genres und die Bedeutung des inneren Monologs in Wolfs Werk hervorgehoben werden.
- Kapitel 2 untersucht die thematischen Unterschiede in der Darstellung Medeas. Es werden die Rolle, Lebensvorstellungen und Lösungen der Figur in beiden Werken gegenübergestellt und die Intentionen der Autoren beleuchtet.
- Kapitel 3 vergleicht die Motive und Themen von Euripides' „Medea“ mit Christa Wolfs „Medea. Stimmen“ und analysiert die jeweiligen Perspektiven der Autoren.
- Kapitel 4 beleuchtet den Literaturbetrieb in der DDR im Kontext von Christa Wolfs „Medea. Stimmen“ und untersucht die Rezeption des Romans in der damaligen Zeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselwörter: griechische Tragödie, Roman, innerer Monolog, Medea-Mythos, Euripides, Christa Wolf, Geschlechterrollen, Zeitgeist, Literaturbetrieb in der DDR, feministische Literatur.
- Quote paper
- Laura Ostermaier (Author), 2006, Medea - Ein Vergleich der Werke von Euripides und Christa Wolf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193310