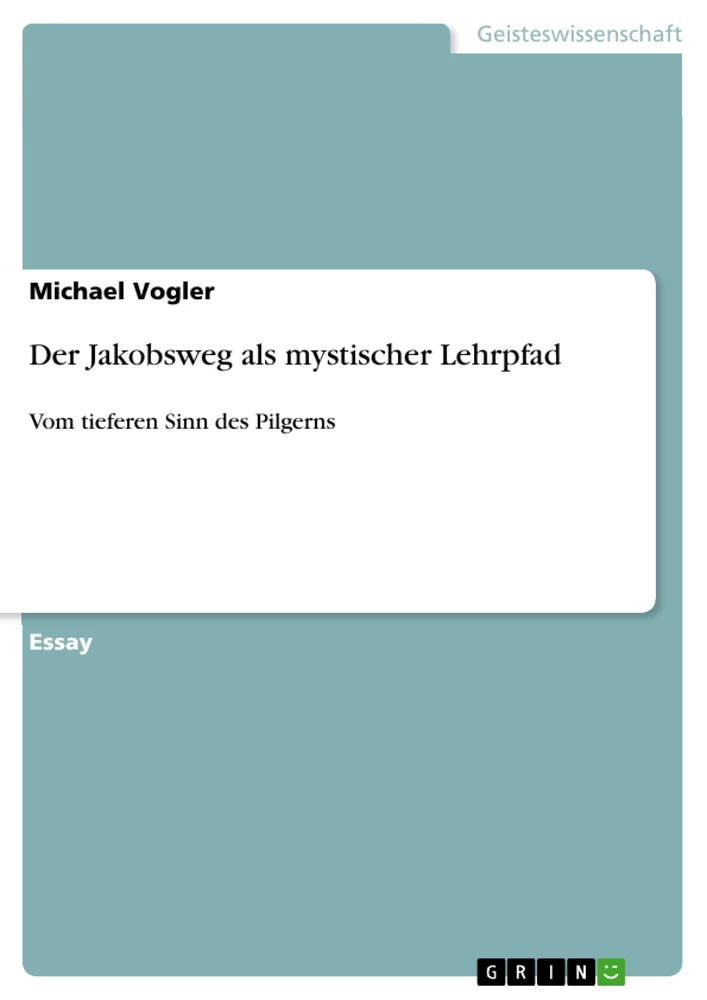„Mystik“ wirkt heute wie ein anachronistisches Thema für einen Vortrag. Es wirkt irgendwie verrückt. Der Begriff ist irritierend. Häufig wird er verwechselt mit dem Begriff „Mythos“ und auch im Sinne von „mystifizieren“ gebraucht. Worunter eher Vernebelung als Klarsicht zu verstehen ist. Viel leichter, als zu sagen, was es ist, ist zu sagen, was es nicht ist. NICHT ist es, was uns in Bildern von Mystikern vorgestellt wird: frömmelnde, durchgeistigte Spinner, die jede Bodenhaftung verloren haben und ein unverständliches Kauderwelsch sprechen.
Das Gegenteil ist der Fall. Mystiker waren alle sehr realistische Tatmenschen, die mit beiden Beinen auf der Erde standen.
.....
Der Unterschied zu den Erlebnissen von Mystikern oder von Jakobspilgern besteht lediglich darin, daß das Erlebnis lange eingeübt wird, daß Ablenkungen weitgehend ausgeschaltet werden, daß die Intensität höher ist und daß die Wirkung sich nie wieder verliert. Solche mystischen Erlebnisse können auf viele Arten erworben werden. Der Jakobsweg ist nur eine dieser Möglichkeiten. Lange Meditationen oder das Durchleben und positive Verarbeiten einer schweren Erkrankung führen zum gleichen Erlebnis. Und dieses ist unabhängig von Epoche, Kultur oder Lebensalter.
.....
Fray Juan Antonio Torres Prieto, ein Benediktiner aus dem spanischen Kloster Silos, der den Jakobsweg mehrere Male begangen hat, schrieb: „Durch das Pilgern verwandelt sich der (Mensch) in einen Propheten, der in der Lage ist, die Vergänglichkeit dem wahren und verborgenen Sinn des menschlichen Abenteuers entgegen zu stellen.“
Ein Prophet? Ja, wenn man weiß, was man darunter zu verstehen hat. Propheten wandeln auf dem schmalen Grant zwischen Gegenwart und Zukunft. Sie öffnen ihren Mitmenschen die Augen für die Verirrungen ihrer aktuellen Gesellschaft, entwerfen ein Bild davon, was geschieht, wenn diese ihr Verhalten nicht ändert und malen kraftvolle Visionen für weitere Schritte. Am einfachsten sagt es Richard Rohr: Wir glauben immer, daß Propheten die Zukunft vorhersagen. Das ist falsch. Propheten sind Menschen, die die Zukunft hervorsagen!“
Genau das erwartet sich die EU-Kommission von den Pilgern. Deshalb fördert sie den Jakobsweg. Denn die Mitglieder der Kommission wußten, daß wir – soll Europa zusammenwachsen – eine europäisierende Spiritualität brauchen.
Inhaltsverzeichnis
- Der Begriff der „Mystik“
- Was Mystik nicht ist
- Beobachtungen am Jakobsweg
- Die Bedeutung des Jakobsweges
- Der Aufbruch
- Läuterung
- Der Tod
- Die Wandlung
- Auferstehung
- Was bringt einem das selbst?
- Was bringt es der Gesellschaft?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Vortrag beleuchtet den Jakobsweg aus mystischer Perspektive und untersucht, wie die Pilgerreise zu spirituellen und persönlichen Wandlungen führen kann.
- Definition und Verständnis von Mystik
- Bedeutung und Erscheinungsformen des Jakobswegs
- Die spirituellen Erfahrungen der Pilger
- Der Jakobsweg als kulturelle und historische Bedeutung
- Die Auswirkungen der Pilgerreise auf Individuum und Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Der Begriff der „Mystik“
Der Vortrag beginnt mit einer Definition des Begriffs „Mystik“, die von den gängigen Klischees abweicht. Mystiker werden als realistische Tatmenschen dargestellt, die sich aktiv mit ihrer Zeit auseinandersetzten, wie zum Beispiel Meister Eckhart, Therese von Avila und Ignatius von Loyola.
Was Mystik nicht ist
Das Kapitel widerlegt gängige Missverständnisse zum Begriff „Mystik“ und grenzt ihn deutlich von fundamentalistischen Strömungen ab, die sich auf ein „Erweckungserlebnis“ berufen.
Beobachtungen am Jakobsweg
Anhand einer persönlichen Begegnung mit einem Pilger am Jakobsweg wird die transformative Kraft der Reise deutlich. Der Jakobsweg wird als ein Weg zur inneren Ausgeglichenheit und zur Wiederentdeckung des Wesentlichen im Leben beschrieben.
Die Bedeutung des Jakobsweges
Dieses Kapitel befasst sich mit den vielseitigen Motiven der Pilger und deren spirituellen Erfahrungen auf dem Jakobsweg. Es wird außerdem die historische und kulturelle Bedeutung des Jakobswegs als "Rückgrat Europas" hervorgehoben.
Der Aufbruch
Dieser Abschnitt behandelt die ersten Schritte auf dem Jakobsweg und die Herausforderungen, die sich den Pilgern stellen.
Läuterung
Die Reise führt die Pilger durch verschiedene Phasen der Läuterung und konfrontiert sie mit ihren eigenen Schwächen und Ängsten.
Der Tod
Die Begegnung mit dem Tod ist ein wesentlicher Bestandteil der Pilgerreise und führt zu neuen Einsichten und einem veränderten Blick auf das Leben.
Die Wandlung
Das Kapitel beschreibt den Prozess der Transformation, die die Pilger auf dem Jakobsweg durchlaufen.
Auferstehung
Dieser Abschnitt beleuchtet die Erfahrungen der Wiedergeburt und Neugeburt, die die Pilger am Ende ihrer Reise machen.
Schlüsselwörter
Mystik, Jakobsweg, Pilgerreise, spirituelle Erfahrungen, Transformation, innere Ausgeglichenheit, kulturelle Bedeutung, historische Bedeutung, europäische Spiritualität.
- Citation du texte
- Michael Vogler (Auteur), 2012, Der Jakobsweg als mystischer Lehrpfad , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193364