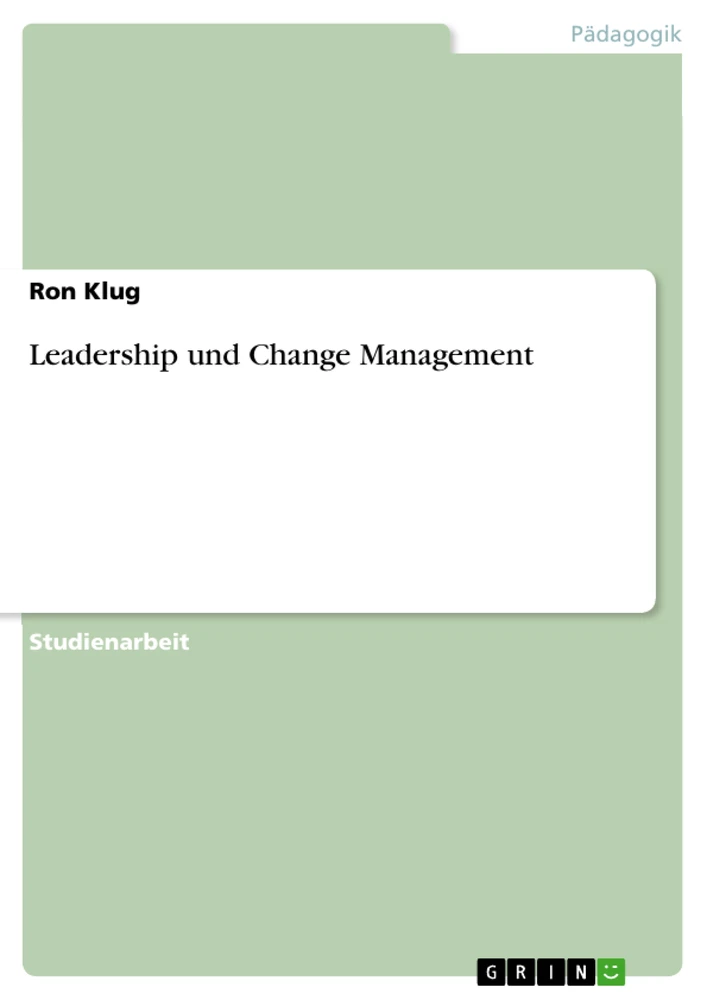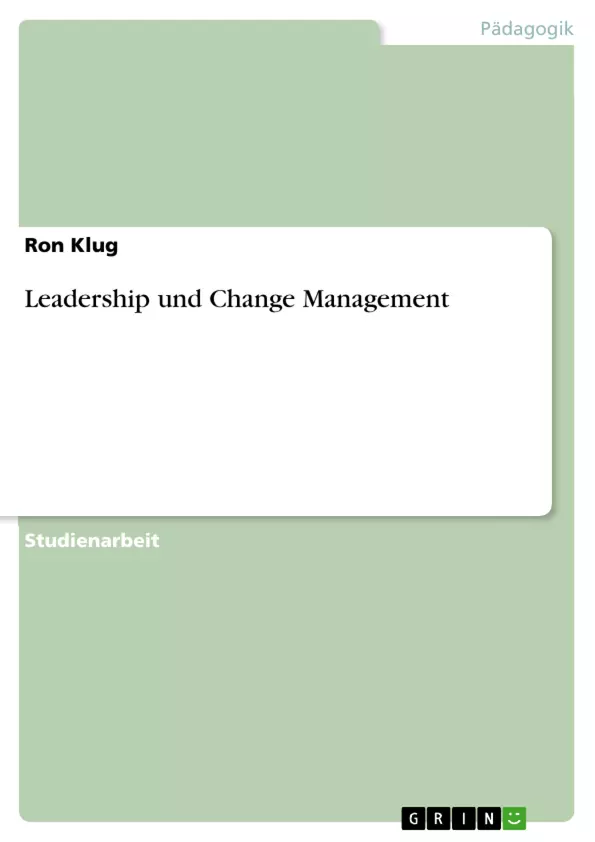Die moderne Schule bewegt sich in einem „Spannungsfeld zwischen Bewahren und Verändern“ (Schratz 2003, S. 1). Dabei fungiert sie zum einen als Ort der Reproduktion bestehender Bildungsinhalte und kultureller Normen- und Wertvorstellungen sowie als Ort der Transformation, also der Veränderung und Anpassung an aktuelle gesellschaftliche Anforderungen (vgl. ebd., S. 1 und 49).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Aufgabenfelder moderner Schulleitung
- 2 Der Teufelskreis alter Lösungsansätze
- 3 Fallbeispiel: Fragen eines Schulleiters
- 4 Fallbeispiel: Schwierigkeiten einer Schule
- 5 Lösungsansätze
- 6 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Aufgaben und Herausforderungen der modernen Schulleitung im Kontext von Leadership und Change-Management. Sie analysiert die sich wandelnden Anforderungen an Schulleitungen und stellt die Bedeutung von Management-, Leadership-, pädagogischen, Schulentwicklungs-, Personalentwicklungs-, Unterrichtsentwicklungs- und Qualitätsentwicklungsaufgaben dar.
- Spannungsfeld zwischen Bewahren und Verändern
- Relevanz von Management- und Leadership-Aufgaben
- Steigerung der Eigenverantwortlichkeit im Lehr-Lern-Prozess
- Bedeutung der Personalentwicklung für eine lernende Organisation
- Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung im Kontext von Change-Management
Zusammenfassung der Kapitel
1 Aufgabenfelder moderner Schulleitung
Dieses Kapitel beschreibt die vielfältigen Aufgabenfelder moderner Schulleitungen. Es beleuchtet das Spannungsfeld zwischen Bewahren und Verändern, das die heutige Schule prägt. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von der administrativen Institution zur vielseitigen lernenden Organisation. Die relevanten Aufgabenbereiche wie Management-, Leadership-, pädagogische Aufgaben, Schulentwicklung, Personalentwicklung, Unterrichtsentwicklung und Qualitätssicherung werden durch praxisnahe Beispiele erläutert.
2 Der Teufelskreis alter Lösungsansätze
Dieses Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen, die sich aus traditionellen Lösungsansätzen ergeben. Es analysiert die Schwierigkeiten, die aus dem traditionellen Top-down-Prinzip der Qualitätssicherung und -entwicklung resultieren. Darüber hinaus werden die Auswirkungen von veralteten Management- und Leadership-Modellen auf die Schulentwicklung beleuchtet.
3 Fallbeispiel: Fragen eines Schulleiters
Dieses Kapitel präsentiert ein Fallbeispiel, das die konkreten Herausforderungen eines Schulleiters in der Praxis veranschaulicht. Es zeigt die komplexen Anforderungen, die an Schulleitungen gestellt werden, und illustriert die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes bei der Bewältigung dieser Herausforderungen.
4 Fallbeispiel: Schwierigkeiten einer Schule
Dieses Kapitel stellt ein weiteres Fallbeispiel vor, das die Schwierigkeiten einer Schule im Kontext von Leadership und Change-Management beleuchtet. Es beleuchtet die Herausforderungen, die aus der mangelnden Integration von Management- und Leadership-Aspekten resultieren. Es werden die Folgen von fehlender Schulentwicklung, mangelnder Personalentwicklung und unzureichender Qualitätssicherung aufgezeigt.
5 Lösungsansätze
Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Lösungsansätze für die Herausforderungen, die in den vorherigen Kapiteln beschrieben wurden. Es schlägt innovative Management- und Leadership-Modelle vor, die auf den Prinzipien der Eigenverantwortlichkeit, der Partizipation und der kontinuierlichen Weiterentwicklung basieren. Es werden konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Schulentwicklung, der Personalentwicklung und der Qualitätssicherung vorgestellt.
Schlüsselwörter
Moderne Schulleitung, Leadership, Change-Management, Schulentwicklung, Personalentwicklung, Unterrichtsentwicklung, Qualitätssicherung, Management, Lernende Organisation, Praxisbeispiele, Fallbeispiele, Lösungsansätze, Top-down-Prinzip, Bottom-up-Prinzip, Eigenverantwortlichkeit, Partizipation.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Aufgabenfelder einer modernen Schulleitung?
Dazu gehören Management-, Leadership-, pädagogische Aufgaben sowie die Schulentwicklung, Personalentwicklung und Qualitätssicherung.
Was bedeutet „Change Management“ im Schulkontext?
Es beschreibt den Prozess der bewussten Veränderung und Anpassung der Schule an gesellschaftliche Anforderungen, weg von rein administrativen Strukturen hin zur lernenden Organisation.
Was ist der „Teufelskreis alter Lösungsansätze“?
Die Arbeit kritisiert damit starre Top-down-Prinzipien der Qualitätssicherung, die oft wirkungslos bleiben, wenn sie die Eigenverantwortlichkeit der Lehrkräfte nicht einbeziehen.
Warum ist Personalentwicklung für Schulen wichtig?
Sie ist essenziell für die Entwicklung einer lernenden Organisation, in der Lehrer kontinuierlich weitergebildet werden, um die Unterrichtsqualität zu sichern.
Was ist der Unterschied zwischen Management und Leadership bei Schulleitern?
Management bezieht sich eher auf Verwaltung und Organisation, während Leadership die Vision, Motivation und Führung von Menschen zur Schulentwicklung betont.
- Arbeit zitieren
- Ron Klug (Autor:in), 2012, Leadership und Change Management, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193379