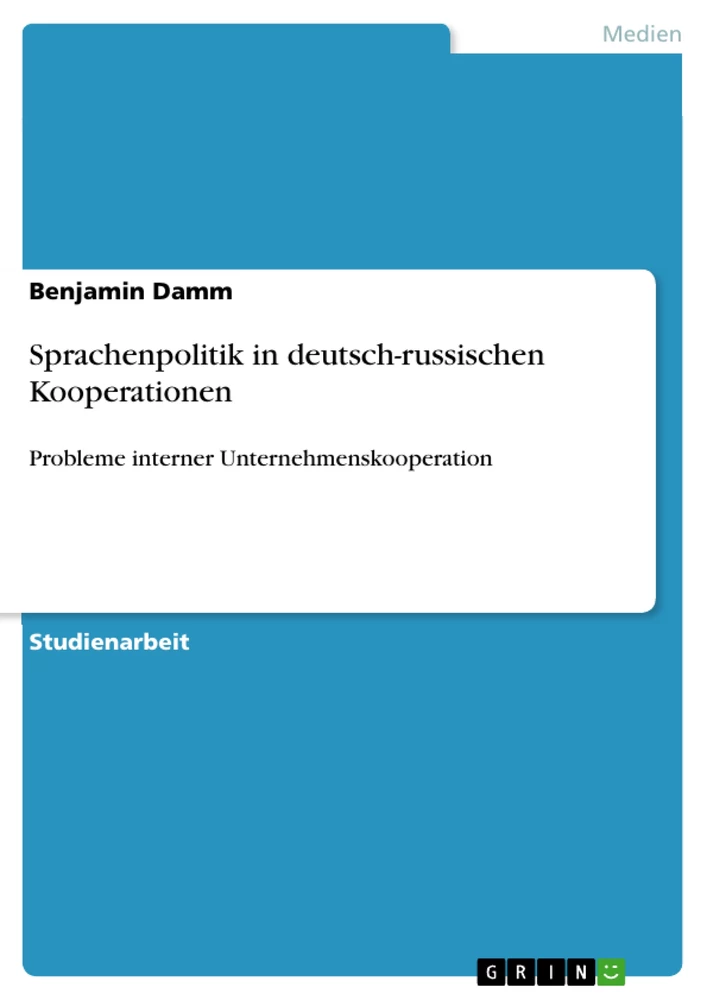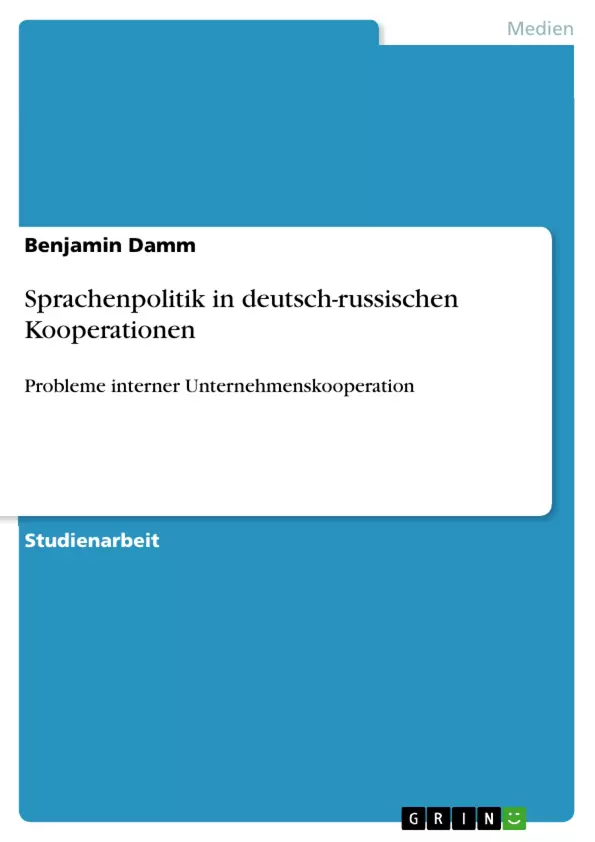Die Kommunikation im Unternehmen, sei es mit Kunden, Partnern oder Mitarbeitern ist ein wichtiges Instrument moderner Unternehmensführung. Denn ohne eine effiziente Kommunikation können strategisch wichtige Handlungen und Entscheidungen falsch oder gar nicht ausgeführt werden. Dieser Umstand stellt vor allem internationalisierte Unternehmen vor neue Herausforderungen. Bei der Zusammenarbeit von Mitarbeitern aus verschiedenen Kulturen mit verschiedenen Sprachkenntnissen ist neben der bloßen Nicht-Kenntnis der Sprache des Gegenübers auch die Gefahr gegeben, dass Aussagen aufgrund von routiniertem Kommunikationsverhalten missverstanden werden. Dabei läuft nicht nur ein Projekt oder Vorhaben Gefahr zu misslingen. Auch das Geschäftsklima wird wesentlich von einer möglichst verständigen Kommunikation bestimmt. Deshalb sind vor allem Unternehmen die im internationalen Bereich tätig sind, auf eine wohl durchdachte Sprachenpolitik angewiesen.
Dass Probleme dieser Art in Kooperationen mit ausländischen Unternehmen bestehen, ist bekannt. So auch im Geschäft zwischen deutschen und russischen Unternehmenspartnern. Die Frage, die allerdings eine solche Konfrontation mit sich bringt, ist die nach der konkreten Gestaltung der Sprachenpolitik im deutsch-russischen Unternehmen. Hierbei existieren die verschiedensten Möglichkeiten zur Gestaltung der Sprachenpolitik im ausländischen Unternehmen. Allerdings haben alle Möglichkeiten ihre Vor- und Nachteile, die es abzuwägen gilt, besonders in Bezug auf die individuellen Gegebenheiten des russischen Marktes. In dieser Arbeit sollen daher die Möglichkeiten der Gestaltung der Sprachpolitik speziell auf den Bereich deutsch-russischer Unternehmenskooperationen angewendet werden. Dabei wird auf die Spezifik des Kommunikationsverhaltens der beiden Kulturen eingegangen und wie diesen adäquaterweise begegnet werden könnte. Es folgen hierzu Praxisbeispiele, die Probleme und Lösungsansätze interkultureller Zusammenarbeit aufzeigen sollen.
Denn es gilt in der Geschäftswelt ein Grundsatz, der durch folgendes Zitat gut auf den Punkt gebracht werden kann: „Was sich nicht kommunizieren lässt, lässt sich nicht realisieren.“ Und das gilt insbesondere für die Geschäftstätigkeit im Ausland. Und letztendlich stehen hinter Interessen zur Erschaffung eines optimalen Unternehmensklimas auch immer ökonomische Interessen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Sprachenpolitik im Unternehmen
- 2.1 Die Begriffe Sprachpolitik und Unternehmenskommunikation
- 2.2 Die Relevanz der Sprachpolitik im Unternehmen
- 3. Die Sprachwahl im Unternehmen
- 3.1 Die Auswahl einer Sprache
- 3.1.1 Die Heuristik der Einsprachigkeit
- 3.1.2 Interkulturelle Kompetenz
- 3.1.3 Übersetzungsfehler
- 3.2 Die Auswahl mehrerer Sprachen
- 3.2.1 Der Einsatz von Dolmetschern
- 3.2.2 Der polyglotte Dialog
- 3.3 Verkehrs- und Reduktionssprachen
- 3.3.1 Lingua Franca - Englisch als Verkehrssprache
- 3.3.2 Russisch als Lingua Franca
- 4. Rechtliche Vorschriften
- 5. Fallanalysen
- 6. Implikationen und Fazit
- Die Bedeutung der Sprachenpolitik für die interne und externe Unternehmenskommunikation
- Die Herausforderungen der Sprachwahl in multinationalen Unternehmen mit besonderem Blick auf deutsch-russische Kooperationen
- Die Rolle der interkulturellen Kompetenz und die Vermeidung von Missverständnissen in der Kommunikation
- Die Analyse von Praxisbeispielen, um Probleme und Lösungsansätze in der interkulturellen Zusammenarbeit aufzuzeigen
- Die Relevanz der Sprachenpolitik für die Erschaffung einer positiven Unternehmenskultur und das Erreichen von ökonomischen Zielen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Sprachenpolitik in deutsch-russischen Unternehmenskooperationen und analysiert die Probleme, die im Bereich der internen Unternehmenskommunikation auftreten können. Der Fokus liegt auf der Gestaltung einer effektiven Sprachpolitik, die die Besonderheiten der beiden Kulturen berücksichtigt und eine reibungslose Zusammenarbeit ermöglicht.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema der Sprachenpolitik in deutsch-russischen Unternehmenskooperationen ein und beleuchtet die Relevanz einer effizienten Kommunikation für den Unternehmenserfolg. Die Kapitel 2 und 3 befassen sich mit den grundlegenden Begriffen der Sprachenpolitik und Unternehmenskommunikation und analysieren die verschiedenen Aspekte der Sprachwahl in multinationalen Unternehmen. Kapitel 4 befasst sich mit den rechtlichen Vorgaben, die im Bereich der internen Unternehmenskommunikation relevant sind.
Schlüsselwörter
Sprachenpolitik, Unternehmenskommunikation, deutsch-russische Kooperationen, interkulturelle Kompetenz, Sprachwahl, Missverständnisse, Unternehmenskultur, Transaktionskosten, Lingua Franca.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Sprachenpolitik in einem Unternehmen?
Sprachenpolitik umfasst alle gezielten Maßnahmen und Regeln zur Gestaltung der internen und externen Kommunikation in einer Organisation, insbesondere bei der Wahl der Arbeitssprachen in multinationalen Kontexten.
Warum ist Sprachenpolitik für deutsch-russische Kooperationen wichtig?
Da unterschiedliche Kulturen und Sprachkenntnisse aufeinandertreffen, hilft eine klare Sprachenpolitik dabei, Missverständnisse zu vermeiden und strategische Entscheidungen effizient umzusetzen.
Was sind die Risiken einer fehlenden Sprachregelung?
Ohne klare Regelung drohen Kommunikationsverluste, eine Verschlechterung des Geschäftsklimas und das Scheitern von Projekten aufgrund von Fehlinterpretationen routinierter Verhaltensweisen.
Welche Rolle spielt Englisch als Lingua Franca in der Kooperation?
Englisch dient oft als neutrale Verkehrssprache, hat jedoch Nachteile wie den Verlust von Nuancen oder die Benachteiligung von Mitarbeitern mit geringeren Englischkenntnissen.
Was ist der "polyglotte Dialog"?
Beim polyglotten Dialog nutzt jeder Beteiligte seine Muttersprache, während die anderen Teilnehmer diese zumindest passiv verstehen, was die Ausdrucksstärke erhöht.
Wie beeinflusst interkulturelle Kompetenz die Sprachwahl?
Interkulturelle Kompetenz ermöglicht es, über die reine Übersetzung hinaus die kulturellen Kontexte von Aussagen zu verstehen und somit die Sprachenpolitik adäquat an den Markt anzupassen.
- Arbeit zitieren
- Benjamin Damm (Autor:in), 2012, Sprachenpolitik in deutsch-russischen Kooperationen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193456