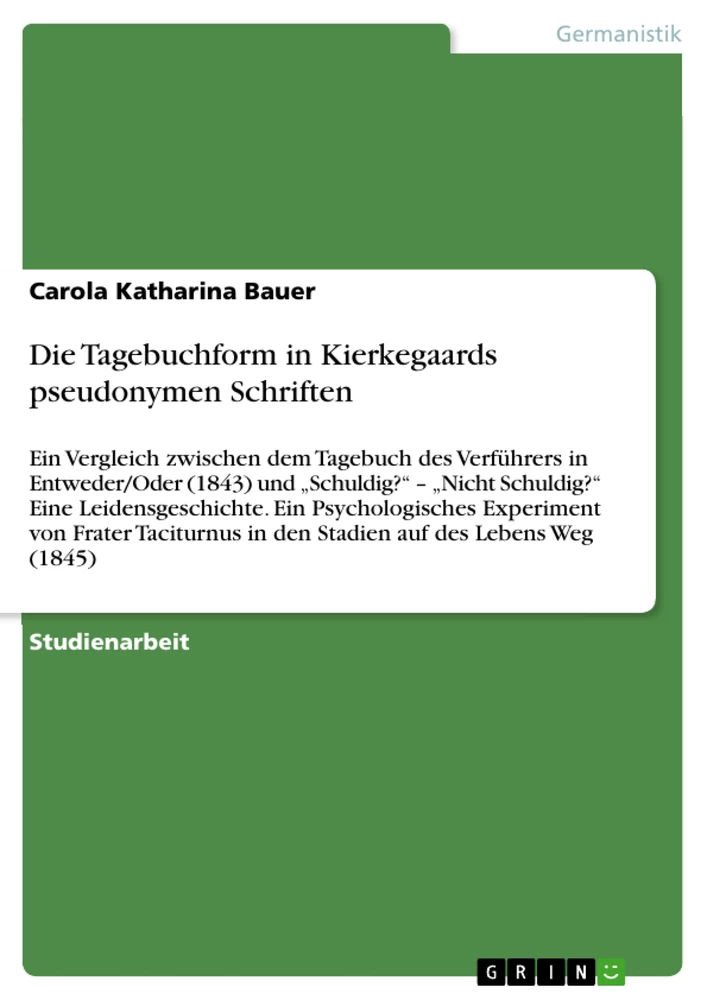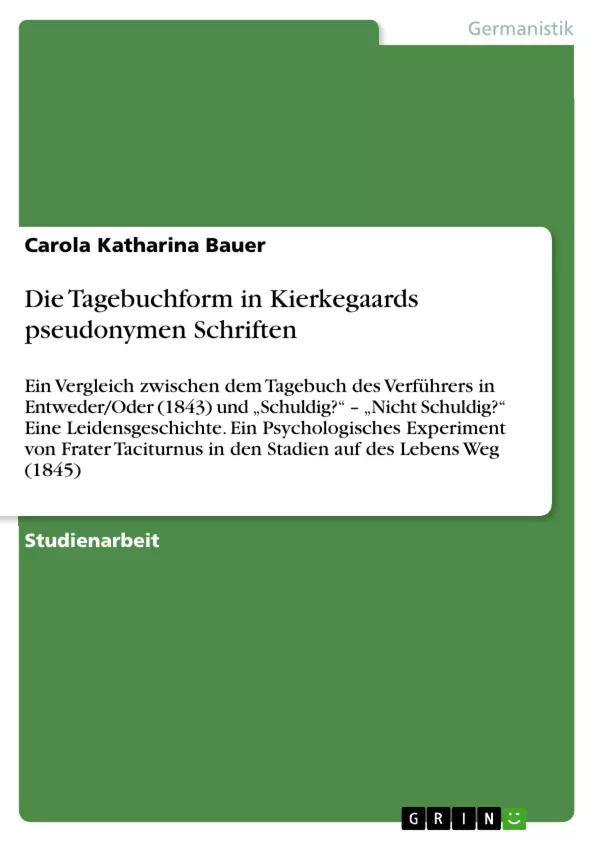„Sören Kierkegaard verwendet mit Vorliebe die Aussageform des Tagebuchs.“
Derart äußert sich der Literaturwissenschaftler Albert Gräser in seinem Werk Das literarische Tagebuch über den Stellenwert der Tagebuchform in Sören Kierkegaards philosophischen Schriften und führt die so behauptete Präferenz des Philosophen auf die frühe Isolation Kierkegaards zurück, die diesen für diese Mitteilungsform prädisponiert hätte. Betrachtet man allerdings das Gesamtwerk des Dänen, das sich durch eine „– gemessen an der literarischen Gestalt philosophischen oder theologischen Schrifttums – ungewöhnliche Vielfalt der Darstellungsformen auszeichnet“, kann dieser Aussage nur bedingt zugestimmt werden: Kierkegaard verwendet in seinen philosophischen Schriften eine Vielzahl unterschiedlichster Textarten – u.a. Briefe, Aphorismen und Reden –, so dass die Tagebuchform nur in einem sehr geringem Maß Anwendung findet. Umso wichtiger erscheint es daher, die Bedeutung der Tagebuchform in Kierkegaards Werken einer kritischen Neubewertung zu unterziehen: Ausgehend von den zwei prominenten Beispielen, in welchem Kierkegaard diese literarische Gattung verwendet – dem Tagebuch des Verführers in Entweder/Oder und dem Tagebuch des Quidam in den Stadien auf des Lebens Weg –, sollen die Funktion und der Stellenwert dieser Aussageform für das philosophische Schaffen Kierkegaards in dieser Seminararbeit untersucht werden. Unter der Annahme, dass sich das Diarium – ob privat oder öffentlich, fiktiv oder autobiographisch – einer einfachen Beschreibung oder Kategorisierung entzieht und – trotz bestimmter gattungstypischer Merkmale wie der Strukturierung durch Kalenderdaten und der täglichen Berichterstattung in Einzeleinträgen – sehr unterschiedliche Formen annehmen kann, wird dabei insbesondere die spezifische Verwendung dieser Textsorte bei Kierkegaard im Zentrum der Darstellung stehen. Aufgrund der Tatsache, dass es sich sowohl bei dem Tagebuch des Quidam als auch dem Tagebuch des Verführers um fingierte Tagebücher handelt, welche die dem Diarium eigentümlichen Züge als bewusstes Stilmittel zur Ausgestaltung einer fiktiven Erzählung imitieren, erscheint es besonders sinnvoll, den jeweiligen Umgang mit der Form auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- Aufgabenstellung und Leitfragen
- Philosophischer Kontext und Methodik: Die Gesamtkonzeption von Entweder/Oder und den Stadien auf des Lebens Weg
- Die Entwicklung der Stadienlehre in Entweder/Oder und den Stadien
- Die ,Maieutik' Kierkegaards und das Programm der ,Indirekten Mitteilung'
- Das Tagebuch des Verführers in Entweder/Oder und das Tagebuch des Quidam in den Stadien - Ein Vergleich
- Unterschiede in Bezug auf Aufbau, Gestaltung und Inhalt der Diarien eines Ästhetikers und einer Existenz in Richtung des Religiösen
- Das Verhältnis von Authentizität und Fiktionalität im Tagebuch des Verführers und den Aufzeichnungen Quidams in „Schuldig?“ - „Nicht Schuldig?“
- Kritik und Kommentar an der ethischen/ ästhetischen Existenz: Die Durchbrechung des monoperspektivischen Charakters des Tagebuchs
- Resümee: Die Funktion der Tagebuchform in Kierkegaards pseudonymen Schriften
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Funktion und den Stellenwert der Tagebuchform in Sören Kierkegaards philosophischen Schriften. Anhand der prominenten Beispiele des Tagebuchs des Verführers in Entweder/Oder und des Tagebuchs des Quidam in den Stadien auf des Lebens Weg wird die spezifische Verwendung dieser Textsorte bei Kierkegaard beleuchtet. Dabei stehen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Umgang mit der Form im Zentrum der Darstellung. Die Arbeit berücksichtigt auch die philosophisch-theologischen Interpretationszusammenhänge, die für eine adäquate Bewertung des Stellenwerts der Texte von essentieller Notwendigkeit erscheinen.
- Die Rolle der Tagebuchform in Kierkegaards philosophischen Schriften
- Der Vergleich der Tagebücher des Verführers und des Quidam
- Die Bedeutung von Authentizität und Fiktionalität in den Tagebüchern
- Die Funktion der Tagebücher im Kontext der Stadienlehre
- Die Bedeutung der Tagebücher für die philosophische und theologische Interpretation von Kierkegaards Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit stellt die Aufgabenstellung und die Leitfragen vor. Es wird die Relevanz der Tagebuchform in Kierkegaards Werk diskutiert und die Forschungsfrage formuliert. Kapitel zwei beleuchtet den philosophischen Kontext und die Methodik der Gesamtkonzeption von Entweder/Oder und den Stadien auf des Lebens Weg. Es wird die Entwicklung der Stadienlehre Kierkegaards vorgestellt und das Programm der ,Indirekten Mitteilung' erläutert. Kapitel drei vergleicht das Tagebuch des Verführers in Entweder/Oder mit dem Tagebuch des Quidam in den Stadien. Es werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Bezug auf Aufbau, Gestaltung und Inhalt der Diarien eines Ästhetikers und einer Existenz in Richtung des Religiösen herausgearbeitet. Zudem wird das Verhältnis von Authentizität und Fiktionalität in den Tagebüchern beleuchtet. In Kapitel drei wird auch die Kritik und der Kommentar an der ethischen/ästhetischen Existenz betrachtet. Es wird untersucht, wie die Tagebuchform die Durchbrechung des monoperspektivischen Charakters ermöglicht.
Schlüsselwörter
Kierkegaard, Tagebuch, Entweder/Oder, Stadien auf des Lebens Weg, Verführer, Quidam, Ästhetik, Ethik, Religion, Authentizität, Fiktionalität, Indirekte Mitteilung, Stadienlehre.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Stellenwert hat die Tagebuchform in Kierkegaards Gesamtwerk?
Obwohl Kierkegaard die Tagebuchform gerne nutzt, macht sie im Vergleich zu anderen Textarten wie Briefen, Aphorismen oder Reden nur einen geringen Teil seines umfangreichen Gesamtwerks aus.
Was sind die bekanntesten Beispiele für Tagebücher in seinen Schriften?
Die zwei prominentesten Beispiele sind das „Tagebuch des Verführers“ aus dem Werk „Entweder/Oder“ und das „Tagebuch des Quidam“ aus „Stadien auf des Lebens Weg“.
Warum verwendet Kierkegaard fiktive Tagebücher?
Kierkegaard nutzt die Form des fingierten Tagebuchs als bewusstes Stilmittel der „indirekten Mitteilung“, um existenzielle und philosophische Zustände (ästhetisch vs. religiös) aus einer Innenperspektive darzustellen.
Was ist das Konzept der „Maieutik“ bei Kierkegaard?
Die Maieutik (Hebammenkunst) bezieht sich auf seine Methode, den Leser nicht direkt zu belehren, sondern ihn durch indirekte Mitteilungen und Pseudonyme dazu zu bringen, Wahrheiten selbst zu „gebären“.
Wie unterscheiden sich die Tagebücher des Verführers und des Quidam?
Das Tagebuch des Verführers repräsentiert die ästhetische Existenzweise, während das Tagebuch des Quidam eine Existenz in Richtung des Religiösen und die Auseinandersetzung mit Schuld thematisiert.
Was versteht Kierkegaard unter der „Stadienlehre“?
Die Stadienlehre beschreibt verschiedene Ebenen der menschlichen Existenzentwicklung, meist unterteilt in das ästhetische, das ethische und das religiöse Stadium.
- Arbeit zitieren
- Carola Katharina Bauer (Autor:in), 2009, Die Tagebuchform in Kierkegaards pseudonymen Schriften, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193458