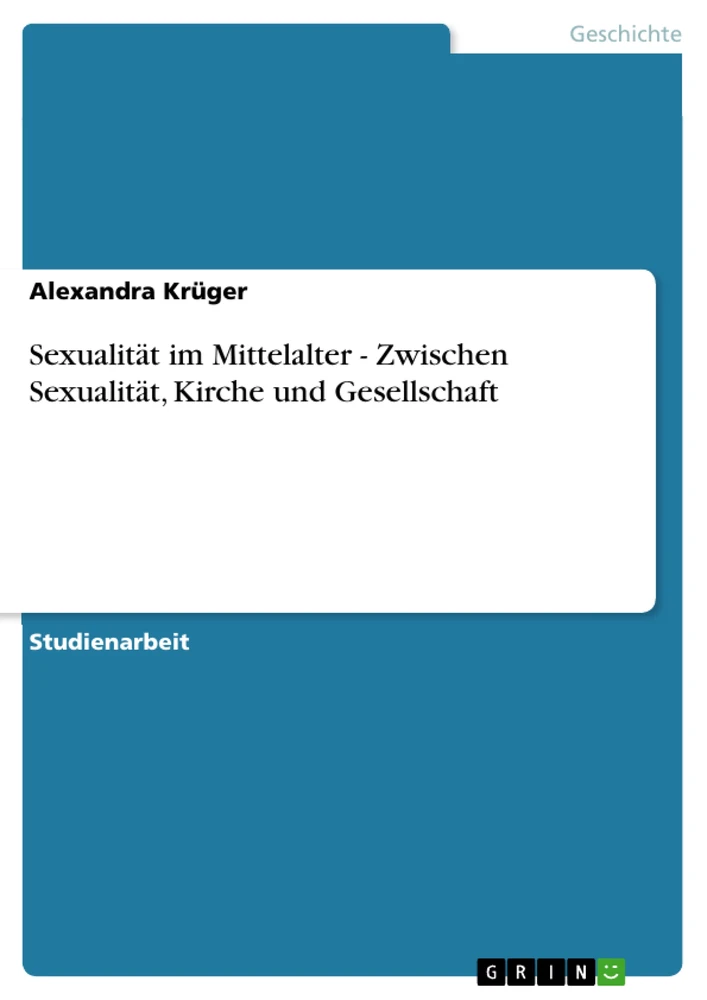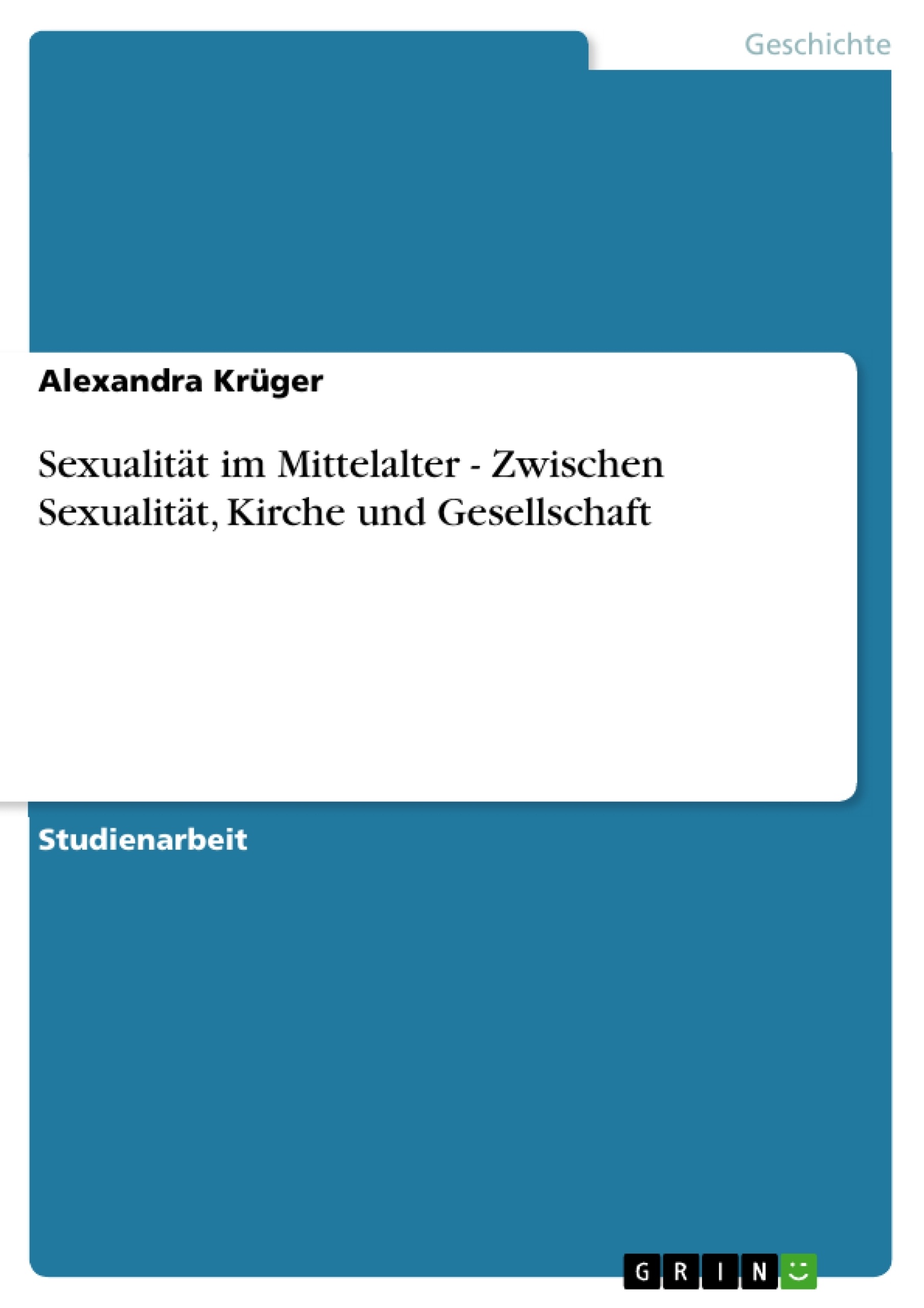Die christliche Kirche, die im Mittelalter eine sehr große Rolle im Alltagsleben der Menschen spielte, predigte Enthaltsamkeit und Keuschheit. Jungfräulichkeit wurde als Ideal für ehrbare Frauen angesehen und der sexuelle Akt galt als schmutzig. Er wurde nur zum Zwecke der Fortpflanzung toleriert.
So scheint das vom Glauben geprägte Mittelalter in Verbindung mit Sexualität ausgesehen zu haben. Doch wie war es wirklich? Konnten die Menschen ihre sexuellen Triebe einfach so abschalten, wobei Sexualität heutzutage doch etwas so Natürliches ist. Und steht die Auffassung, dass Sex etwas Unnatürliches ist nicht im Widerspruch mit der Forderung „Seid fruchtbar und mehret euch!“ aus dem ersten Buch Mose? Was forderte die Kirche und was die Gesellschaft? Wie konnte dies im Alltag umgesetzt werden?
Dies sind nur einige Fragen, die diese Arbeit versucht zu klären. Interessant ist hierbei zweifelsohne auch der Akt an sich. Wie schliefen die Menschen miteinander, wenn ihnen doch bewusst gewesen sein muss, dass dies als eine Sünde galt? Doch ganz so keusch wie man glaubt, war das Mittelalter nicht. Hätten die Menschen im Mittelalter nicht ihren sexuellen Trieben nachgegeben, dann wären auch keine Kinder mehr geboren worden und das ist nach der heutigen Bevölkerung in Europa zu beurteilen, nicht so gewesen.
Wie bei jeder historischen Arbeit, stellt sich auch hier die Frage der Quellen. Woher erhält man Informationen über das Intimste der Menschen? Dies soll im zweiten Kapitel geklärt werden. Die unterschiedlichen Quellenarten werden vorgestellt und bewertet. Hierbei sollen sich die Ausführungen vor allem auf die Arbeit von Thomas Bein von 2003 stützen.
Im darauffolgenden Kapitel soll es schließlich um die Kernfragen gehen. Das Zusammenspiel von Kirche, Gesellschaft und Sexualität wird beleuchtet. Der sexuelle Akt an sich – außerhalb und innerhalb der Ehe – sowie die Einstellung der Kirche und der Gesellschaft dem gegenüber. Die Abhandlungen „Sexualität im Mittelalter“ von Ruth Mazo Karras (2006) und Jean Verdons „Irdische Lust – Liebe, Sex und Sinnlichkeit im Mittelalter“ aus dem Jahre 2011 bieten hierbei einen detaillierten Einblick.
Am stärksten geächtet wurde im Mittelalter Homosexualität, weshalb sich Kapitel 3.2. dieser Thematik widmen soll, um auch einen kleinen Einblick über die heterogeschlechtliche Sexualität hinaus zu bieten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Quellen
- Lyrik
- Epik
- Theologische Texte
- Medizinische Texte
- Sexualität im Mittelalter
- Sexualität, Kirche und Gesellschaft
- Sexualität innerhalb der Ehe
- Sexualität außerhalb der Ehe
- Homosexualität
- Resümee
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Rolle von Sexualität im Mittelalter und beleuchtet das komplexe Zusammenspiel zwischen sexuellen Praktiken, kirchlichen Doktrinen und gesellschaftlichen Normen. Sie untersucht, wie die Menschen im Mittelalter mit ihrer eigenen Sexualität und den Ansichten der Kirche umgingen.
- Die Rolle der christlichen Kirche im mittelalterlichen Alltagsleben und ihre Haltung zur Sexualität.
- Die verschiedenen Quellen, die Einblicke in die Sexualität im Mittelalter bieten, wie z.B. Lyrik, Epik, theologische Texte und medizinische Texte.
- Die verschiedenen Formen der sexuellen Praxis innerhalb und außerhalb der Ehe, einschließlich der gesellschaftlichen und kirchlichen Reaktionen auf diese Praktiken.
- Die besondere Stigmatisierung von Homosexualität im Mittelalter.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung dieser Arbeit stellt die zentralen Fragestellungen und die wichtigsten Quellen für die Erforschung von Sexualität im Mittelalter vor. Sie beleuchtet den Spannungsbogen zwischen der kirchlichen Forderung nach Enthaltsamkeit und Keuschheit und der tatsächlichen sexuellen Praxis im Mittelalter.
Das zweite Kapitel widmet sich der Analyse der wichtigsten Quellen für das Thema, darunter die Lyrik des Mittelalters, besonders der Minnegesang, sowie epische Texte. Es stellt die unterschiedlichen Quellenarten vor und bewertet ihre Aussagekraft für die Erforschung von Sexualität im Mittelalter.
Das dritte Kapitel analysiert das komplexe Zusammenspiel von Kirche, Gesellschaft und Sexualität im Mittelalter. Es beleuchtet die verschiedenen Formen der sexuellen Praxis innerhalb und außerhalb der Ehe, einschließlich der gesellschaftlichen und kirchlichen Reaktionen auf diese Praktiken.
Das vierte Kapitel widmet sich der Analyse der Stigmatisierung von Homosexualität im Mittelalter. Es behandelt die gesellschaftlichen und kirchlichen Reaktionen auf homosexuelle Praktiken im mittelalterlichen Kontext.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Sexualität, Kirche, Gesellschaft, Mittelalter, Lyrik, Epik, Theologie, Medizin, Enthaltsamkeit, Keuschheit, Ehe, Homosexualität, und die Analyse mittelalterlicher Quellen.
Häufig gestellte Fragen
Wie sah das kirchliche Ideal der Sexualität im Mittelalter aus?
Die Kirche predigte Enthaltsamkeit und Keuschheit. Sexualität galt als "schmutzig" und wurde nur innerhalb der Ehe zum Zweck der Fortpflanzung toleriert.
War das Mittelalter wirklich so keusch, wie oft angenommen?
Nein, historische Quellen belegen, dass die tatsächliche Praxis oft von den kirchlichen Forderungen abwich und Sexualität ein natürlicher Bestandteil des Lebens blieb.
Welche Quellen geben Aufschluss über das Intimleben dieser Zeit?
Wichtige Informationen stammen aus der Lyrik (Minnegesang), der Epik, sowie aus theologischen Bußbüchern und medizinischen Texten des Mittelalters.
Wie wurde Homosexualität im Mittelalter bewertet?
Homosexualität war im Mittelalter stark geächtet und wurde sowohl von der Kirche als auch von der Gesellschaft scharf sanktioniert.
Gab es Unterschiede zwischen Sexualität in und außerhalb der Ehe?
Ja, während der Beischlaf in der Ehe zur Fortpflanzung legitim war, galt außerehelicher Sex als schwere Sünde, wurde aber dennoch in verschiedenen gesellschaftlichen Schichten praktiziert.
- Arbeit zitieren
- B.A. Alexandra Krüger (Autor:in), 2012, Sexualität im Mittelalter - Zwischen Sexualität, Kirche und Gesellschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193475