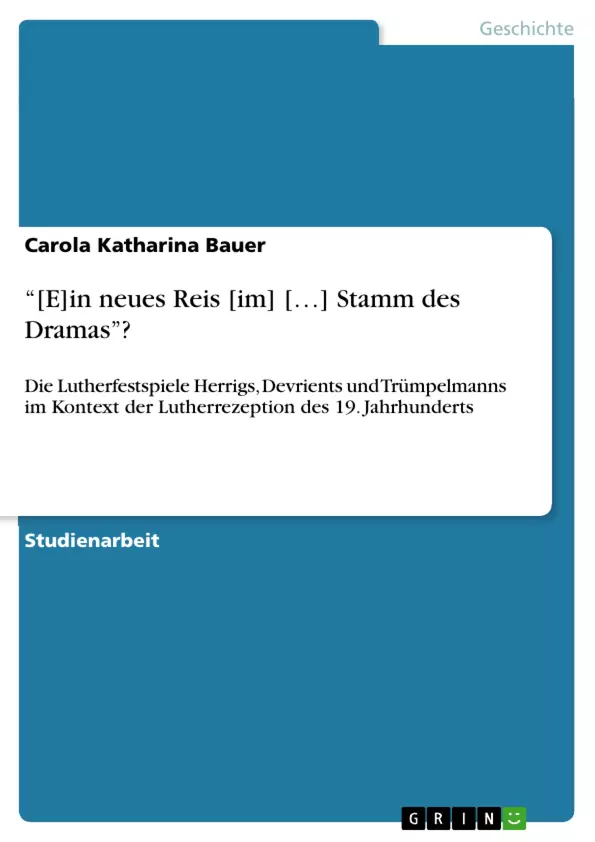Mit diesen Worten beschreibt der evangelische Theologe und Kirchenhistoriker Bernd Moeller die anhaltende Bedeutung Martin Luthers im kollektiven Gedächtnis der Deutschen.
Konzentriert wird die Wichtigkeit des Reformators im „klassischen Mythos von [Luther als] der Reformation in Person“3, dessen Entstehung Moeller auf die Selbststilisierung und den „Massenerfolg“ Luthers bereits zu Lebzeiten zurückführt.4 In der Tat beginnt die Verehrung des Reformators schon im späten 16. Jahrhundert, als Luther, u.a. aus Gründen der Bewahrung seiner Lehre, nicht nur als „heilige und vorbildliche Mittler- und Trägergestalt der christlichen Botschaft, sondern […] auch als ihr autoritativer […] Lehrer und Interpret“5
erinnert wird: Eine Tendenz zur Mythisierung Luthers taucht zudem früh in der protestantischen Volksfrömmigkeit auf, die beginnt mit Luther assoziierte Gegenstände analog zur katholischen Heiligenverehrung zu Reliquien mit Wunderkräften zu stilisieren.6
Doch Höhepunkt des kollektiven Luthergedenkens ist ohne Frage das 19. Jahrhundert, das mit seinem „Personalisierungsprogramm“ eine auf Verinnerlichung des protestantischen Glaubens abzielende Form der Memoria zugunsten eines veritablen Personenkultes um den ‚nationalen Heros‘ Luther verdrängt:7 Nicht umsonst liegt der Fokus eines Großteils der geschichtswissenschaftlichen Forschung zur Lutherrezeption auf dieser Zeitspanne.
[...]
3 Burkhardt, Johannes. Zitiert nach: Medick, Hans; Schmidt, Peer: Einleitung. Von der Lutherverehrung zur konfessionellen Lutherforschung und darüber hinaus. In: Medick, Hans; Schmidt, Peer (Hg.): Luther zwischen den Kulturen. Zeitgenossenschaft – Weltwirkung. Göttingen 2004, S.16.
4 Moeller: Luthers Erfolge, S.271.
5 Brockmann, Thomas: Vorbild, Lehrer und Prophet der letzten Zeit. Luthermemoria und Lutherrezeption 1546-1617. In: Historisches Jahrbuch (2009), S.63.
6 Vgl. Laube, Stefan: Der Kult um die Dinge an einem evangelischen Erinnerungsort. In: Laube, Stefan; Fix, Karl-Heinz (Hg.): Lutherinszenierung und Reformationserinnerung. (Schriften der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Band 2.) Leipzig 2002, S.14 f.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Akt: Einführung in Themenstellung, Forschungsstand und Vorgehensweise
- ,,Nichts und niemand auf der Welt hat bereits so viele Jubiläen erlebt wie Luther.“²
- 2. Akt: Glaubensheld, Nationalheld, Bürger: Der Wandel der Lutherrezeption im 19. Jahrhundert
- 2.1 Neue Tendenzen in der Luthermemoria
- ,,Übrigens war es das erste Mal, daß man den Geburtstag des Gottesmannes zum Gegenstand einer Feier für die evangelische Kirche machte. Bis dahin hatte man wohl die Gedenktage der Reformation selbst ausgezeichnet.“¹⁴
- 2.2 Luther im Kaiserreich und das Jubiläumsjahr 1883
- 3. Akt: Die Lutherfestspiele Herrigs, Devrients und Trümpelmanns im Kontext der Lutherrezeption des späten 19. Jahrhunderts
- 3.1 Der 400. Geburtstag Luthers und die ,Entstehung einer neuen Gattung‘
- 3.2 ,Volksbühnen‘, Familienväter und die ,soziale Frage‘: Die Lutherfestspiele als Repräsentationsmedien des (protestantischen) Bürgertums
- 3.3 Wormser Reichstag, deutsche Kaiser und deutsche Sagen - Luther als Nationalheld in den Lutherdramen Herrigs, Trümpelmanns und Devrients
- 3.4 Lüsterne Mönche und die Gefahren des Ultramontanismus: Antikatholizismus in den Lutherfestspielen
- 4. Akt: Resümee und Ausblick – Der Niedergang der Lutherfestspiele im 20. Jahrhundert
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hauptseminararbeit analysiert die Lutherfestspiele des späten 19. Jahrhunderts und untersucht, wie diese im Kontext der allgemeinen Luther-Rezeption und insbesondere der Jubiläumsfeiern zum 400. Geburtstag Luthers im Jahr 1883 zu verorten sind. Der Fokus liegt auf den Festspielen von Otto Devrient, Hans Herrig und August Trümpelmann sowie deren Inhalten, Aufführungspraktiken und Rezeption.
- Der Wandel der Luthermemoria im 19. Jahrhundert von der Verehrung des Reformators als „heilige und vorbildliche Mittler- und Trägergestalt der christlichen Botschaft“⁵ zu einem Personenkult um den „nationalen Heros Luther“
- Die Bedeutung des 400. Geburtstages Luthers im Jahr 1883 als Katalysator für die Entstehung der Lutherfestspiele
- Die Rolle der Lutherfestspiele als Repräsentationsmedien des (protestantischen) Bürgertums und deren Beitrag zur „soziale[n] Frage“
- Die Darstellung Luthers als Nationalheld und die Verbindung zu „deutschen Kaisern und deutschen Sagen“ in den Lutherdramen
- Der Antikatholizismus in den Lutherfestspielen und dessen Spiegelung des damaligen Zeitgeschehens
Zusammenfassung der Kapitel
Der 1. Akt stellt die Themenstellung und den Forschungsstand zu den Lutherfestspielen vor. Er beleuchtet die Bedeutung des Reformators im kollektiven Gedächtnis der Deutschen und den Wandel der Lutherrezeption im 19. Jahrhundert von der Verehrung als Glaubensheld hin zu einem Personenkult um den Nationalhelden Luther.
Der 2. Akt analysiert die neuen Tendenzen in der Luthermemoria im 19. Jahrhundert, insbesondere die Jubiläumsfeiern zum 400. Geburtstag Luthers im Jahre 1883. Er zeigt auf, wie diese Feiern ein allein mit der Person Luthers verbundenes Datum zu einem zentralen Ereignis der Reformationsgeschichte machten.
Der 3. Akt widmet sich den Lutherfestspielen Herrigs, Devrients und Trümpelmanns im Kontext der Lutherrezeption des späten 19. Jahrhunderts. Er untersucht die Entstehung der Gattung, die Rolle der Festspiele als Repräsentationsmedien des Bürgertums, die Darstellung Luthers als Nationalheld und den Antikatholizismus in den Werken.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Lutherfestspiele des 19. Jahrhunderts?
Es handelt sich um eine im späten 19. Jahrhundert entstandene Gattung von Dramen und Aufführungen, die Martin Luther als nationalen Helden verherrlichten.
Warum war das Jahr 1883 so bedeutend für die Lutherrezeption?
Es war das Jahr von Luthers 400. Geburtstag, das einen beispiellosen Personenkult und die Entstehung zahlreicher Festspiele auslöste.
Welche Autoren stehen im Fokus der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Festspiele von Otto Devrient, Hans Herrig und August Trümpelmann.
Welche Rolle spielte der Antikatholizismus in diesen Festspielen?
Die Stücke spiegelten den damaligen Zeitgeist wider, indem sie Luther als Kämpfer gegen den "Ultramontanismus" und die katholische Kirche darstellten.
Wie wandelte sich das Bild Luthers im 19. Jahrhundert?
Das Bild wandelte sich von einer religiösen Mittlergestalt hin zu einem "nationalen Heros", der die deutsche Identität verkörperte.
- Arbeit zitieren
- Carola Katharina Bauer (Autor:in), 2011, “[E]in neues Reis [im] […] Stamm des Dramas”? , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193478

![Titel: “[E]in neues Reis [im] […] Stamm des Dramas”?](https://cdn.openpublishing.com/thumbnail/products/193478/large.webp)