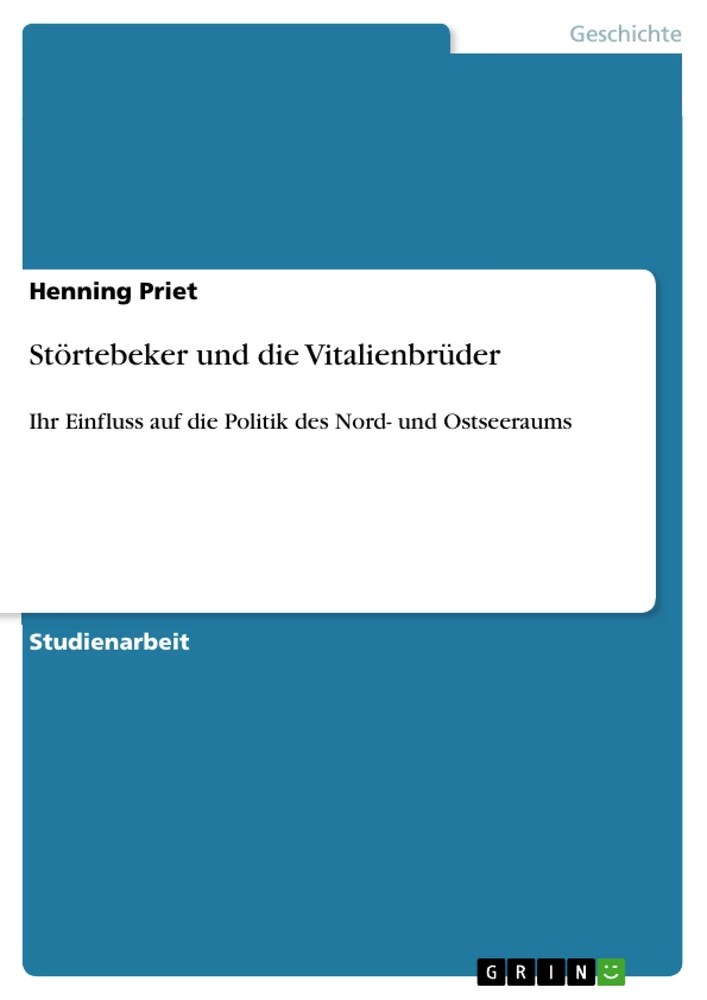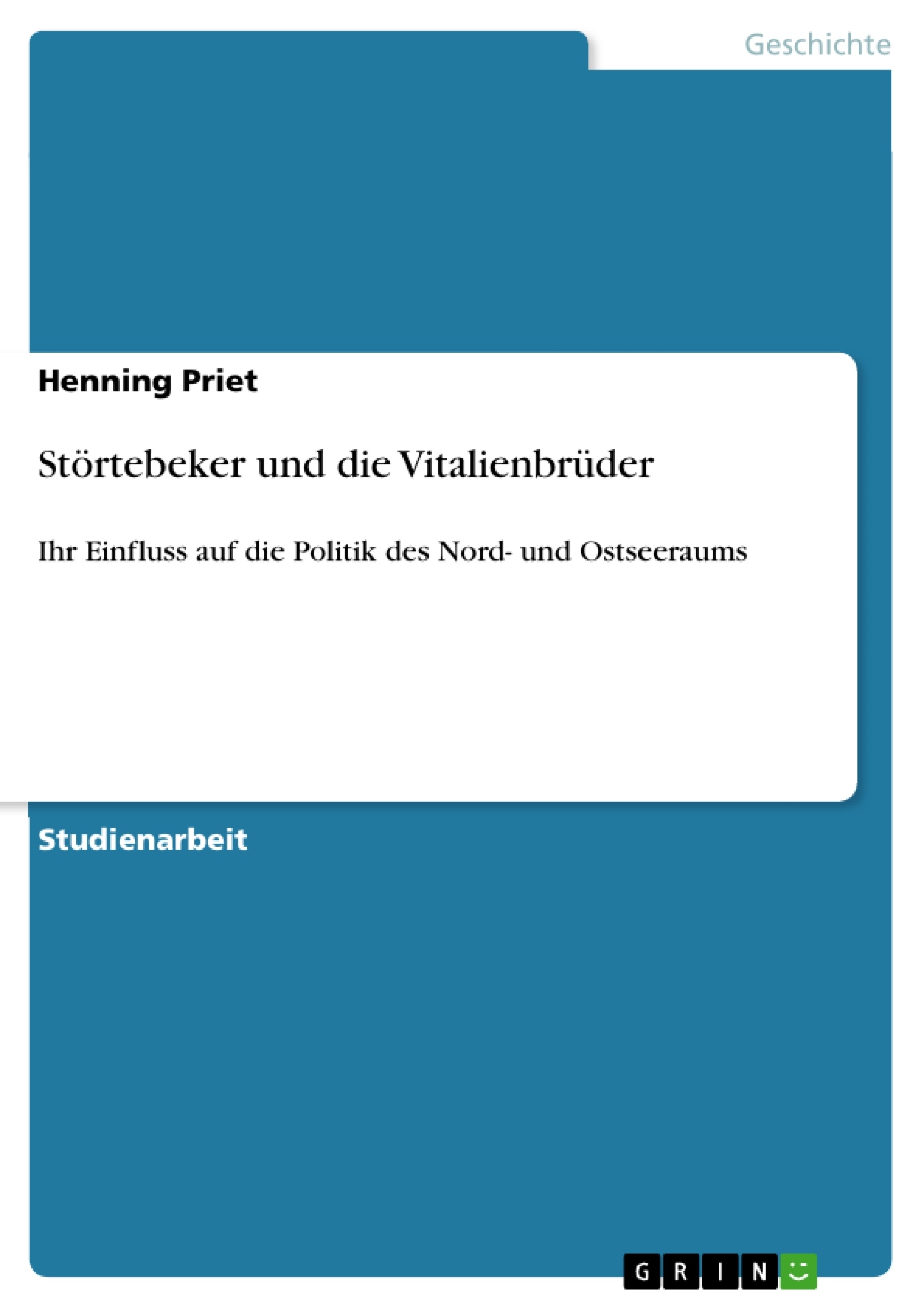Weder beginnt mit den Vitalienbrüdern die Seeräuberei in Nord- und Ostsee, noch hört sie mit ihnen auf. Dennoch hatte diese Bruderschaft einen größeren Einfluss auf Politik und Wirtschaft, als jede andere Piratengruppe vor oder nach ihnen. Dieser Einfluss hat eine enge Verknüpfung zwischen der Geschichte der Hanse, sowie der Nord- und Ostseeländer mit ihnen zur Folge. Dieses Beziehungsgeflecht und die Handlungsfelder der Vitalienbrüder zu beleuchten soll genauso Teil dieser Arbeit werden, wie die Beantwortung der Frage, ob die Historiografie sich hinsichtlich des Störtebeker Mythos von Inhalten der Sagen hat beeinflussen lassen. [...] Da das Thema dieser Arbeit Seeräuber, Piraten und Kaperfahrer sind, muss zunächst die Verwendung und Bedeutung dieser Begriffe geklärt werden. Im Gegensatz zum Begriff Raubritter ist der Terminus des Seeräubers ein Quellenbegriff. „Serovere“ oder „Se-rouber“ sind hier Personen die ohne staatliche Ermächtigung und aus eigener Initiative andere Schiffe überfallen. Nicht ganz im Gegensatz hierzu stehen die Kaperfahrer, welche von einer politischen Macht berechtigt wurden Schiffe zu überfallen. Da jedoch im Zusammenhang mit den Vitalienbrüdern ihre Tätigkeit nicht exakt auf Kaperfahrer oder Seeräuber festgelegt werden kann, sollen auch beide Begriffe in dieser Arbeit Verwendung finden. Ferner darf nicht vergessen werden, dass die Majorität der Quellen die Ereignisse aus Sicht der Hanse schildert, welche mit ihrer Propaganda gerne Gegner als Seeräuber diffamierte.4 [...] 4 Ulrich Andermann: Spätmittelalterlicher Seeraub als Kriminaldelikt und seine Bestrafung, in: Wilfried Ehbrecht (Hg.): Störtebeker. 600 Jahre nach seinem Tod, Trier, 2005, S. 23-36, hier: S. 24f.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Ostseeraum: Politik und Genesis der Vitalienbrüder
Nordseeraum: Friesland unter Einfluss der Vitalienbrüder
Vitalienbrüder – Name und Selbstverständnis
Seeräuber oder Kaperfahrer?
Vitalienbrüder - eine Bruderschaft?
Klaus oder Johann Störtebeker
Klaus
Johann
Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Einleitung
Im Emsland sehen sich Norden, Osteel und Siel als Geburtsorte von Störtebeker. Im Brookmerland wird er als Hamburger gesehen und in Verden als Edelmann aus Pommern bezeichnet. Dutzende Orte werben heute damit, dass in ihrer Stadt Störtebeker geboren wurde. Überdies gibt es regional sich differenzierende Geschichten über seinen Piratenschatz, Trinkfestigkeit und Liebesleben.[1] Es existieren ähnlich viele Varianten über sein Leben, wie über seinen Tod. Über seine Versuche sich freizukaufen von den Hamburgern und über sein letztes Kunststück, ohne Kopf an Kumpanen vorbei gestolpert zu sein und denen somit das Leben zu retten, gibt es in jeder Region andere Versionen.[2] Störtebeker gehörte zu den Vitalienbrüdern, einer Art Seeräuberorganisation.
Weder beginnt mit den Vitalienbrüdern die Seeräuberei in Nord- und Ostsee, noch hört sie mit ihnen auf. Dennoch hatte diese Bruderschaft einen größeren Einfluss auf Politik und Wirtschaft, als jede andere Piratengruppe vor oder nach ihnen. Dieser Einfluss hat eine enge Verknüpfung zwischen der Geschichte der Hanse, sowie der Nord- und Ostseeländer mit ihnen zur Folge.[3] Dieses Beziehungsgeflecht und die Handlungsfelder der Vitalienbrüder zu beleuchten soll genauso Teil dieser Arbeit werden, wie die Beantwortung der Frage, ob die Historiografie sich hinsichtlich des Störtebeker Mythos von Inhalten der Sagen hat beeinflussen lassen.
In Bezug auf die Vitalienbrüder wird nach Erörterung ihrer Entstehung im Ostseeraum und ihrer Wirkung auf die politische Landschaft in Friesland, versucht ihr umstrittener Name und Charakter ihrer Bruderschaft darzulegen. Es gibt keine Egoquellen der Vitalienbrüder oder sonstige schriftliche Hinterlassenschaften aus ihrer Feder, lediglich Dokumente von ihren Gegnern, der Hanse und den Herrschaftshäusern. Dieser Mangel an Quellen ist ein Grund dafür, dass Störtebeker mehr als Sagengestalt, denn als historische Figur bekannt ist. Dies ist Anlass abschließend zu diskutieren, ob Klaus Störtebeker eine mit historischen Quellen nachweisbare Person war.
Da das Thema dieser Arbeit Seeräuber, Piraten und Kaperfahrer sind, muss zunächst die Verwendung und Bedeutung dieser Begriffe geklärt werden. Im Gegensatz zum Begriff Raubritter ist der Terminus des Seeräubers ein Quellenbegriff. „Serovere“ oder „Se-rouber“ sind hier Personen die ohne staatliche Ermächtigung und aus eigener Initiative andere Schiffe überfallen. Nicht ganz im Gegensatz hierzu stehen die Kaperfahrer, welche von einer politischen Macht berechtigt wurden Schiffe zu überfallen. Da jedoch im Zusammenhang mit den Vitalienbrüdern ihre Tätigkeit nicht exakt auf Kaperfahrer oder Seeräuber festgelegt werden kann, sollen auch beide Begriffe in dieser Arbeit Verwendung finden. Ferner darf nicht vergessen werden, dass die Majorität der Quellen die Ereignisse aus Sicht der Hanse schildert, welche mit ihrer Propaganda gerne Gegner als Seeräuber diffamierte.[4]
Ostseeraum: Politik und Genesis der Vitalienbrüder
In der zweiten Hälfte des 14ten Jahrhunderts gehörten etwa 80 Städte zur Hanse. Nachdem der dänische König Waldemar IV. Visby auf Gotland angegriffen hatte, plünderte eine hansische Flotte unter dem Bürgermeister von Lübeck, Johann Wittenborg, Kopenhagen. Visby, zu jener Zeit das Zentrum der Hanse, zerstört durch einen herrschaftlichen Gewaltakt, musste von der Hanse als kriegerische Provokation verstanden werden. Der Flotte gelang es jedoch nicht das bedeutende Wirtschaftsgebiet Schonen zu kontrollieren, sodass es 1363 zu einem Waffenstillstand kam.[5] Kurze Zeit später stieg die Hanse dann zu einer nordeuropäischen Großmacht auf. Mit der Kölner Konföderation (1367) schloss sich die Hanse mit anderen Gegnern Dänemarks zusammen. Dänemark führte währenddessen mit Schweden Krieg um Schonen, welches ein bedeutender Handelspartner der Hanse war.[6] Erst acht Jahre später erreichte die Koalition bei einem erneuten Krieg (hansische Flotten und plünderten große Teile der norwegischen und dänischen Küste) einen Sieg und die Kriegsparteien schlossen den Frieden von Stralsund (24.05.1370), welcher die Herrschaft von Albrecht von Mecklenburg über Schweden nicht änderte und der Hanse in Schonen sehr profitable Handelsprivilegien zugestand.[7] In diesen zwei Kriegen wurde die Hanse, als Bündnis von Städten, zum Machtfaktor in Nordeuropa.
Waldemar IV. starb 1375 und der König von Schweden (Albrecht v. Mecklenburg) versuchte nun sich des dänischen Thrones zu bemächtigen.
Waldemar Atterdag IV. hinterließ zwei Töchter, Ingeborg und die jüngere Margarete, welche beide außerhalb Dänemarks verheiratet waren. Margarete war mit dem norwegischen König Hakon VI. und ihre ältere Schwester Ingeborg mit dem Mecklenburger Heinrich III. (Bruder von Albrecht II) verheiratet. Somit musste ein Enkel von Waldemar die Thronfolge antreten. Ingeborgs Sohn Albrecht IV. war durch eine Erbregelung von Waldemar, mit guten Chancen ausgestattet König zu werden. Jedoch war Dänemark eine Wahlmonarchie und somit war es ebenso gut möglich, dass der Sohn von Margarete, Olaf VI. gewählt werden würde. Überdies hatte sich die Hanse im Frieden von Stralsund ein Mitbestimmungsrecht bei der Thronfolge zugesichert. Somit fand sich die Hanse in einer Art Schiedsrichterrolle zwischen Ingeborg und Margarete wieder. Da die Dänen die Empfehlung des deutschen Kaisers für Albrecht keineswegs positiv aufnahmen und die Diplomatie von Margarete und ihrem Mann König Hakon von Norwegen erfolgreicher war, wurde schließlich 1376 der minderjährige Olaf zum neuen König gewählt.[8]
Die Mecklenburger nahmen diese Niederlage für Albrecht nicht hin und organisierten die in der Ostsee zerstreuten Seeräubertruppen unter ihrer Führung für einen organisierten Kaperkrieg gegen Dänemark. Die Namenslisten der Kapitäne dieser Generation der Seeräuber lässt darauf schließen, dass die Majorität sich aus dem niederen Adel rekrutierte.[9] Viele Seeräuber nutzen diese Gelegenheit ihre Tätigkeit zu legalisieren und waren fortan als „rechtmäßige Unternehmer im Handelskrieg auf fürstliche Veranlassung“[10] tätig. Die organisierten Seeräuber überfielen jedoch nicht nur dänische Schiffe, sondern machten auch bei hansischen Koggen Beute.[11]
1376 gab es einen Hansebeschluss die Seeräuberei zu bekämpfen. Die Städte Wismar und Rostock verkehrten diesen Beschluss jedoch und rüsteten Kaperschiffe aus. Diese Kaperschiffe führten zu großem Schaden in Schonen und führte zu einer Beeinträchtigung des Handels. Die Städte rechtfertigen sich vor der Hanse damit, dass sie dies aus Pflicht gegenüber ihrem Landesherren taten, Albrecht von Mecklenburg, welcher Krieg gegen Margarete von Dänemark führte.[12]
Hakon wehrte sich durch eigene Anheuerung von Seeräubern gegen die Kaperflotte der Mecklenburger. Der Arbeitsmarkt für Seeräuber blühte sozusagen durch den Konflikt der Großmächte.
1379 verstarb Albrecht II. und sein Sohn Albrecht III. schloss einen Waffenstillstand mit Dänemark, hiermit entfielen die Schutzbriefe für die Kaperfahrer.[13] Nach Einstellung der Kriegshandlungen zwischen Mecklenburg/Schweden und Dänen lösten sich die angeheuerten Kaperfahrer keineswegs in Luft auf. Entgegen der hansischen Vermutung, die Ostsee sei nun wieder eine sichere Handelszone, schlugen sich die Seeräuber auf die Seite Dänemarks.[14] Ein Indiz dafür, dass sie eher Beutemachen als Motivation hatten, denn politische Einstellungen.
Da Margarete erkannte, dass das Bündnis mit den Seeräubern sie ihrem Ziel die Sundschlösser zurückzugewinnen, welche im Frieden von Stralsund abgegeben werden mussten, nicht näher brachte, trat sie 1385 in freundschaftliche Verhandlungen[15] mit der Hanse. Ohne eine territoriale Basis war es den Seeräubern fortan nicht möglich den Handel entscheidend zu stören und für die nächsten fünf Jahre, sind keine größeren Aktivitäten der Seeräuber überliefert. Diese Verhandlungen werden jedoch von Bracker so geschildert, dass eher der Hanse als Margarete die entstehende Rüstungsspirale zu teuer wurde und man die Dänen mit der Rückgabe der Sundschlösser besänftigen wollte. Dies gelang und bis 1389 konnte in Frieden gehandelt werden.[16]
Der Sohn von Margarete starb 1376 und ihr Ehemann 1380. Damit war sie die Herrscherin Skandinaviens. Herzog Albrecht III. gelang es nicht genügend Verbündete gegen Margarete zu sammeln und unterlag ihren Armeen 1388.[17] Der schwedische Adel verbündete sich während dieser Periode mit Margarete gegen den schwedischen König Albrecht III. Dieser war gleichzeitig Herzog von Mecklenburg. Bei einer Schlacht zwischen Albrecht und Maragretes dänischen Truppen geriet Albrecht mit seinem Sohn Erich in Gefangenschaft.[18] Bis auf Stockholm geriet ganz Schweden unter dänisch-norwegische Herrschaft. Dem Rufe Albrechts folgend begaben sich mecklenburgische Adelige auf Kaperfahrt um alles zu beschädigen was Margarete gehörte und in Reichweite der Schiffe lag.
Da die Vitalienbrüder im folgenden Krieg zwischen Dänemark und Mecklenburg eindeutig auf Seite der Mecklenburger agierten und die Hanse versuchte diesen Konflikt möglichst neutral zu überstehen, hatte sie kein Interesse daran, die Seeräuber zu bekämpfen und damit die militärische Macht der Mecklenburger herauszufordern.[19]
Mecklenburgische Adelige, die Anführer der Kaperfahrer, waren sowohl vom Dienst gegenüber ihrem Landesherren, der Aussicht auf Beute und der mangelnden Alternativen motiviert. Ende des 14ten Jahrhunderts waren die Einnahmen aus der Landwirtschaft stark zurückgegangen und es konnte damit keine Existenzsicherung mehr betrieben werden. Diese Adeligen verkauften ihren Grundbesitz und konnten damit Kaperschiffe[20] erwerben, ausrüsten und bemannen.[21]
Entgegen der „Hansepropaganda“, dass Seeräuber Kriminelle seien, sahen Hansestädte diese erfahrenden Kämpfer und Nautiker als Reservoir von Kriegern an, aus dem man durchaus seine eigenen Söldner anwerben konnte. Beispielsweise brachten Bremer mit der Seeräuberei vor allem die Versuche der Absicherung der Ausfahrt in die Nordsee in Verbindung. Das Bemühen die Weser zu sichern und Strand- bzw. Seeraub einzudämmen, war für die Entwicklung des Handels existenziell wichtig. In diese Entwicklung gehört ebenfalls der Versuch die 15 Häuptlingsdynastien in Ostfriesland zu kontrollieren. Neben dieser feindlichen Haltung gegenüber Seeräubern unterstütze der Rat diese jedoch, sofern sie gegen den Erzbischof von Bremen und andere Feinde von Bremen Raubzüge durchführten.[22]
Weil der Dauerkonflikt zwischen Mecklenburg und Dänemark um Schweden und Albrecht den Handel stark einschränkte und folglich Waren wie Heringe in deutschen Gebieten sich um das zehnfache verteuerten, versuchte die Hanse die Kriegsparteien zu Verhandlungen zu überreden. In den Verhandlungen zwischen der Wirtschaftsmacht Hanse und Königin Margarete[23] kam man überein, dass die Hanse ihre Privilegien in Skandinavien behalten dürfe und dafür die politische Führung von Margarete anerkennt. Dieses Abkommen stoppte jedoch nicht die Kaperfahrten der von Albrecht engagierten Seefahrer. Obwohl Albrecht 1395 freigelassen wurde, endeten nicht alle Kaperfahrten und die neuen, meist nicht-adeligen Kapitäne erklärten Gotland zu ihrem Stützpunkt.[24]
[...]
[1] Holger Tümmler: Klaus Störtebeker. Der gefürchtete Seeräuber und seine wilden Gesellen, Wolfenbüttel, 2007, hier: S. 12f, im Folgenden: Tümmler: Störtebeker.
[2] Ebd. S. 16.
[3] Petra Bauersfeld: Die gesellschaftliche Bedeutung der Vitalienbrüder. Eine sozial- und kulturhistorische Betrachtung der Seeräuber um Klaus Störtebeker, in: Demokratische Geschichte. Jahrbuch für Schleswig-Holstein, Bd. 11, 1998, S. 19-40, hier: S. 19, im Folgenden: Bauersfeld: Die gesellschaftliche Bedeutung der Vitalienbrüder.
[4] Ulrich Andermann: Spätmittelalterlicher Seeraub als Kriminaldelikt und seine Bestrafung, in: Wilfried Ehbrecht (Hg.): Störtebeker. 600 Jahre nach seinem Tod, Trier, 2005, S. 23-36, hier: S. 24f.
[5] Tümmler: Störtebeker, S.21.
[6] Klaus Friedland: Die Hanse, Stuttgart u.a, 1991, hier: S. 141f, im Folgenden: Friedland: Die Hanse.
[7] Ebd. S. 143; Tümmler: Störtebeker , S. 22.
[8] Matthias Puhle: Die Vitalienbrüder, Frankfurt/Main, New York, 1994, hier: S. 17f, im Folgenden: Puhle: Vitalienbrüder.
[9] Ebd. S. 59f.
[10] Jürgen Bracker: Klaus Störtebeker. Nur einer von ihnen. Die Geschichte der Vitalienbrüder, in: Ralf Wiechmann, Günter Bräuer, Klaus Püschel (Hg.): Klaus Störtebeker. Ein Mythos wird entschlüsselt, München 2004, S. 9-61, hier: S. 14, im Folgenden: Bracker: Die Geschichte der Vitalienbrüder.
[11] Puhle: Vitalienbrüder, S. 20f.
[12] Friedland: Die Hanse, S. 146.
[13] Bracker: Die Geschichte der Vitalienbrüder, S. 16.
[14] Puhle: Vitalienbrüder, S. 24.
[15] Puhle: Vitalienbrüder, S. 27.
[16] Bracker: Die Geschichte der Vitalienbrüder, S. 18.
[17] Ebd. S. 19.
[18] Puhle: Vitalienbrüder, S. 34.
[19] Ebd. S. 46.
[20] Ebd. S. 63.
[21] Bauersfeld: Die gesellschaftliche Bedeutung der Vitalienbrüder, S. 22f.
[22] Hartmut Roder: Bremens Kampf gegen die Seeräuber, in: in: Wilfried Ehbrecht (Hg.): Störtebeker. 600 Jahre nach seinem Tod, Trier, 2005, S. 111- 116, hier: S. 111.
[23] Bracker: Die Geschichte der Vitalienbrüder, S. 22.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis listet die Hauptteile der Arbeit auf, darunter die Einleitung, den Ostseeraum (Politik und Genesis der Vitalienbrüder), den Nordseeraum (Friesland unter Einfluss der Vitalienbrüder), die Identität der Vitalienbrüder (Name, Selbstverständnis, Seeräuber oder Kaperfahrer, Bruderschaft), die Frage nach Klaus oder Johann Störtebeker, eine Schlussbetrachtung und das Literaturverzeichnis.
Worum geht es in der Einleitung?
Die Einleitung stellt Störtebeker und die Vitalienbrüder vor. Sie thematisiert die vielen verschiedenen Versionen der Störtebeker-Geschichte und betont den Einfluss der Vitalienbrüder auf Politik und Wirtschaft im Nord- und Ostseeraum. Es wird auch die Frage aufgeworfen, inwieweit Sagen die Geschichtsschreibung beeinflusst haben und die Problematik der Quellenlage angesprochen.
Was wird im Abschnitt über den Ostseeraum behandelt?
Dieser Abschnitt untersucht die Entstehung der Vitalienbrüder im Ostseeraum, die politischen Hintergründe im 14. Jahrhundert, insbesondere die Rolle der Hanse und die Konflikte zwischen Dänemark und Mecklenburg um Schweden. Es werden auch die Motive der mecklenburgischen Adeligen für ihre Beteiligung an Kaperfahrten erörtert.
Welche Begriffe werden in der Arbeit definiert?
Es werden die Begriffe "Seeräuber" und "Kaperfahrer" definiert und voneinander abgegrenzt, wobei betont wird, dass die Hanse ihre Gegner oft propagandistisch als Seeräuber diffamierte.
Wer war Waldemar IV. und welche Rolle spielte er?
Waldemar IV. war der dänische König, dessen Angriff auf Visby (Gotland) als kriegerische Provokation von der Hanse interpretiert wurde. Seine Handlungen führten zu Konflikten und zur Beteiligung der Hanse an den Thronfolgestreitigkeiten.
Was war der Frieden von Stralsund?
Der Frieden von Stralsund (1370) beendete einen Krieg zwischen der Hanse und Dänemark. Er sicherte Albrecht von Mecklenburg die Herrschaft über Schweden und der Hanse profitable Handelsprivilegien in Schonen.
Wie beeinflusste Margarete die Situation?
Margarete war die Tochter von Waldemar IV. und durch ihre Heirat und Politik gelang es ihr, die Thronfolge Dänemarks zu sichern und später auch Schweden und Norwegen zu beherrschen. Dies führte zu Konflikten mit Albrecht von Mecklenburg und zur verstärkten Aktivität der Vitalienbrüder auf Seiten Mecklenburgs.
Was waren die Motive der mecklenburgischen Adeligen für die Kaperfahrten?
Die mecklenburgischen Adeligen waren durch den Dienst gegenüber ihrem Landesherren, die Aussicht auf Beute und die schlechte wirtschaftliche Lage motiviert. Sinkende Einnahmen aus der Landwirtschaft zwangen sie dazu, ihren Grundbesitz zu verkaufen und Kaperschiffe auszurüsten.
Wie stand die Hanse zu den Seeräubern?
Die Hanse hatte ein ambivalentes Verhältnis zu den Seeräubern. Einerseits versuchte sie, die Seeräuberei zu bekämpfen, andererseits rekrutierten Hansestädte wie Bremen Seeräuber als Söldner gegen ihre Feinde und nutzten sie zur Absicherung des Handels.
Was war das Ergebnis der Verhandlungen zwischen der Hanse und Königin Margarete?
Die Hanse erkannte die politische Führung von Margarete an und sicherte sich im Gegenzug ihre Privilegien in Skandinavien. Dieses Abkommen beendete jedoch nicht die Kaperfahrten der von Albrecht engagierten Seefahrer.
- Citar trabajo
- Master of Arts Henning Priet (Autor), 2010, Störtebeker und die Vitalienbrüder, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193563