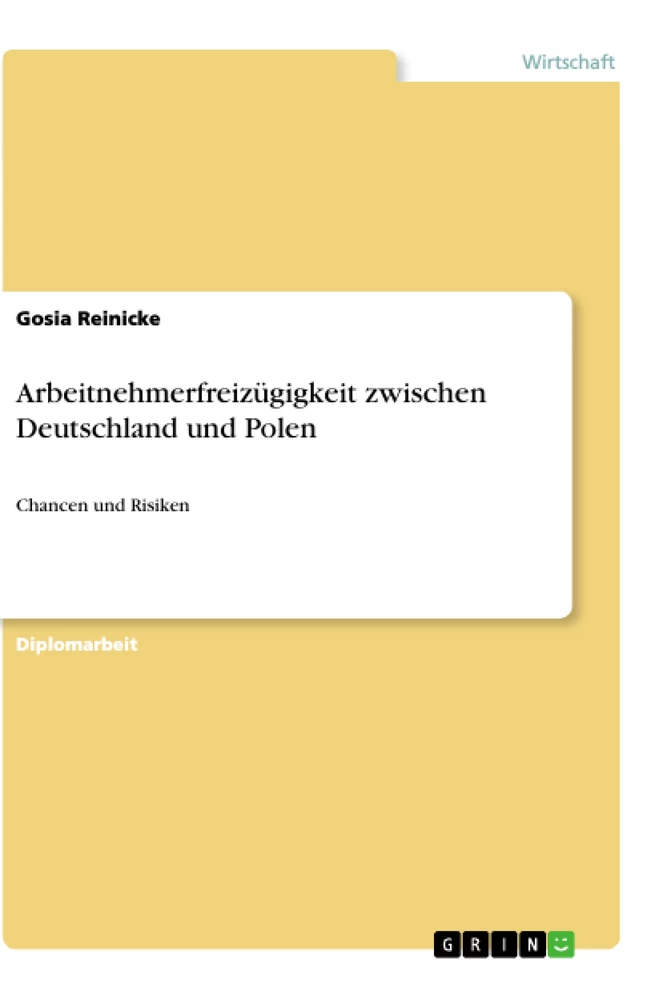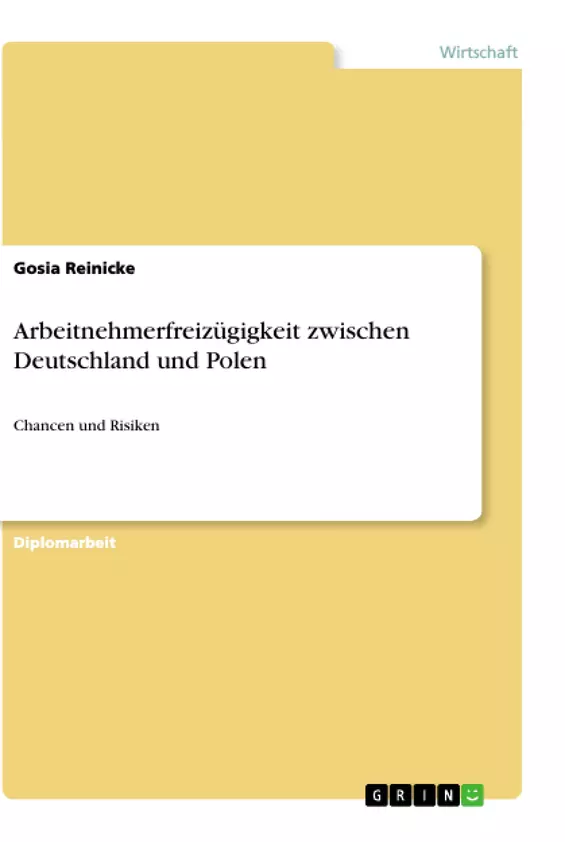Die Europäische Union wurde 1951 durch Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande als Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) gegründet um den Frieden im Europa zu sichern. Im Laufe der Zeit wurde die EU um zahlreiche Mitglieder erweitert.
Am 1. Mai 2004 nahm die EU, nach langen Verhandlungen, zehn weitere Beitrittsstaaten, darunter Polen, die Slowakische Republik, Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn sowie Malta und Zypern, auf. Die alten und die neuen EU-Staaten nutzten den Zusammenbruch des Ostblocks Ende der neunziger Jahre als große historische Chance für ein vereinigtes Europa.
Die größte Erweiterung der Europäischen Union war für alle Beteiligten eine große Herausforderung und brachte nicht nur Vorteile sondern auch Risiken für die beteiligten Länder. Vor dieser Vereinigung Europas wurden viele Diskussionen im Hinblick auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit, einer der Grundfreiheiten der EU-Bürger, geführt.
EU-Bürger genießen innerhalb der Europäischen Union vier Grundfreiheiten, unter anderem die Personenverkehrsfreiheit (Arbeitnehmerfreizügigkeit und Niederlassungsfreiheit). Die Grundfreiheiten sind als primäres Recht durch alle Mitgliedstaaten anzuwenden. Vor allem Deutschland und Österreich forderten die Einführung von Übergangsfristen für die Arbeitnehmer aus den neuen osteuropäischen Mitgliedstaaten, um die Arbeitsmärkte vor einem Ansturm von Wanderarbeitnehmern aus diesen Ländern zu schützen. Die EU ist diesen Forderungen nachgekommen und führte bei der EU-Erweiterung 2004 Übergangsbestimmungen bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit ein.
Im Rahmen dieser Arbeit wird die Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen analysiert. Ziel ist es, die Chancen und Risiken, welche die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen mit sich bringt, zu identifizieren, diese zu erläutern und Folgerungen/ Konsequenzen zu erörtern.
• Welche Potenziale sind bei der vollständigen Öffnung der Arbeitsmärkte zu finden?
• Was für Risiken birgt die Arbeitnehmerfreizügigkeit für beide Länder?
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Die Erweiterung der Europäischen Union im Jahr 2004
- 1.1. Der Weg Polens in die Europäische Union
- 1.2. Stimmungsbilder zum EU-Beitritt
- 2. Wirtschaftslage in Deutschland 2004 - 2011
- 2.1. Bevölkerung / Demografische Entwicklung
- 2.2. Wirtschaftswachstum und -struktur
- 2.3. Arbeitsmarkt
- 2.4. Sozialversicherungssystem
- 3. Wirtschaftslage in Polen 2004 - 2011
- 3.1. Bevölkerung / Demografische Entwicklung
- 3.2. Wirtschaftswachstum und -struktur
- 3.3. Arbeitsmarkt
- 3.4. Sozialversicherungssystem
- 4. Regelungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit
- 4.1. Übergangsbestimmungen in Deutschland für polnische Bürger
- 4.2. Übergangsbestimmungen für deutsche Bürger in Polen
- 4.3. Veränderungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit seit 2004 in Deutschland und Polen
- 5. Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Praxis
- 5.1. Erfahrungen mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Großbritannien
- 5.2. EURES-Netzwerk als beratende Institution für Wanderarbeitnehmer
- 5.3. Volle Arbeitnehmerfreizügigkeit in Deutschland
- 6. Ausblick auf die künftige Entwicklung
- 6.1. Studien und Prognosen der Zuwanderung nach Deutschland
- 6.2. Chancen der Arbeitnehmerfreizügigkeit
- 6.3. Risiken der Arbeitnehmerfreizügigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit analysiert die Auswirkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen im Kontext der EU-Erweiterung von 2004. Sie untersucht die Chancen und Risiken, die sich aus dem freien Personenverkehr für beide Länder ergeben.
- Wirtschaftslage in Deutschland und Polen vor und nach der EU-Erweiterung
- Regelungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit und deren Auswirkungen
- Erfahrungen mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Praxis
- Chancen und Risiken der Arbeitnehmerfreizügigkeit für beide Länder
- Zukünftige Entwicklungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die EU-Erweiterung von 2004 und den Weg Polens in die Europäische Union. Es beleuchtet auch die Stimmung in der Bevölkerung zum EU-Beitritt.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel analysiert die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland von 2004 bis 2011, wobei es sich auf die demografische Entwicklung, das Wirtschaftswachstum, den Arbeitsmarkt und das Sozialversicherungssystem konzentriert.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel beleuchtet die wirtschaftliche Entwicklung in Polen von 2004 bis 2011, mit einem Fokus auf die demografische Entwicklung, das Wirtschaftswachstum, den Arbeitsmarkt und das Sozialversicherungssystem.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel erläutert die Regelungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen, einschließlich der Übergangsbestimmungen und der Veränderungen seit 2004.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel untersucht die praktische Umsetzung der Arbeitnehmerfreizügigkeit, mit Beispielen aus Großbritannien und dem EURES-Netzwerk. Es betrachtet auch die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit in Deutschland.
- Kapitel 6: Dieses Kapitel befasst sich mit der zukünftigen Entwicklung der Arbeitnehmerfreizügigkeit, indem es Studien und Prognosen zur Zuwanderung nach Deutschland sowie die Chancen und Risiken der Arbeitnehmerfreizügigkeit beleuchtet.
Schlüsselwörter
Arbeitnehmerfreizügigkeit, EU-Erweiterung, Deutschland, Polen, Wirtschaftslage, Arbeitsmarkt, Sozialversicherungssystem, Chancen, Risiken, Migration, EURES-Netzwerk, Zuwanderung, demografische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU?
Es ist eine der vier Grundfreiheiten, die es EU-Bürgern ermöglicht, in jedem Mitgliedstaat der Union ohne Arbeitsgenehmigung zu arbeiten und zu wohnen.
Warum gab es Übergangsfristen für polnische Arbeitnehmer?
Vor allem Deutschland und Österreich forderten diese Fristen nach der EU-Erweiterung 2004, um ihre heimischen Arbeitsmärkte vor einem befürchteten massenhaften Zustrom von Wanderarbeitnehmern zu schützen.
Welche Chancen bietet die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit?
Zu den Potenzialen gehören der Ausgleich des Fachkräftemangels in Deutschland, Wirtschaftswachstum durch Mobilität und die Stärkung des europäischen Binnenmarktes.
Welche Risiken wurden im Rahmen der Diplomarbeit analysiert?
Analysiert wurden Risiken wie Lohndumping, die Belastung der Sozialversicherungssysteme sowie der "Brain Drain" (Abwanderung von Fachkräften) in Polen.
Was ist das EURES-Netzwerk?
EURES ist ein europäisches Kooperationsnetzwerk von Arbeitsverwaltungen, das Wanderarbeitnehmer berät und bei der Vermittlung über Grenzen hinweg unterstützt.
- Quote paper
- Gosia Reinicke (Author), 2012, Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193580