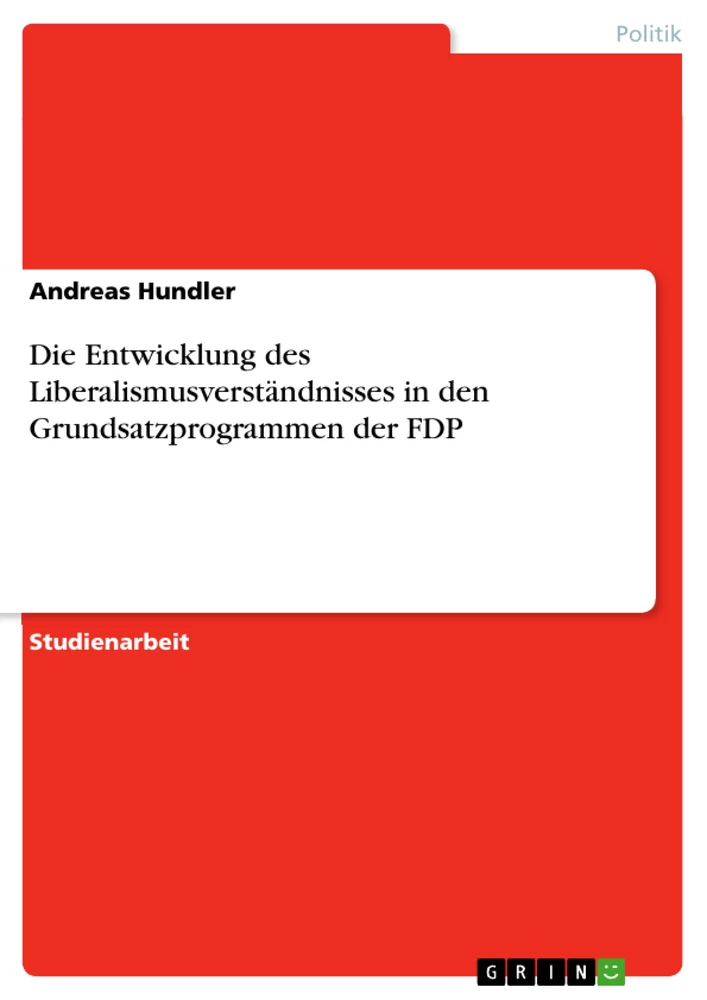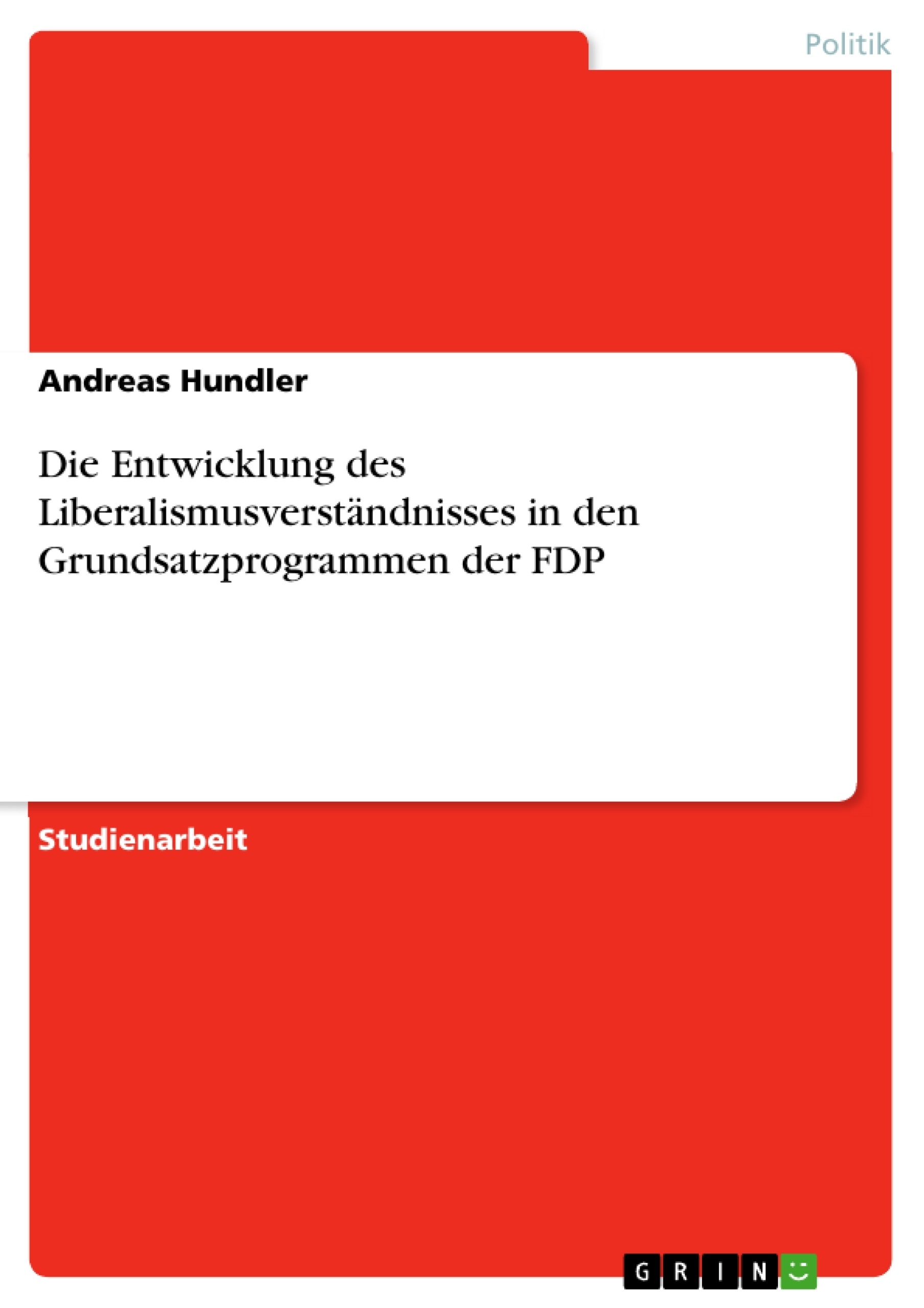Der Liberalismus als Weltanschauung und politische Ideologie mit dem Ziel, die Freiheit des Einzelnen in den Mittelpunkt politischer Überlegungen zu stellen und staatliche Be-vormundung im größtmöglichen Umfang zu verhindern, ist das bedeutsamste Identitäts-merkmal und argumentative Fundament der FDP, dessen geistige Ursprünge bis ins 17. Jahrhundert in England zurückreichen (Rudzio 2006: 132). Aufgrund dieser gemeinsamen Grundausrichtung der Partei sowie dem damit einhergehenden starken Bedürfnis nach programmatischer Fixierung ist die FDP als eine Programmpartei zu bezeichnen, in der Grundsatzprogramme dementsprechend von großer Bedeutung sind (Dittberner 2010: 277). Der Liberalismus zeigt sich im geschichtlichen Verlauf und auch in der jüngeren Geschichte seit Gründung der FDP einem stetigen Wandel der Schwerpunktsetzungen unterworfen. So gelten die siebziger Jahre als die Hochzeit des sozialen Liberalismus in Deutschland. Heute wird der FDP hingegen oft eine thematische Einengung auf den Wirt-schaftsliberalismus vorgeworfen (Plickert 2011). Häufig wird sie als „Steuersenkungspar-tei“ wahrgenommen, die sich eindeutig dem besserverdiendenden Besitzbürgertum der Gesellschaft zugewendet hat (Drach 2011).
Weil der Liberalismus als politische Philosophie in der FDP eine bedeutende Rolle spielt und auch den Grundsatzprogrammen eine große Bedeutung zukommt soll in dieser Arbeit der Frage nachgegangen werden, welches Liberalismusverständnis den vier bedeutsamen Grundsatzprogrammen der FDP zugrunde liegt. Ist eine programmatische Einengung auf wirtschaftsliberale Themenfelder auch in den Grundsatzprogrammen zu erkennen und wie hat sich das Liberalismusverständnis in den Programmen der FDP seit ihrer Gründung verändert? Diesen Fragen soll in dieser Arbeit nachgegangen werden. Außerdem sollen die Gründe für die jeweils herausgearbeiteten Veränderungen aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Liberalismusauffassungen
- 3. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Grundsatzprogramme der FDP
- 3.1 Das Berliner Programm von 1957
- 3.2 Die Freiburger Thesen zur Gesellschaftspolitik von 1971
- 3.3 Die Kieler Thesen von 1977
- 3.4 Die Wiesbadener Grundsätze zur liberalen Bürgergesellschaft von 1997
- 4. Das Liberalismusverständnis in den Grundsatzprogrammen der FDP
- 4.1 Der Liberalismus im Berliner Programm von 1957
- 4.1.1 Das Liberalismusverständnis im Berliner Programm
- 4.1.2 Gründe für die Vermeidung des Liberalismusbegriffs
- 4.2 Der Liberalismus in den Freiburger Thesen von 1971
- 4.2.1 Das Liberalismusverständnis in den Freiburger Thesen
- 4.2.1.1 Das Liberalismusverständnis in der Einleitung
- 4.2.1.2 Die Thesen zur Gesellschaftspolitik in den Freiburger Thesen
- 4.2.1.3 Die inhaltliche Analyse der Freiburger Thesen
- 4.2.1.4 Résumé: Das Liberalismusverständnis in den Freiburger Thesen
- 4.2.2 Der Weg zum sozialen Liberalismus
- 4.2.1 Das Liberalismusverständnis in den Freiburger Thesen
- 4.3 Der Liberalismus in den Kieler Thesen von 1977
- 4.3.1 Das Liberalismusverständnis in den Kieler Thesen
- 4.3.1.1 Der Begriff des Liberalismus in den Kieler Thesen
- 4.3.1.2 Die inhaltliche Analyse der Kieler Thesen
- 4.3.1.3 Résumé: Das Liberalismusverständnis in den Kieler Thesen
- 4.3.2 Der Weg zum Wirtschaftsliberalismus der Kieler Thesen
- 4.3.1 Das Liberalismusverständnis in den Kieler Thesen
- 4.4 Der Liberalismus in den Wiesbadener Grundsätze von 1997
- 4.4.1 Das Liberalismusverständnis in den Wiesbadener Grundsätzen
- 4.4.1.1 Die vier Fundamente des modernen Liberalismus
- 4.4.1.2 Die liberale Bürgergesellschaft als Teilhabergesellschaft
- 4.4.1.3 Résumé: Das Liberalismusverständnis der Wiesbadener Grundsätze
- 4.4.2 Gründe für die Entstehung der Wiesbadener Grundsätze
- 4.4.1 Das Liberalismusverständnis in den Wiesbadener Grundsätzen
- 4.1 Der Liberalismus im Berliner Programm von 1957
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Liberalismusverständnisses in den Grundsatzprogrammen der FDP. Sie zielt darauf ab, die unterschiedlichen Auffassungen des Liberalismus innerhalb der Partei aufzuzeigen und deren Veränderungen über die Zeit zu beleuchten. Dabei wird auch auf die Gründe für die jeweilige Ausgestaltung des Liberalismus in den Programmen eingegangen.
- Das Liberalismusverständnis in den Grundsatzprogrammen der FDP seit ihrer Gründung
- Die programmatische Einengung auf wirtschaftsliberale Themenfelder
- Die Veränderungen des Liberalismusverständnisses in den Programmen
- Die Gründe für die jeweils herausgearbeiteten Veränderungen
- Die inhaltliche Schwerpunktsetzung der einzelnen Programme
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung des Liberalismus für die FDP und die Relevanz der Grundsatzprogramme dar. Kapitel 2 bietet einen Überblick über relevante Liberalismusbegriffe. Kapitel 3 fasst die Inhalte der Grundsatzprogramme der FDP zusammen. Kapitel 4 analysiert das Liberalismusverständnis in jedem einzelnen Programm, wobei die Verwendung des Begriffs "Liberalismus" und die inhaltliche Ausrichtung der Programme beleuchtet werden. Außerdem werden die Gründe für die jeweilige Ausgestaltung des Liberalismus betrachtet. Das Fazit fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen.
Schlüsselwörter
Liberalismus, FDP, Grundsatzprogramme, Wirtschaftsliberalismus, Sozialer Liberalismus, Freiburger Thesen, Kieler Thesen, Wiesbadener Grundsätze, Berliner Programm, Programmatik, politische Ideologie, Weltanschauung, Freiheit des Einzelnen, Staatsbevormundung, Bürgergesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kernziel des Liberalismus in der FDP?
Das Ziel ist es, die Freiheit des Einzelnen in den Mittelpunkt zu stellen und staatliche Bevormundung weitestgehend zu verhindern.
Welche vier Grundsatzprogramme werden in der Arbeit analysiert?
Analysiert werden das Berliner Programm (1957), die Freiburger Thesen (1971), die Kieler Thesen (1977) und die Wiesbadener Grundsätze (1997).
Was zeichnet die „Freiburger Thesen“ von 1971 aus?
Sie gelten als Höhepunkt des sozialen Liberalismus in der FDP, bei dem gesellschaftspolitische Reformen und Teilhabe im Vordergrund standen.
Wann fand die Wende zum Wirtschaftsliberalismus statt?
Diese Entwicklung wird vor allem mit den Kieler Thesen von 1977 und später den Wiesbadener Grundsätzen von 1997 assoziiert, die den Fokus stärker auf Markt und Steuersenkungen legten.
Warum wird die FDP oft als „Programmpartei“ bezeichnet?
Aufgrund ihres starken Bedürfnisses nach programmatischer Fixierung ihrer Weltanschauung und der großen Bedeutung, die Grundsatzprogrammen für die Parteiidentität zukommt.
- Quote paper
- Andreas Hundler (Author), 2012, Die Entwicklung des Liberalismusverständnisses in den Grundsatzprogrammen der FDP, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193626