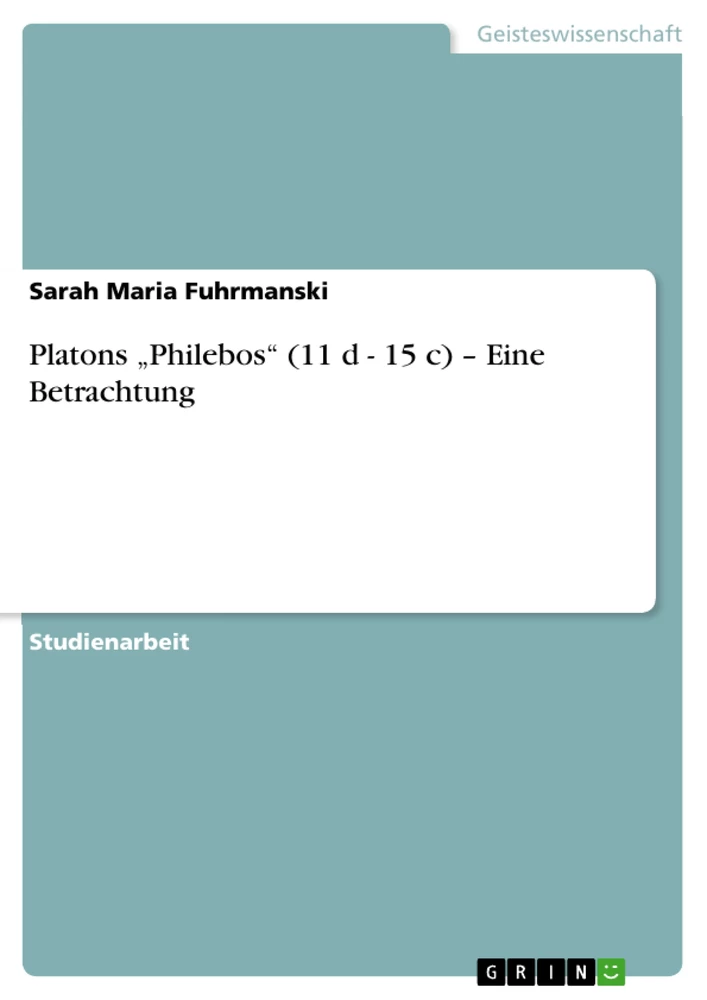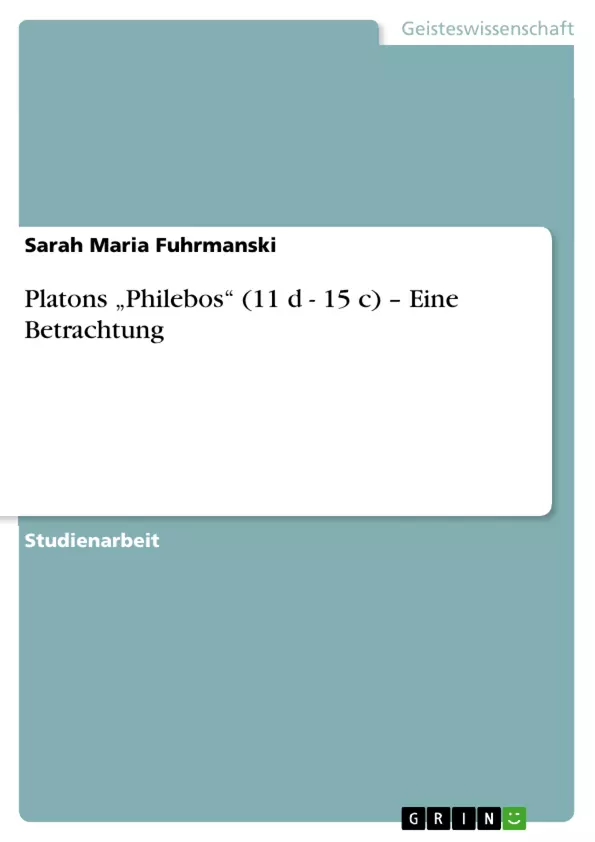Das Seminar zu Platons Philebos im WS 2009/2010 war die erste
Veranstaltung, die ich im Rahmen meines erziehungswissenschaftlichen
Studiums für Lehrämter in meinem Wahlfach Philosophie besuchte. Bis
dahin kam ich kaum in Kontakt mit dem Fach Philosophie – höchstens am
Rande meines Theologiestudiums. Meine Vorkenntnisse zu Platon und
seinen Werken waren demnach nicht erwähnenswert und so versuchte ich
vorerst während der Sitzungen fast ausschließlich den Gedankengängen
meiner Kommilitonen zu folgen. Die Frage nach dem höchsten Gut im
Menschenleben fand und finde ich sehr spannend. Im Folgenden gehe ich
allgemein auf Platons Philebos ein, bevor ich mich ausführlicher mit dem
ersten Teil des Philebos, der Gesprächseröffnung (11 a – 14 b), sowie mit
dem Problem der Einheit und Vielheit (14 c -. 15 c) beschäftigen werde.
Abschließend möchte ich meine Ausführungen kurz reflektieren.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Vorbemerkungen zum „Philebos“
- Hauptteil
- 3.1 Die Gesprächseröffnung (11 d - 14 b)
- 3.2 Das Problem von Einheit und Vielheit (14 c - 15 c)
- Reflexion
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Seminar zu Platons Philebos im Wintersemester 2009/2010 befasst sich mit der Frage, was das höchste Gut im menschlichen Leben ist. Der Fokus liegt auf Platons Auseinandersetzung mit dem Hedonismus, der die Lust als das höchste Gut betrachtet, und der Frage, ob es einen Zustand der Seele gibt, der besser ist als die Lust oder die Vernunft. Die Arbeit untersucht den Dialog zwischen Sokrates und Protarchos im ersten Teil des Philebos, um Platons Argumentation und Kritik am Hedonismus zu verstehen.
- Platons Kritik am Hedonismus
- Die Suche nach dem höchsten Gut im Menschenleben
- Die Bedeutung der Vernunft und der Seele
- Das Verhältnis von Einheit und Vielheit
- Der Dialog zwischen Sokrates und Protarchos als Methode der Erkenntnisgewinnung
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort
Der Text gibt einen Einblick in die Auseinandersetzung der Autorin mit Platons Philebos im Rahmen ihres Studiums für Lehrämter. Die Autorin schildert ihre anfängliche Unbekanntheit mit Platons Werk und ihre Bemühungen, den Gedankengängen ihrer Kommilitonen zu folgen.
Vorbemerkungen zum „Philebos“
Dieser Abschnitt beleuchtet den Kontext des Dialogs Philebos und seine Besonderheiten. Der Dialog, der zwischen 360 und 347 v. Chr. entstanden sein soll, stellt ein Spätwerk Platons dar. Die Autorin hebt die formale und inhaltliche Beschaffenheit des Dialogs hervor.
3.1 Die Gesprächseröffnung (11 d - 14 b)
Dieser Teil analysiert die Eröffnung des Gesprächs zwischen Sokrates und Protarchos. Sokrates argumentiert, dass die Seele die Grundlage für Glückseligkeit ist, während Protarchos die Hedonistische Sichtweise vertritt, die Lust als höchste Gut betrachtet.
3.2 Das Problem von Einheit und Vielheit (14 c - 15 c)
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Frage, ob es einen einheitlichen Lustbegriff gibt. Sokrates argumentiert, dass die Lust nicht einheitlich ist, sondern verschiedene Formen annimmt.
Schlüsselwörter
Platon, Philebos, Hedonismus, Lust, Vernunft, Seele, Glückseligkeit, Einheit, Vielheit, Dialog, Sokrates, Protarchos, Gesprächseröffnung, Spätwerk, Kritik, Erkenntnisgewinnung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im Dialog „Philebos“ von Platon?
Der Dialog behandelt die Frage nach dem höchsten Gut im menschlichen Leben, wobei insbesondere das Verhältnis von Lust (Hedonismus) und Vernunft untersucht wird.
Wer sind die Gesprächspartner im Philebos?
Die Hauptfiguren des Dialogs sind Sokrates und Protarchos, wobei Sokrates die Vernunft und Protarchos die Lust als höchstes Gut vertritt.
Was versteht Platon unter dem Problem von Einheit und Vielheit?
Es geht um die Frage, ob Begriffe wie „Lust“ eine einheitliche Form haben oder ob sie in verschiedenen, teils gegensätzlichen Arten auftreten können.
In welche Schaffensperiode Platons fällt der Philebos?
Der Philebos wird als eines der Spätwerke Platons eingeordnet, entstanden zwischen 360 und 347 v. Chr.
Warum kritisiert Sokrates den reinen Hedonismus?
Sokrates argumentiert, dass ein Leben ohne Vernunft und Erkenntnis, selbst wenn es voller Lust wäre, nicht erstrebenswert und nicht wahrhaft menschlich sei.
- Quote paper
- Sarah Maria Fuhrmanski (Author), 2010, Platons „Philebos“ (11 d - 15 c) – Eine Betrachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193658