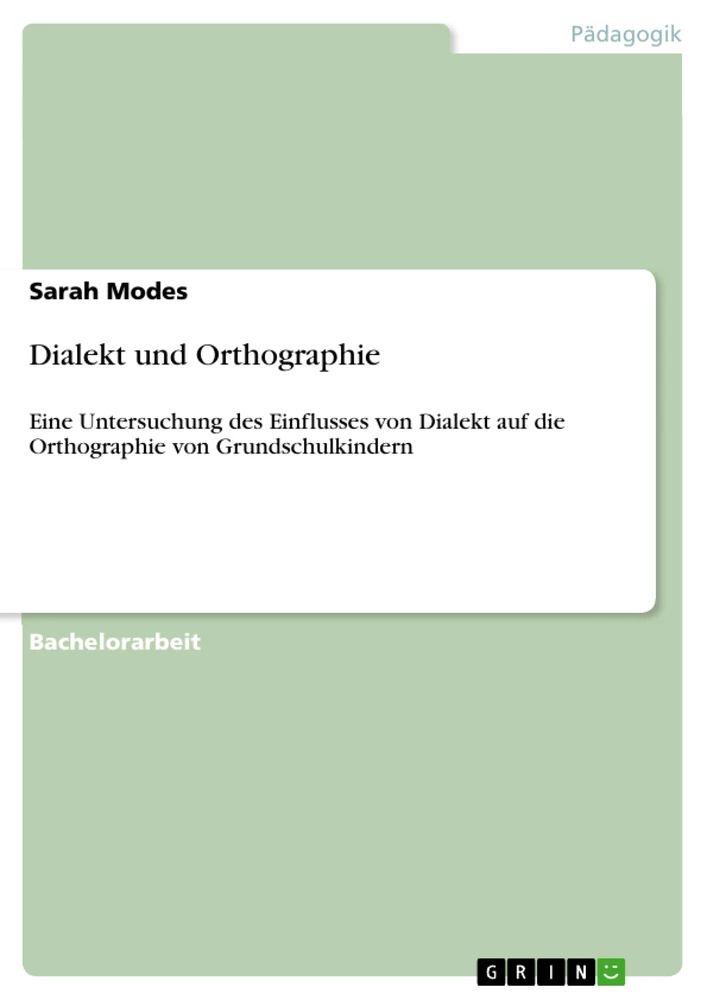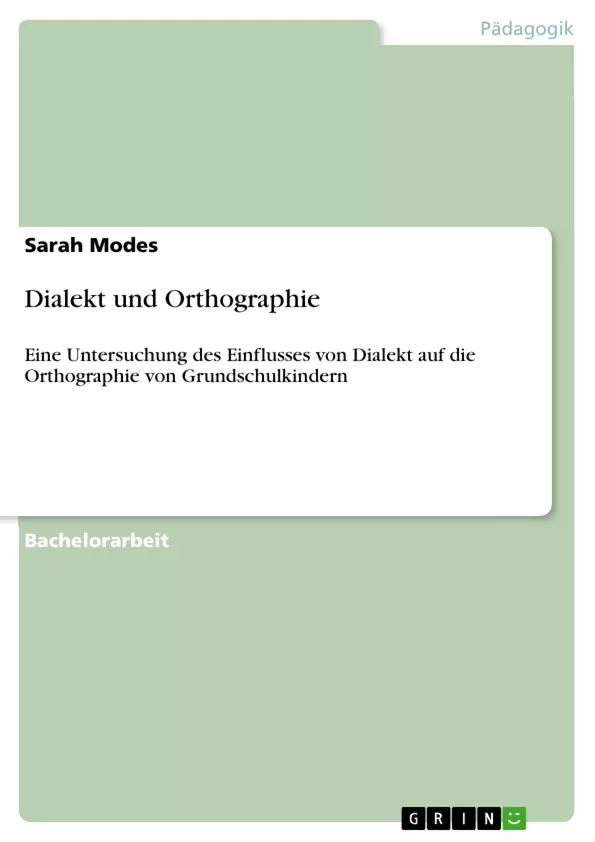Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem Einfluss des bairischen Dialektes auf die Orthographie von Grundschulkindern der zweiten Jahrgangsstufe. Die zugehörige Studie wurde im Raum Altmühltal durchgeführt. Thematische Schwerpunkte bilden die Normierung der Rechtschreibung, der Aufbau der deutschen Orthographie, der Schriftspracherwerb in der Grundschule und letztlich der Bereich Dialekt und Mundart im Raum Schule.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Normierung der deutschen Orthographie
- Von der Schreibung zur Rechtschreibung
- Durchsetzung einer Einheitsorthographie
- Die Rolle des Dudens bei der Kodifizierung der deutschen Orthographie
- Rechtschreibreform von 1996 und deren Überarbeitungen in den 10 Jahren 2004 und 2006
- Rechtschreibreform von 1996 und deren Überarbeitungen in den 10 Jahren 2004 und 2006
- Der Aufbau der deutschen Rechtschreibung
- Verhältnis gesprochener und geschriebener Sprache
- Linguistische Grundlagen
- Generelle Anmerkungen
- Grapheme und Phonographie
- Groß- und Kleinschreibung im Deutschen
- Explizitform und silbische Schreibung
- Die Prinzipien der deutschen Rechtschreibung
- Das phonologische Prinzip
- Das morphematische Prinzip
- Das silbische Prinzip
- Das grammatische Prinzip
- Das semantische Prinzip
- Das historische Prinzip
- Der Schriftspracherwerb in der Grundschule
- Generelle Vorbemerkungen
- Vorschulische Kompetenzen
- Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs
- Das Drei-Phasen-Modell von U. Frith (1985)
- Das Fünf-Phasen-Modell von K.B. Günther (1986)
- Modell des Rechtschreiberwerbs von G. Scheerer-Neumann (1987)
- Abschließende Überlegungen zu den Stufenmodellen
- Dialekt und Mundart im Raum Schule
- Abgrenzung Dialekt, Umgangssprache, Standardsprache
- Gegenwärtige Dialektsituation
- Sprachliche Merkmale des Bairischen
- Hochdeutsch lernen - Mundart nicht verlernen
- Sprachsituation an bayerischen Grundschulen
- Vorteile von Dialektsprechern in der Schule
- Nachteile von Dialektsprechern in der Schule
- Dialekteinsatz im Klassenzimmer
- Auswertung der Ergebnisse der Studie in drei Klassen der 2. Jahrgangsstufe
- Untersuchungsansatz und Auswahl der Schüler und Klassen
- e.o.Plauen und seine „Vater-Sohn-Geschichten”
- Auswertung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Einfluss von Dialekt auf die deutsche Orthographie bei Grundschulkindern. Ziel der Arbeit ist es, diesen Einfluss zu dokumentieren und die Auswirkungen auf den Schriftspracherwerb zu untersuchen. Die Arbeit betrachtet insbesondere den Aufbau der Orthographie und dessen Korrelation zum Schriftspracherwerb.
- Normierung der deutschen Orthographie
- Struktur und Prinzipien der deutschen Rechtschreibung
- Theorien des Schriftspracherwerbs
- Dialekt und Mundart im Raum Schule
- Untersuchung des Einflusses von Dialekt auf die Orthographie bei Grundschulkindern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss von Dialekt auf die deutsche Orthographie bei Grundschulkindern dar. Die Kapitel 1 und 2 beleuchten die Normierung der deutschen Orthographie und die Struktur der deutschen Rechtschreibung. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Theorien des Schriftspracherwerbs. Kapitel 4 widmet sich dem Thema „Dialekt und Mundart im Raum Schule” und untersucht die Dialektsituation an bayerischen Grundschulen. Schließlich stellt Kapitel 4.9 die Auswertung der Ergebnisse der Studie in drei Klassen der 2. Jahrgangsstufe dar.
Schlüsselwörter
Deutsche Orthographie, Schriftspracherwerb, Dialekt, Mundart, Grundschule, Rechtschreibreform, Einheitsorthographie, Duden, Sprachsituation, Sprachliche Merkmale, Bairisch, Hochdeutsch, Untersuchungsergebnisse.
- Quote paper
- Sarah Modes (Author), 2012, Dialekt und Orthographie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193829