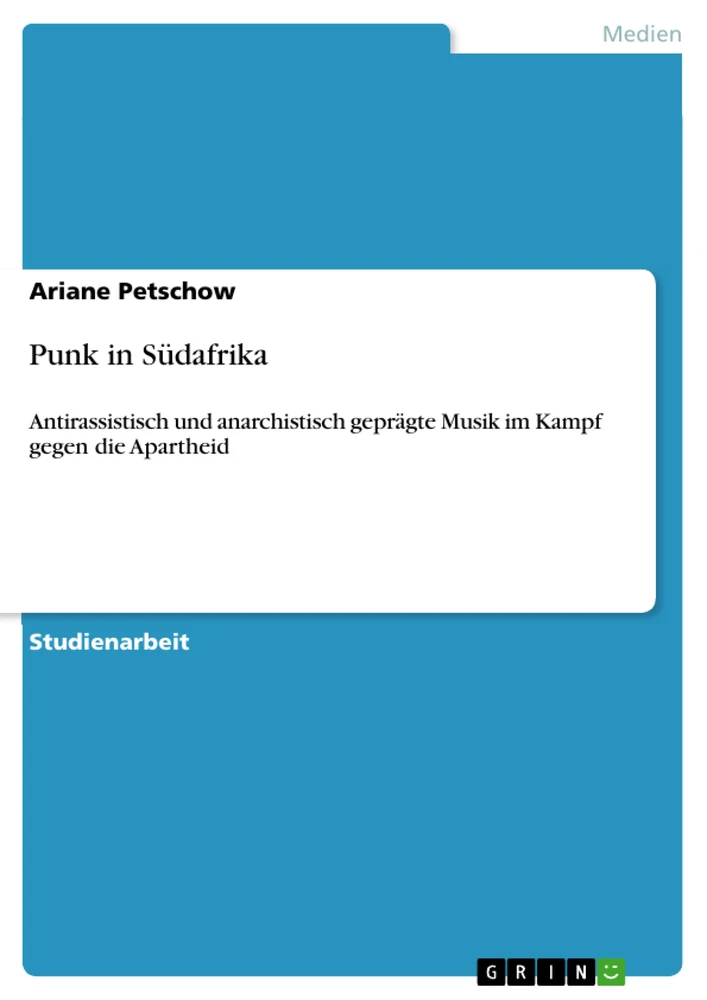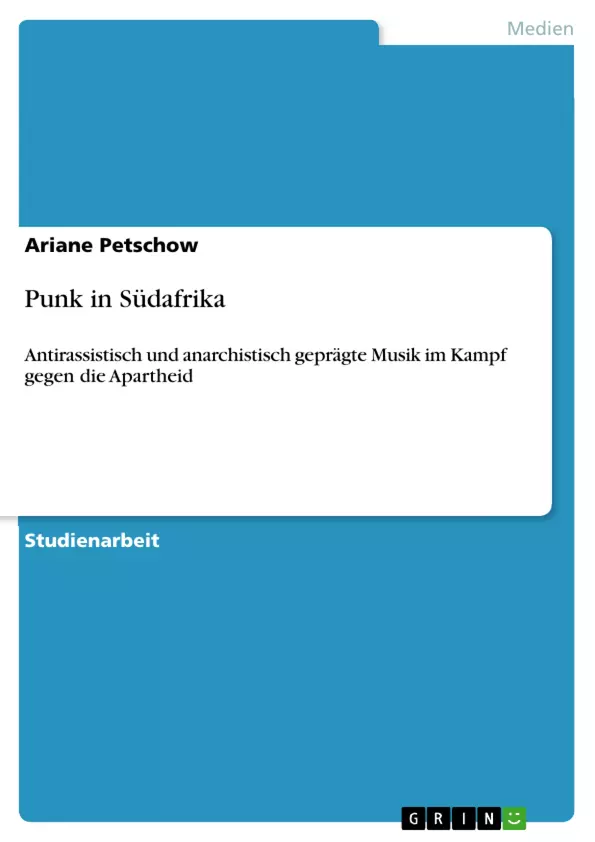Einleitung (Auszug)
Im Folgenden möchte ich die Entwicklung des südafrikanischen Punkrock aufzeigen. Beginnen möchte ich mit einer Hinführung zum Spirit des Punks. Anschließend soll die Verbreitung des Punks in Südafrika beschrieben, sein politisches Rebellionspotenzial in Bezug auf die Apartheid untersucht und seine durch das Regime auferlegten Grenzen aufgezeigt werden. Dabei soll vor allem auf die spezifischen, den südafrikanischen Kontext betreffenden Aspekte, wie Rassentrennung und Rassismus, zunehmende Unterdrückung und Gewalt seitens des Regimes und staatliche Kontrolle und Zensur eingegangen werden.
Hierbei soll der Punk sowohl als Musik- als auch als Gegenkultur betrachtet werden. Zu klären ist die Frage, ob der Punk, durch seine politische, systemkritische Haltung eine Pionierstellung im Kampf gegen das repressive Apartheid-Regime einnahm und zwischen den bis dato separierten Kulturen vermittelte.
Schlussendlich möchte ich den Punk auch nach Ende der Apartheid betrachten und herausstellen, ob er noch einen politischen Anspruch hegt, wie groß dieser ist und welche Bereiche er thematisiert. Ich möchte außerdem kurz darauf eingehen, wie sich die Musiklandschaft im Allgemeinen und der Punk im Speziellen durch den neuerlichen Kontakt lange Zeit separierter Kulturen verändert hat.
Außerdem möchte ich im Anschluss einen Ausblick auf die mögliche Zukunft des südafrikanischen Punks geben, konstruktive Kritik an seiner Praxis äußern und mögliche, bisher nicht genutzte Chancen aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Musik als Befreiungsschlag
- Entstehung des Punkrocks und sein politisches Potenzial
- Anarchismus und die Ablehnung kommerzieller Strukturen
- Antirassismus
- Adaption des Punks in Südafrika
- Punk als Kultur der Weißen
- Frauen im südafrikanischen Punk
- Aufstieg des politischen Punks in Südafrika
- Der südafrikanische Hardcore Punk
- Solidarität aus dem Ausland
- Punkrock als Sprachrohr – Aufklärung und Mobilisierung der Bevölkerung
- Multikulturalität im südafrikanischen Punk
- Grenzen des Punks
- Punk in der Apartheid - ein Fazit
- Punk nach Ende der Apartheid
- Politischer Anspruch im Post-Apartheid-Punk
- Die Zukunft des südafrikanischen Punks - ein weiteres Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beleuchtet die Entwicklung des südafrikanischen Punkrocks im Kontext der Apartheid und analysiert seine Rolle als politische Gegenkultur. Sie untersucht, wie Punk als musikalischer Ausdruck der Rebellion und Verweigerung die Gesellschaft im Kampf gegen Unterdrückung, Rassentrennung und Ungleichheit beeinflusste.
- Punk als Musik der Rebellion und Verweigerung
- Politisches Potenzial des Punks im Kampf gegen die Apartheid
- Punk als Katalysator für soziale Veränderung und Multikulturalität
- Grenzen des Punks und Herausforderungen im Umgang mit dem Apartheid-Regime
- Entwicklung des südafrikanischen Punks nach Ende der Apartheid
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und beleuchtet die besondere Situation Südafrikas im Zeichen der Apartheid. Sie führt in das Thema Punk als Gegenkultur ein und stellt die zentrale Frage nach seiner Rolle im Kampf gegen das repressive Regime.
- Musik als Befreiungsschlag: Dieses Kapitel untersucht die politische Bedeutung von Musik, insbesondere im Hinblick auf die Rolle, die sie bei der Herausbildung von Identität und dem Kampf gegen soziale und politische Missstände spielen kann.
- Entstehung des Punkrocks und sein politisches Potenzial: Dieses Kapitel beleuchtet die Ursprünge der Punkbewegung in Großbritannien und erklärt, wie sie als Reaktion auf soziale und politische Ungleichheiten entstand. Es beschreibt das politische Potenzial des Punks, das in seiner Musik, seinen Texten und seiner Lebensphilosophie zum Ausdruck kommt.
- Adaption des Punks in Südafrika: Dieses Kapitel beleuchtet die Adaption des Punks in Südafrika und die Herausforderungen, die sich aufgrund der Apartheid stellten. Es geht auf die Rolle des Punks als Kultur der Weißen ein und untersucht die Position von Frauen innerhalb der Punkbewegung.
- Aufstieg des politischen Punks in Südafrika: Dieses Kapitel beschreibt den Aufstieg des politischen Punks in Südafrika und seine Rolle im Kampf gegen die Apartheid. Es analysiert die Verbindung zum internationalen Punkrock, die politische Bedeutung des Hardcore-Punks und die Grenzen, die das Regime dem Punkrock auferlegte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Punkrock, Apartheid, Rebellion, politische Gegenkultur, Rassentrennung, Rassismus, Soziale Ungleichheit, Multikulturalität, Identität, Veränderung, Musik als politisches Instrument, Hardcore-Punk, Anarchismus, Nonkonformismus, und Zensur.
- Quote paper
- Ariane Petschow (Author), 2012, Punk in Südafrika, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193843