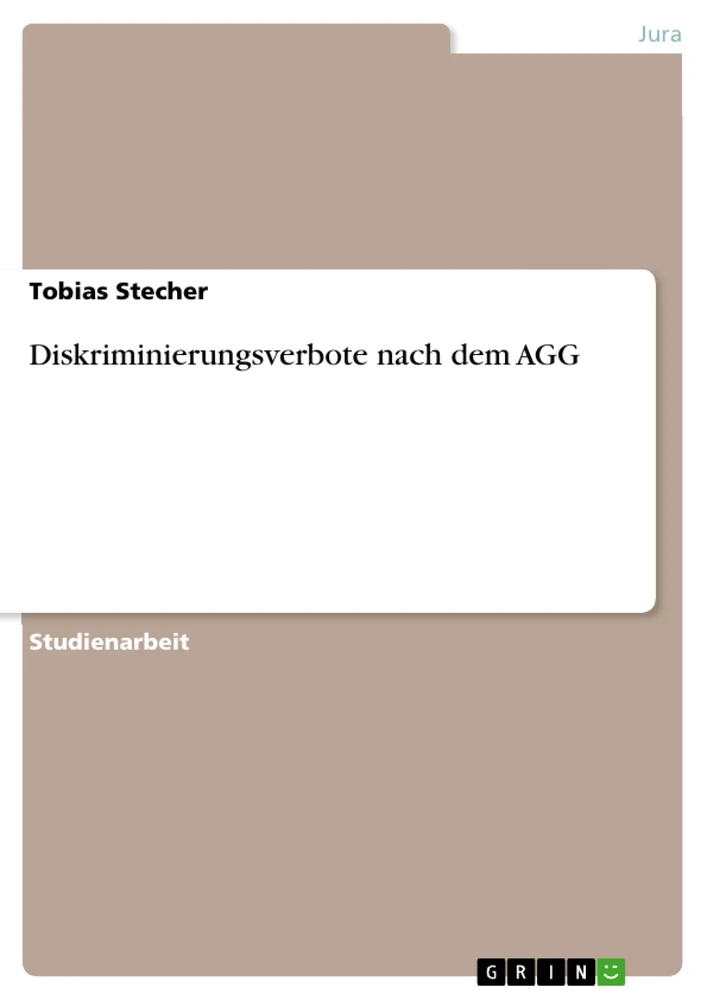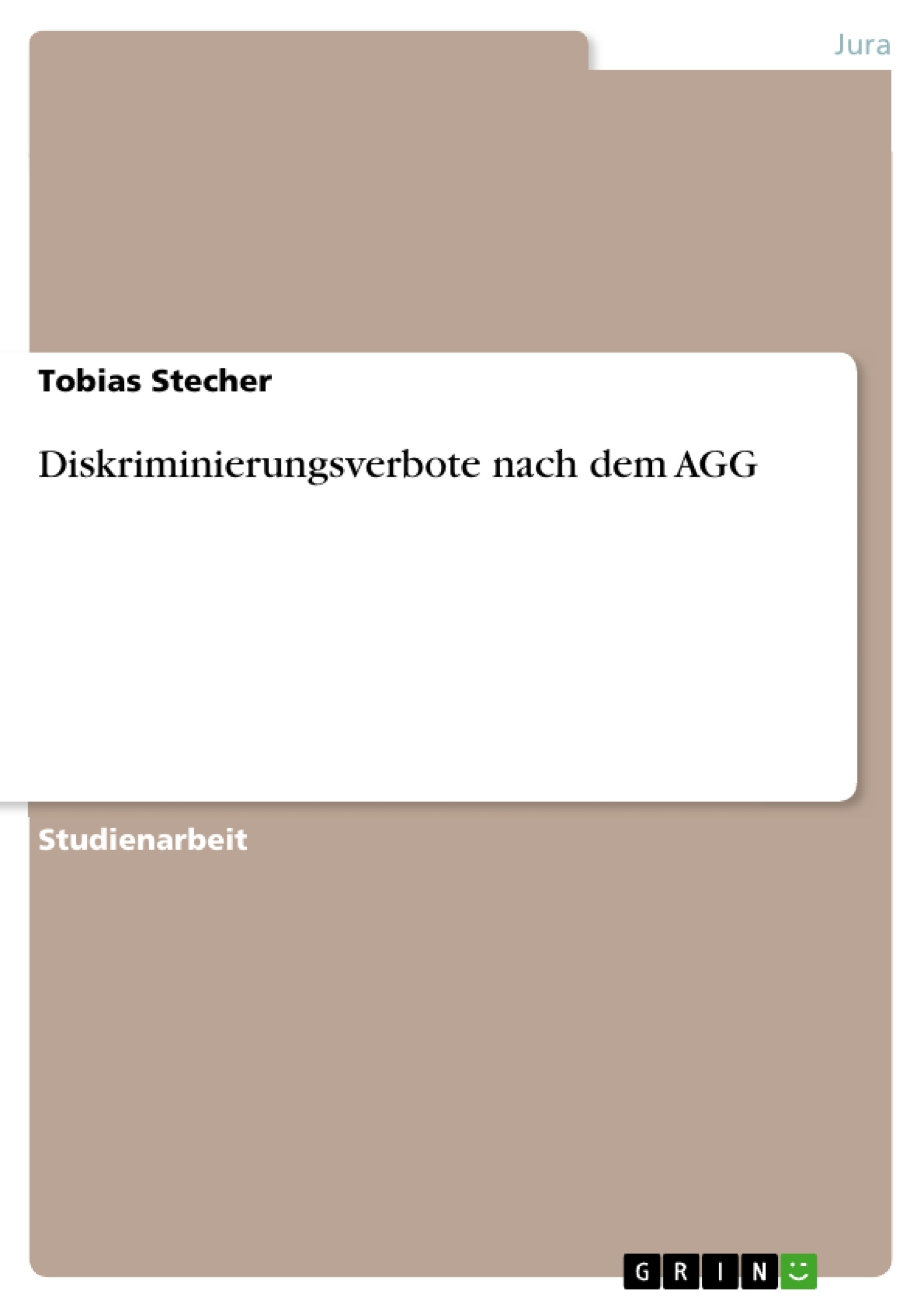Basierend auf Art. 13 EG-Vertrag, welcher Diskriminierungen der Rasse, der ethni-schen Herkunft, wegen des Geschlechts, der Religion, der Weltanschauung, einer Be-hinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung beseitigen und verhindern soll, und Art. 141 EG-Vertrag, welcher gleiches Entgelt für gleiche Arbeit unabhängig des Geschlechts vorschreibt, verabschiedete der Europäische Rat die folgenden vier Richtli-nien, die gemäß Art. 249 EG-Vertrag binnen einer gewissen Frist in nationales Gesetz umgewandelt werden müssen:
- "Antirassismus-Richtlinie“ 2000/43/EG vom 29. Juni 2000 für eine Gleichbe-handlung unabhängig der Rasse oder der ethnischen Herkunft,
- „Rahmen-Richtlinie“ 2000/78/EG vom 27. November 2000 für eine Gleichbe-handlung unabhängig der Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Identität in Beschäftigung und Beruf,
- Richtlinie 2002/73/EG vom 23. September 2002 für eine Gleichbehandlung der Geschlechter beim Zugang zu einer Beschäftigung, bei der Berufsbildung und beim beruflichen Aufstieg,
- Richtlinie 2004/113/EG vom 13. Dezember 2004 für eine Gleichbehandlung der Geschlechter außerhalb des Beschäftigungsbereichs.
Der Bundestag hat diese Richtlinien in Form des „Gesetzes zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung“ am 14.08.2006 beschlossen und in deutsches Recht transformiert. Formal ist das Gesetz in vier Artikel gegliedert. Art. 1 enthält das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zum Schutz vor Benachteiligung. Dabei unterteilt sich das AGG in sieben Abschnitte und findet sowohl im Arbeits- als auch im Zivilrecht Anwendung.
Diese Hausarbeit beschäftigt sich vornehmlich mit Abschnitt 2. Dieser umfasst den Diskriminierungsschutz im Arbeitsrecht und bildet den Kern des AGG. Das Gesetz verbietet allerdings nicht jede Form einer unterschiedlichen Behandlung, da im Ab-schnitt 1 nur bestimmte Diskriminierungsmerkmale, die die Grundlage für Abschnitt 2 bilden, als schutzbedürftig definiert sind. Im Zuge dieser Hausarbeit werden diese Merkmale zunächst beschrieben und Praxisbeispiele genannt, um anschließend die Formen der Benachteiligung näher zu erläutern und die Hausarbeit mit einem Fazit ab-zuschließen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungs- und Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- Geschützte Merkmale nach § 1 AGG
- Rasse
- Ethnische Herkunft
- Geschlecht
- Religion oder Weltanschauung
- Behinderung
- Alter
- Sexuelle Ausrichtung
- Formen der Benachteiligung
- Unmittelbare Benachteiligung
- Mittelbare Benachteiligung
- Belästigung
- Sexuelle Belästigung
- Anweisung zur Benachteiligung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Diskriminierungsverbote im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und beleuchtet die geschützten Merkmale und Formen der Benachteiligung im Arbeitsrecht. Sie untersucht, wie das AGG in verschiedenen Phasen des Arbeitsverhältnisses Anwendung findet, und beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine diskriminierungsfreie Arbeitswelt.
- Die geschützten Merkmale nach § 1 AGG, wie Rasse, ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion, Behinderung, Alter und sexuelle Ausrichtung
- Die verschiedenen Formen der Benachteiligung nach dem AGG, wie unmittelbare und mittelbare Benachteiligung, Belästigung, sexuelle Belästigung und Anweisung zur Benachteiligung
- Die Anwendung des AGG in verschiedenen Phasen des Arbeitsverhältnisses, vom Einstellungsprozess über den beruflichen Aufstieg bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine diskriminierungsfreie Arbeitswelt
- Die Bedeutung des AGG für den Schutz vor Benachteiligung und die Förderung einer gerechten Arbeitswelt
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung beleuchtet den rechtlichen Hintergrund des AGG und erläutert dessen Entstehung und Bedeutung. Die Arbeit konzentriert sich auf den Diskriminierungsschutz im Arbeitsrecht, der im Abschnitt 2 des AGG geregelt ist.
- Kapitel 2 beschreibt die geschützten Merkmale nach § 1 AGG, die Grundlage für den Diskriminierungsschutz im Arbeitsrecht bilden. Es werden Beispiele für die verschiedenen Merkmale und ihre Bedeutung in der Praxis genannt.
- Kapitel 3 erläutert die verschiedenen Formen der Benachteiligung, die das AGG verbietet, wie unmittelbare und mittelbare Benachteiligung, Belästigung und sexuelle Belästigung.
Schlüsselwörter
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Diskriminierungsverbote, geschützte Merkmale, Rasse, ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion, Behinderung, Alter, sexuelle Ausrichtung, unmittelbare Benachteiligung, mittelbare Benachteiligung, Belästigung, sexuelle Belästigung, Arbeitsrecht, Arbeitsverhältnis.
Häufig gestellte Fragen zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Welche Merkmale schützt das AGG?
Das AGG schützt vor Diskriminierung aufgrund der Rasse, ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion, Weltanschauung, Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität.
Was ist der Unterschied zwischen unmittelbarer und mittelbarer Benachteiligung?
Unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn jemand direkt schlechter behandelt wird; mittelbare bei scheinbar neutralen Regeln, die bestimmte Gruppen faktisch benachteiligen.
Gilt das AGG nur für bereits angestellte Mitarbeiter?
Nein, es findet in allen Phasen Anwendung, vom Einstellungsprozess (Stellenausschreibung) bis zur Kündigung.
Wann trat das AGG in Deutschland in Kraft?
Das Gesetz wurde am 14. August 2006 beschlossen, um entsprechende EU-Richtlinien in deutsches Recht umzusetzen.
Sind Belästigung und sexuelle Belästigung laut AGG verboten?
Ja, beide Formen werden im Gesetz explizit als Formen der Benachteiligung definiert und untersagt.
- Citar trabajo
- Tobias Stecher (Autor), 2012, Diskriminierungsverbote nach dem AGG, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193861