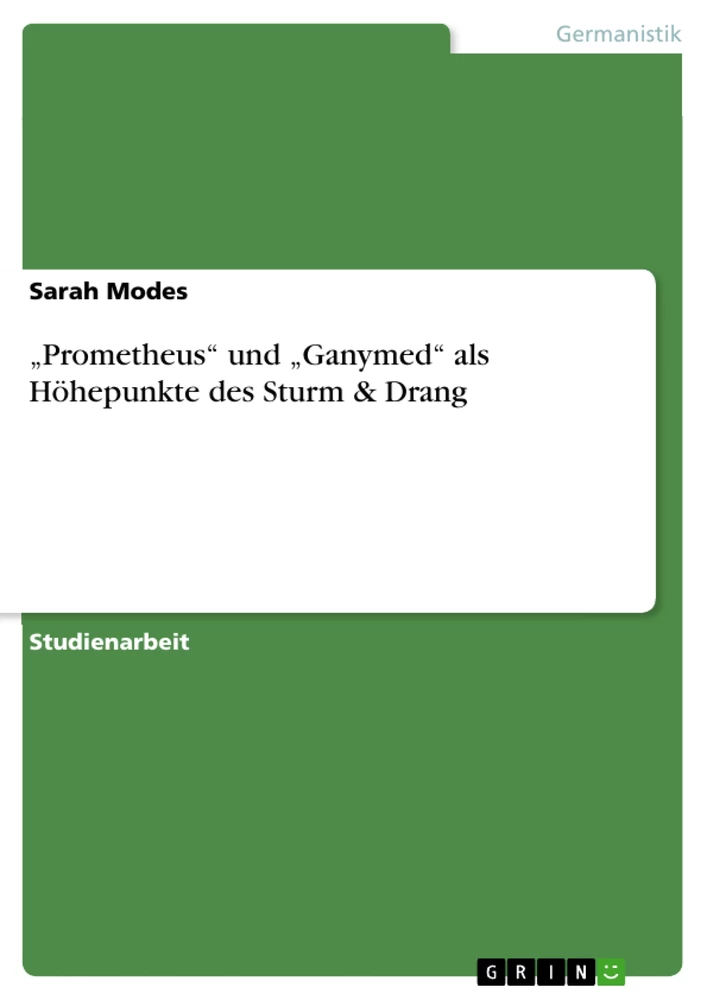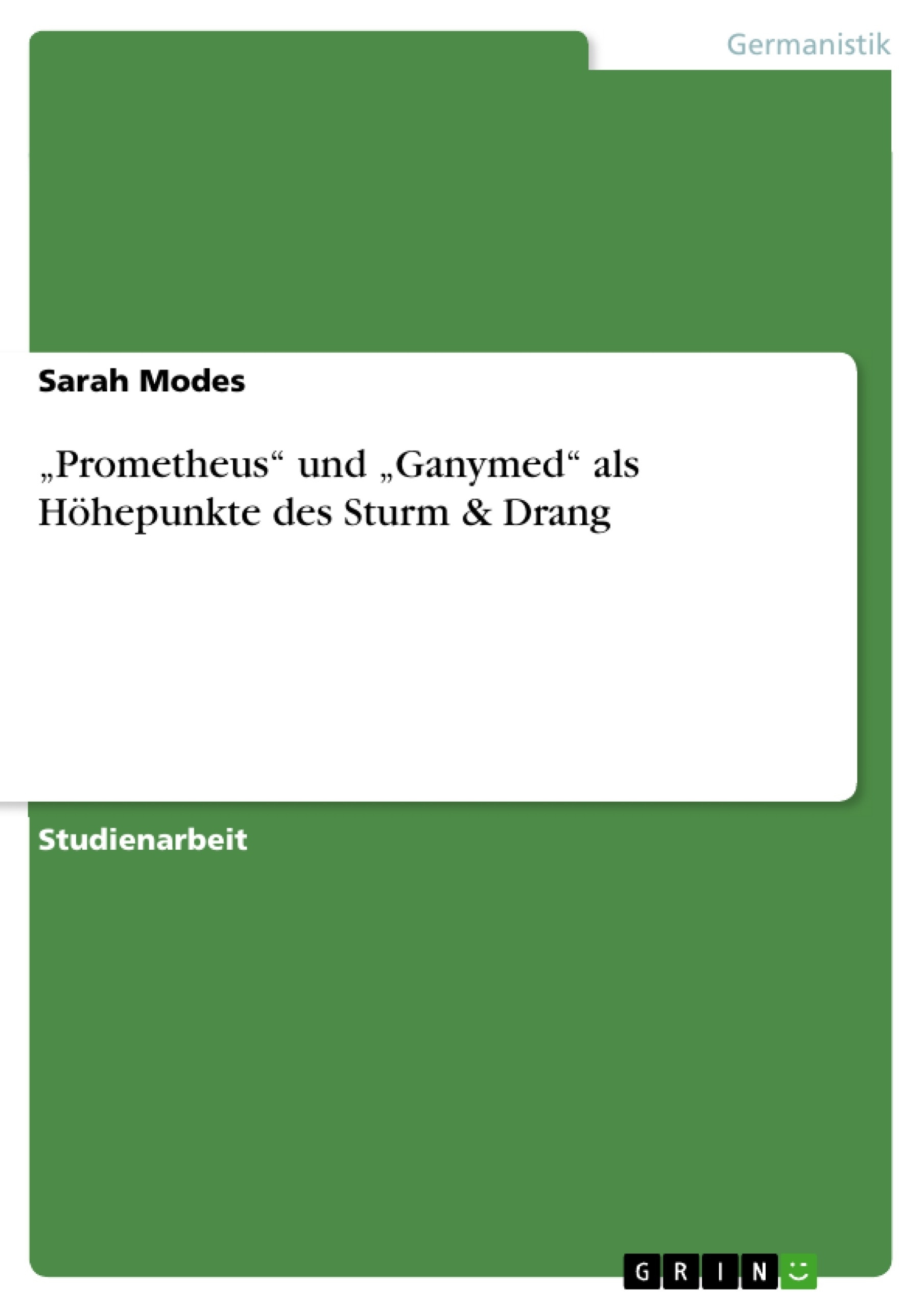Der Text befasst sich mit den beiden Hymnen "Prometheus" und "Ganymed" von J.W. Goethe. Es erfolgt eine Definition von "Hymne", die Epoche des Sturm und Drang wird näher beschrieben und die Biographie von J.W. Goethe vorgestellt. Daraufhin erfolgt die Bearbeitung jener Hymnen und ein abschließender Vergleich.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen und Erläuterungen
- Hymne
- Sturm- und Drangzeit, Geniekult
- Prometheus
- Mythologische Figur
- Entstehung und Erstdruck
- Interpretation
- Ganymed
- Mythologische Figur
- Entstehung und Thematik
- Interpretation
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Goethes Hymnen „Prometheus“ und „Ganymed“ im Kontext der Sturm- und Drangzeit. Ziel ist es, die Bedeutung dieser Werke als Höhepunkte der Epoche herauszustellen und deren Bedeutung für die Entwicklung des neuen Lebensgefühls und des Selbstverständnisses des Individuums im 18. Jahrhundert aufzuzeigen. Darüber hinaus soll die Beziehung zwischen den beiden Hymnen beleuchtet werden, die sich auf den ersten Blick antagonistisch gegenüberstehen, aber in ihren Grundgedanken eine komplementäre Beziehung zueinander aufweisen.
- Die Bedeutung der Sturm- und Drangzeit für die literarische Entwicklung
- Das Selbstverständnis des Individuums im Sturm und Drang
- Die Rolle des Genies in der Epoche
- Die Analyse der beiden Hymnen „Prometheus“ und „Ganymed“
- Die komplementäre Beziehung zwischen den beiden Werken
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die beiden Hymnen „Prometheus“ und „Ganymed“ als maßgebliche Höhepunkte der Sturm- und Drangzeit vor. Sie beleuchtet das neue Lebensgefühl und das Selbstbewusstsein des Individuums, das sich in der Epoche gegen rückständige Autoritäten auflehnte und eine fortschrittliche Menschheit forderte. Die Einleitung betont die scheinbar antagonistische Beziehung zwischen den beiden Hymnen und deutet auf deren komplementäre Beziehung hin, die durch Goethes eigene Interpretation und die gemeinsame Publikation in seinen Werksausgaben unterstrichen wird.
Definitionen und Erläuterungen
Hymne
Dieser Abschnitt definiert die Hymne als eine lyrische Gattung, die ihre Wurzeln in der Antike hat und sich durch einen feierlichen, kultisch-religiösen Lobgesang auf eine göttliche oder übergeordnete Instanz auszeichnet. Die Hymne in der Neuzeit behält ihren feierlichen Charakter, öffnet sich aber gleichzeitig für die Darstellung natürlicher und innerweltlicher Themen.
Sturm und Drangzeit, Geniekult
Dieser Abschnitt beleuchtet die literarische Bewegung des Sturm und Drang, ihre Entstehung und ihre wichtigsten Merkmale. Er betont die Revolte gegen die Einseitigkeiten der Aufklärung und die Kritik an der bestehenden Gesellschaftsordnung. Der Fokus liegt auf der Selbsterfahrung und Befreiung des Individuums, das seinen eigenen Wert und seine eigene Kraft erkennt und sich gegen die Welt stellt. Der Abschnitt erläutert die Bedeutung des Genies als schöpferische Kraft, die frei von Regeln und Gesetzen agiert und eine einzigartige Kunst hervorbringt.
Prometheus
Mythologische Figur
Dieser Abschnitt präsentiert die mythologische Figur des Prometheus, dessen Geschichte aus der griechischen Mythologie bekannt ist. Prometheus, der Titan, stahl den Göttern das Feuer und brachte es den Menschen. Diese Tat machte ihn zu einem Helden, der für den Fortschritt der Menschheit eintrat.
Entstehung und Erstdruck
Dieser Abschnitt beschreibt die Entstehungsgeschichte von Goethes „Prometheus“ und dessen Erstpublikation.
Interpretation
Dieser Abschnitt untersucht die Interpretation von Goethes „Prometheus“ und seine Bedeutung für die Epoche. Er betrachtet die Hymne im Kontext des Geniekults und der Kritik an der göttlichen Autorität.
Ganymed
Mythologische Figur
Dieser Abschnitt präsentiert die mythologische Figur des Ganymed, dessen Geschichte aus der griechischen Mythologie bekannt ist. Ganymed wurde vom Gott Zeus entführt und wurde zum Mundschenken der Götter am Olymp.
Entstehung und Thematik
Dieser Abschnitt beschreibt die Entstehungsgeschichte von Goethes „Ganymed“ und seine Thematik. Er untersucht die Rolle der Liebe und der Sehnsucht in der Hymne.
Interpretation
Dieser Abschnitt analysiert die Interpretation von Goethes „Ganymed“ und seine Bedeutung für die Epoche. Er untersucht das Verhältnis des Menschen zum Göttlichen und das Streben nach Harmonie und Vereinigung.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Sturm und Drang, Geniezeit, Hymne, Prometheus, Ganymed, Selbstbewusstsein, Individualismus, Geniekult, Kritik, Aufklärung, Mythologie, komplementäre Beziehung, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Was charakterisiert die Epoche des „Sturm und Drang“?
Die Epoche (ca. 1767–1785) ist geprägt von einer Revolte gegen die Einseitigkeit der Aufklärung, dem Fokus auf Gefühl, Natur, Individualismus und dem sogenannten „Geniekult“.
Warum gelten „Prometheus“ und „Ganymed“ als Höhepunkte dieser Zeit?
Beide Hymnen verkörpern das neue Lebensgefühl Goethes. „Prometheus“ steht für die Auflehnung des schöpferischen Individuums gegen göttliche Autorität, während „Ganymed“ die sehnsüchtige Vereinigung mit dem Göttlichen in der Natur thematisiert.
Was bedeutet der Begriff „Hymne“ in der Literatur?
Eine Hymne ist ein feierlicher Lobgesang. In der Neuzeit und speziell bei Goethe zeichnet sie sich durch freie Rhythmen und den Ausdruck starker Gefühle oder philosophischer Ideen aus.
In welchem Verhältnis stehen Prometheus und Ganymed zueinander?
Sie stehen in einer komplementären Beziehung: Während Prometheus die Autonomie und den Trotz des Menschen betont, zeigt Ganymed die liebende Hingabe und das Streben nach Harmonie mit dem All-Einen.
Wer war die mythologische Figur des Prometheus?
In der griechischen Mythologie ist Prometheus ein Titan, der den Göttern das Feuer stahl, um es den Menschen zu bringen, und somit zum Urheber der menschlichen Zivilisation wurde.
- Arbeit zitieren
- Sarah Modes (Autor:in), 2010, „Prometheus“ und „Ganymed“ als Höhepunkte des Sturm & Drang, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193866