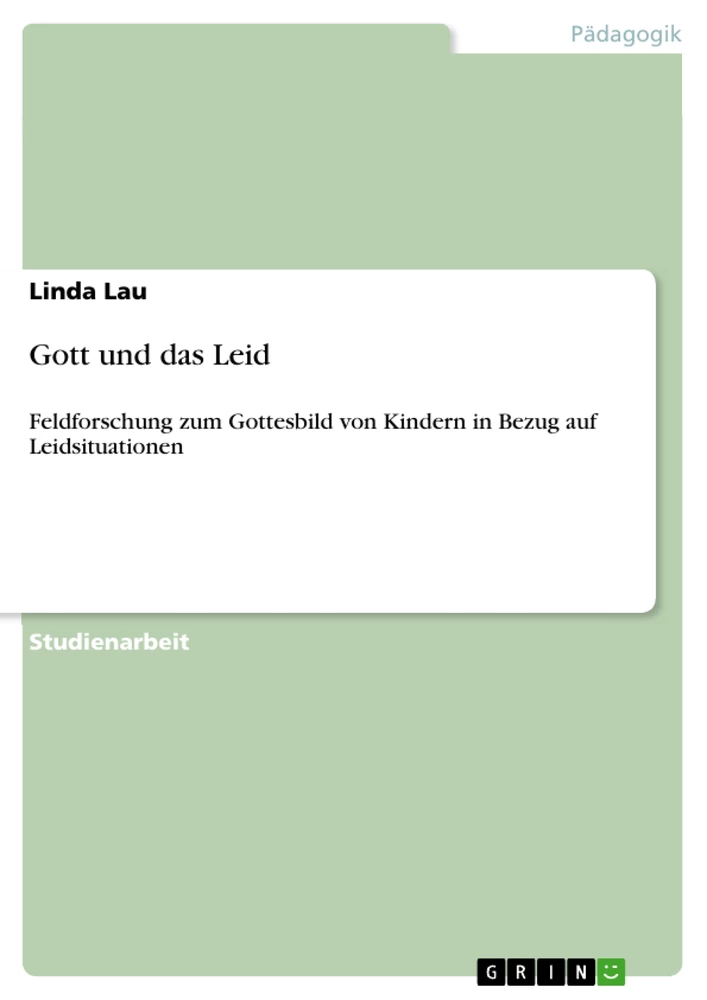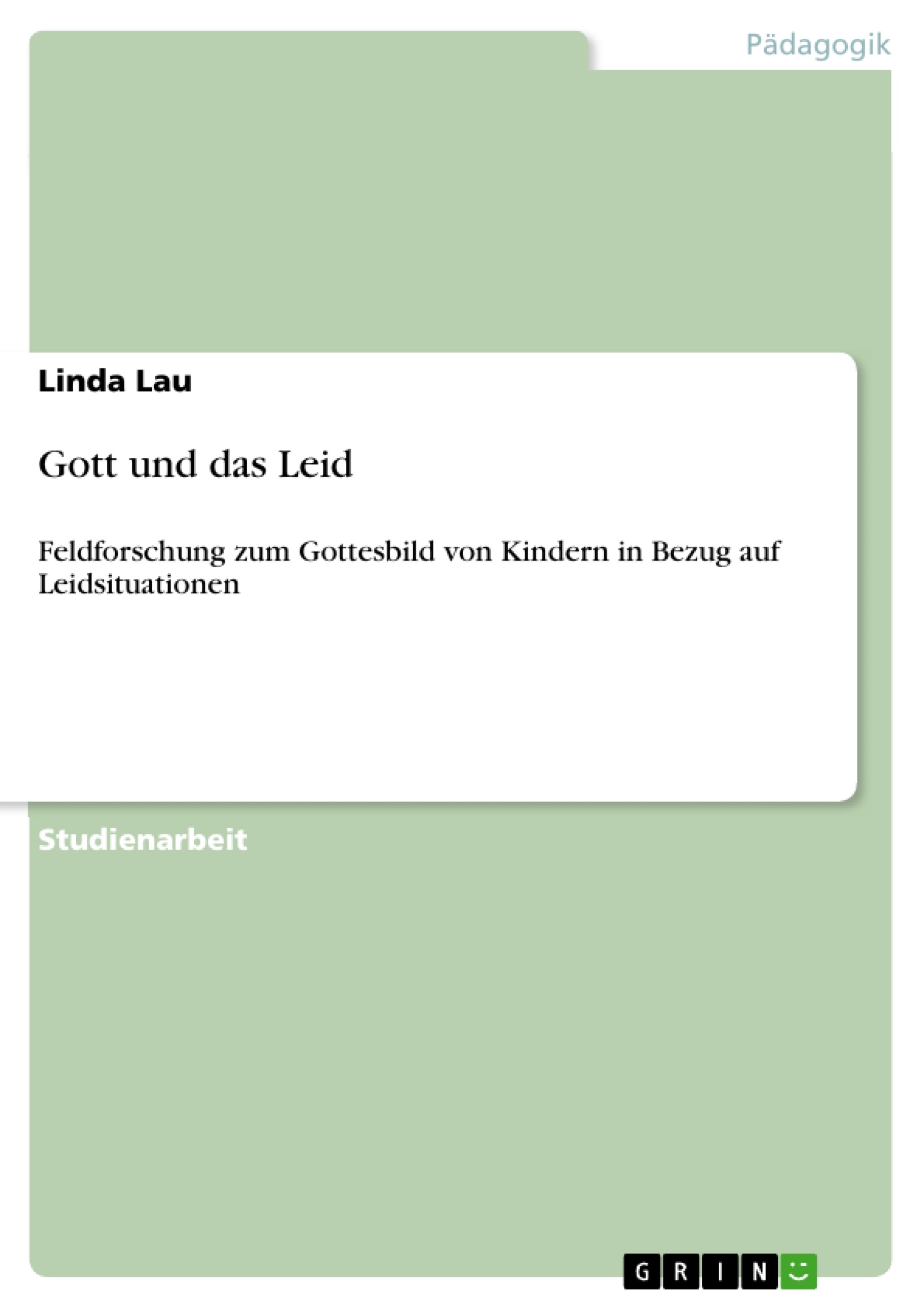„Wenn er will und nicht kann, dann ist er schwach; was auf Gott nicht zutrifft. Wenn er kann und nicht will, [dann ist er] schlecht, was ihm ebenfalls fremd ist. Wenn er nicht will und nicht kann, ist er schwach und schlecht und somit auch kein Gott. Wenn er will und kann, was allein Gott angemessen ist, woher kommen die Übel? Und warum beseitigt er sie nicht?“1
Dieses Zitat ist über 2000 Jahre alt. Es stammt von dem griechischen Philosophen Epikur. Die Frage nach Gott und dem Leid ist insofern eine uralte Frage, aber auch in der heutigen Welt spielt das Leid eine entscheidende Rolle! Dabei können Leiderfahrungen von Mensch zu Mensch grundverschieden sein. Auch (jüngere) Kinder stellen sich bereits die Frage, wie ein guter Gott all das Leid auf der Welt überhaupt zulassen kann oder wo das Leid in der Welt eigentlich herkommt.
So verschieden menschliche Leiderfahrungen sein können, so verschieden sind auch die Antworten auf die Theodizeefrage. Womöglich gibt es eine zweite widergöttliche Macht, die Gottes Allmacht in irgendeiner Weise begrenzt. Oder aber das Leid entsteht durch den Missbrauch der Selbstverantwortlichkeit der Menschen. Leiderfahrungen können darüber hinaus auch als Strafe Gottes gedeutet werden. Andererseits besteht die Möglichkeit, dass Gott absichtlich nicht eingreift, um die Menschen aus Leidsituationen in bestimmter Weise lernen zu lassen.2
Im Rahmen des Seminars „Religiöse Sozialisation – Religion bei Kindern und Jugendlichen“ soll es in dieser Arbeit darum gehen, welche Vorstellungen Kinder vom Wirken Gottes in Leidsituationen haben. Dabei ist von entscheidender Bedeutung, in welcher persönlichen Entwicklungsstufe sie sich gerade befinden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Allgemeine Einleitung
- 1.1. Reflexion von Leiderfahrungen
- 1.2. Religiöse Sozialisation
- 1.3. Vorgehensweise
- 2. Theorieteil - Die religiöse Urteilsfähigkeit von Kindern
- 2.1. Oser/Gmünder: „Stufen des religiösen Urteils“
- 2.1.1. Grundprinzipien und Grundfragen der Theorie
- 2.1.2. Kritische Stellungnahme
- 2.2. Religionspädagogische Relevanz des Theorieansatzes
- 3. Praxisteil - Gott zwischen Glück und Leid
- 3.1. Planung
- 3.2. Durchführung: Celine
- 3.3. Durchführung: Leonie
- 3.4. Reflexion
- 4. Ausblick: eigene Überlegungen zur Theodizeefrage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vorstellungen von Kindern über Gottes Wirken in Leidsituationen, unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Entwicklungsstufen. Die Feldforschung analysiert Kindergottesbilder im Kontext von Leid und setzt diese mit dem theoretischen Ansatz von Oser/Gmünder zur Entwicklung des religiösen Urteils in Beziehung.
- Entwicklung des religiösen Urteils bei Kindern
- Kindergottesbilder und die Theodizee
- Einfluss religiöser Sozialisation auf die Verarbeitung von Leid
- Religionspädagogische Implikationen der Forschungsergebnisse
- Anwendung des Modells von Oser/Gmünder auf empirische Daten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Allgemeine Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik von Leid und Gottesvorstellungen bei Kindern ein. Sie verortet die Forschungsfrage im Kontext der religiösen Sozialisation und beschreibt die Vorgehensweise der Arbeit, welche die Verbindung zwischen einer empirischen Feldforschung und dem theoretischen Modell von Oser/Gmünder zum religiösen Urteil herstellt. Das Epikur-Zitat verdeutlicht die historische Relevanz der Theodizeefrage, während die Ausführungen zur religiösen Sozialisation den theoretischen Rahmen der Studie setzen. Die methodische Vorgehensweise wird skizziert, bestehend aus einem Theorieteil und einem Praxisteil mit Feldforschung.
2. Theorieteil - Die religiöse Urteilsfähigkeit von Kindern: Dieses Kapitel präsentiert den theoretischen Rahmen der Arbeit, fokussiert auf das Stufenmodell des religiösen Urteils von Oser/Gmünder. Es werden die Grundprinzipien und Grundfragen der Theorie erläutert, die sechs Stufen des Modells beschrieben und die religionspädagogische Relevanz des Ansatzes diskutiert. Der Ansatz wird im Kontext anderer Entwicklungstheorien (Piaget, Erikson, Fowler, Kohlberg) verortet, um seine spezifischen Beiträge zur Erforschung der religiösen Entwicklung hervorzuheben und kritisch zu reflektieren. Die Beschreibung der einzelnen Stufen beinhaltet die jeweiligen Charakteristika und zeigt die Entwicklung der Gottesvorstellungen vom autoritären Gott hin zu einem Verständnis von Gottes Wirken im Rahmen der menschlichen Freiheit.
3. Praxisteil - Gott zwischen Glück und Leid: Dieser Abschnitt beschreibt die durchgeführte Feldforschung mit zwei Probandinnen im Alter von neun und zehn Jahren. Die Planungsphase, inklusive der Forschungsfrage, die Auswahl der Probandinnen und die Begründung der Methodenwahl werden detailliert dargelegt. Die Durchführung umfasst die Beschreibung der Begegnungen mit den Kindern, die Auswertung der Bildanalysen und Interviews. Der Vergleich der Ergebnisse beider Fälle, sowie die Einordnung der Ergebnisse in das Modell von Oser/Gmünder und die daraus resultierenden didaktischen Perspektiven werden hier diskutiert. Die Reflexion der Ergebnisse ist ein zentraler Bestandteil, der die empirischen Befunde mit der Theorie verbindet und religionspädagogische Schlussfolgerungen für den Religionsunterricht ableitet.
Schlüsselwörter
Religiöse Sozialisation, Kindergottesbild, Leid, Theodizee, Oser/Gmünder, Stufen des religiösen Urteils, Feldforschung, Religionspädagogik, Religionsunterricht, Entwicklung des Glaubens.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Gott zwischen Glück und Leid - Kindergottesbilder im Kontext von Leid und die Entwicklung des religiösen Urteils"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Vorstellungen von Kindern über Gottes Wirken in Leidsituationen und deren Entwicklung. Sie verbindet empirische Forschung mit dem theoretischen Modell von Oser/Gmünder zur Entwicklung des religiösen Urteils.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit kombiniert einen Theorieteil mit einem Praxisteil. Der Praxisteil besteht aus einer Feldforschung mit zwei neunjährigen Probandinnen. Die Daten wurden durch Interviews und Bildanalysen erhoben.
Welches theoretische Modell wird verwendet?
Das zentrale theoretische Modell ist das Stufenmodell des religiösen Urteils von Oser/Gmünder. Dieses Modell wird erläutert, kritisch reflektiert und auf die empirischen Daten angewendet.
Welche Aspekte der religiösen Entwicklung werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Entwicklung des religiösen Urteils bei Kindern, Kindergottesbilder im Kontext der Theodizee, den Einfluss religiöser Sozialisation auf die Verarbeitung von Leid und die religionspädagogischen Implikationen der Forschungsergebnisse.
Wer sind die Probanden?
Die Feldforschung wurde mit zwei Probandinnen im Alter von neun und zehn Jahren durchgeführt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Theorieteil (mit Fokus auf Oser/Gmünder), einen Praxisteil (mit Beschreibung der Feldforschung und Auswertung) und einen Ausblick.
Was sind die Kernergebnisse der Arbeit?
Die Kernergebnisse werden im Praxisteil und der Schlussfolgerung präsentiert und diskutieren, wie die Kinder Gottes Wirken in Leidsituationen verstehen und wie dies mit dem Modell von Oser/Gmünder in Verbindung steht. Religionspädagogische Schlussfolgerungen für den Religionsunterricht werden abgeleitet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Religiöse Sozialisation, Kindergottesbild, Leid, Theodizee, Oser/Gmünder, Stufen des religiösen Urteils, Feldforschung, Religionspädagogik, Religionsunterricht, Entwicklung des Glaubens.
Wie ist der Aufbau der Arbeit im Detail?
Die Arbeit beginnt mit einer allgemeinen Einleitung, die die Forschungsfrage, die methodische Vorgehensweise und den theoretischen Rahmen einführt. Der Theorieteil konzentriert sich auf das Modell von Oser/Gmünder zur Entwicklung des religiösen Urteils. Der Praxisteil beschreibt die Durchführung der Feldforschung, die Analyse der Daten und die Interpretation der Ergebnisse im Kontext des theoretischen Modells. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick ab, der eigene Überlegungen zur Theodizeefrage beinhaltet.
- Arbeit zitieren
- Linda Lau (Autor:in), 2011, Gott und das Leid, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193874