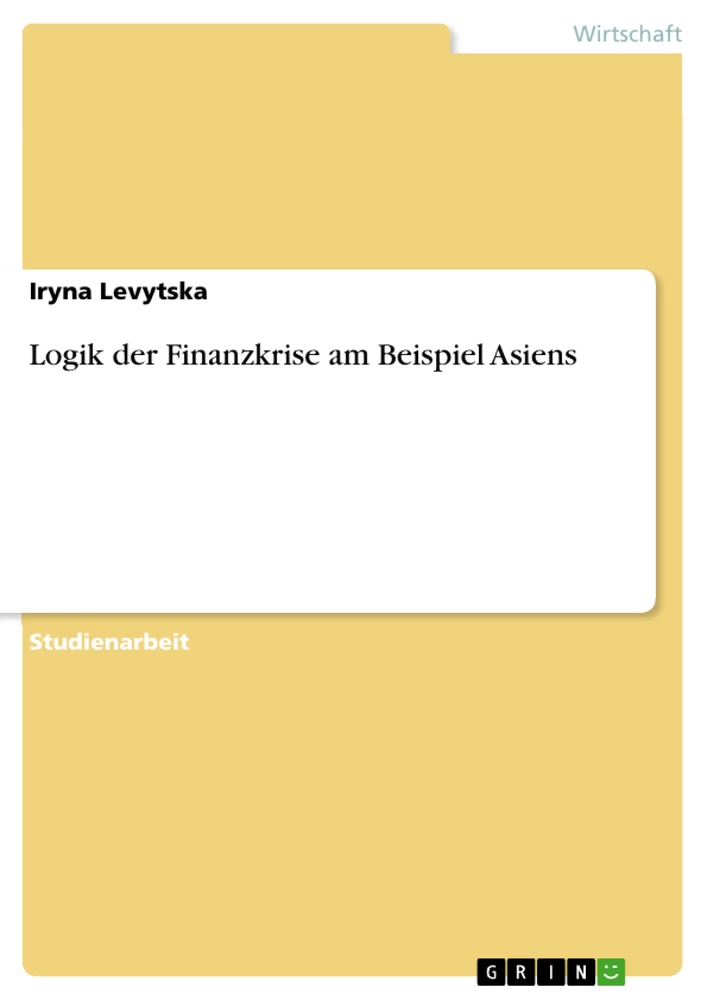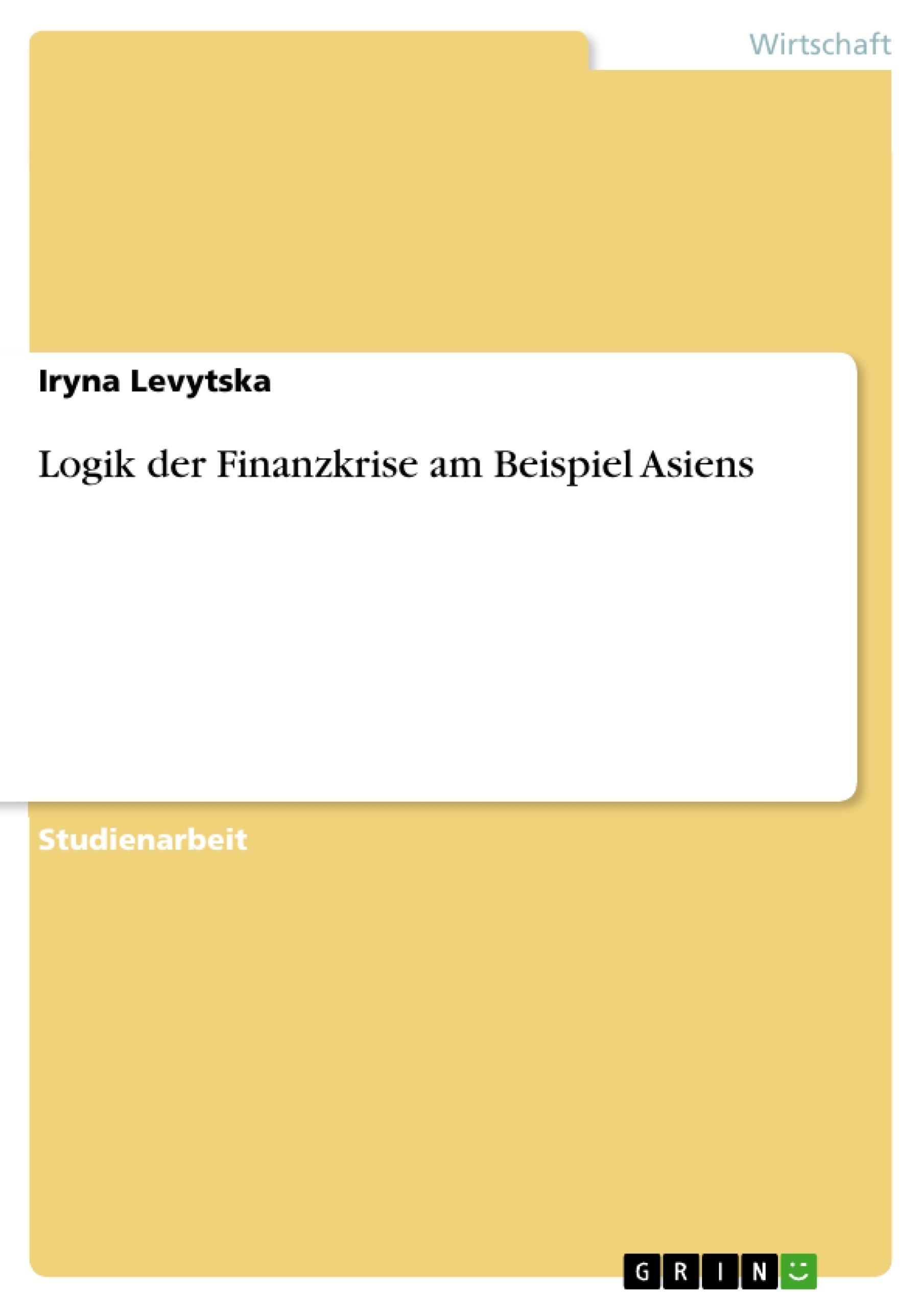Die Asienkrise wird als Währungs- und Finanzmarktkrise Ostasiens in den Jahren 1997/98 bezeichnet. Die Krise begann in Thailand und griff auf mehrere asiatische Länder über, insbesondere auf viele der so genannten Tigerstaaten.
Bis zur Asienkrise galten die ostasiatischen Schwellenländer als das Erfolgsmodell einer nachholenden Entwicklung. Mit jährlichen Wachstumsraten des Bruttosozialprodukts von über sieben Prozent haben sich die ostasiatischen Staaten zur zweitgrößten Industrienation der Welt entwickelt .
Plötzlich brach eine schwere Währungs- und Finanzmarktkrise in den ostasiatischen Ländern aus und bereitete dem 'asiatischen Wunder' ein abruptes Ende.
Im Vordergrund dieser Untersuchung werden in erster Linie die fünf am stärksten betroffenen Länder - Thailand, Indonesien, Südkorea, Malaysia und die Philippinen stehen. Dies heißt nicht, dass die Krise nicht auch in Singapur, Taiwan, Hongkong und China bedeutende Auswirkungen hat. Erheblich für das Verständnis der Krise sind aber die erstgenannten Länder, weil dort die Krise am schwersten war.
Daraus folgend entsteht die Frage: Wie kam es zu der Krisenanfälligkeit der asiatischen Länder, die den Boden für die global spürbaren Währungs- und Finanzmarktkrisen in den Jahren 1997/98 bereitete?
Um diese Frage zu beantworten wird in dieser Arbeit auf die nächsten wesentlichen Punkte eingegangen. Erstens ist es die Herausbildung eines instabilen Systems, das eine günstige Basis für die Asienkrise schuf. Zweitens wird der Ausbruch der Krise durch zwei alternative theoretische Ansätze erklärt. Danach werden die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Asienkrise dargestellt. In dem letzten Abschnitt wird über die Rolle des Internationalen Währungsfonds diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Herausbildung eines instabilen Systems
- Erklärungsansätze der Asienkrise
- Moral-Hazard-Ansatz
- Der Ansatz einer Finanzmarktpanik
- Auswirkungen der Krise
- Die Rolle des Internationalen Währungsfonds
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen der Asienkrise von 1997/98, konzentriert sich auf die fünf am stärksten betroffenen Länder (Thailand, Indonesien, Südkorea, Malaysia und die Philippinen) und analysiert die Rolle verschiedener Faktoren bei der Entstehung der Krise. Die Arbeit zielt darauf ab, die Krisenanfälligkeit dieser Länder zu erklären und die Bedeutung verschiedener theoretischer Ansätze zu bewerten.
- Herausbildung eines instabilen Finanzsystems in Ostasien
- Analyse der Moral-Hazard-These und des Ansatzes der Finanzmarktpanik
- Wirtschaftliche und soziale Folgen der Asienkrise
- Die Rolle des Internationalen Währungsfonds (IWF) während der Krise
- Bewertung der Krisenanfälligkeit der asiatischen Länder
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Asienkrise als Währungs- und Finanzmarktkrise in Ostasien 1997/98, die in Thailand begann und sich auf mehrere Länder ausbreitete. Sie stellt die ostasiatischen Schwellenländer vor der Krise als Erfolgsmodell dar und beschreibt den abrupten Umschwung. Die Arbeit fokussiert sich auf fünf stark betroffene Länder und untersucht die Ursachen der Krisenanfälligkeit.
Herausbildung eines instabilen Systems: Dieses Kapitel argumentiert, dass die Finanzmarktliberalisierung in Asien, der Zugang zu internationalen Kapitalmärkten und die daraus resultierende Kreditvergabepolitik eine zentrale Rolle bei der Entstehung der Krise spielten. Die Banken nahmen Kredite im Ausland zu niedrigen Zinsen auf, vergaben sie im Inland zu höheren Zinsen für Aktien- und Immobilienkauf, was zu einer spekulative Blase führte. Divergierende Laufzeiten und Währungen zwischen aufgenommenen und vergebenen Krediten, fehlende Wechselkursabsicherung und unzureichende Bankenaufsicht verschärften die Situation. Die hohe kurzfristige Auslandsverschuldung in US-Dollar im Verhältnis zu den Devisenreserven machte die Länder bei Fälligkeiten der Kredite verwundbar.
Erklärungsansätze der Asienkrise: Dieses Kapitel präsentiert zwei theoretische Ansätze zur Erklärung des Krisenausbruchs: den Moral-Hazard-Ansatz und den Ansatz einer Finanzmarktpanik. Der Moral-Hazard-Ansatz betont die Rolle der staatlichen Interventionen und impliziten Garantien, die zu exzessiver Risikobereitschaft führten. Der Ansatz der Finanzmarktpanik fokussiert auf die Rolle von Panikverkäufen und Herdenverhalten, die zu einem plötzlichen Kapitalabfluss führten. Die Arbeit analysiert die Stärken und Schwächen beider Ansätze in Bezug auf die Asienkrise.
Auswirkungen der Krise: Dieses Kapitel behandelt die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Asienkrise. Es dürfte detailliert die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die soziale Stabilität der betroffenen Länder beschreiben, möglicherweise unter Einbezug von Statistiken und konkreten Beispielen. Die Zusammenhänge zwischen der Finanzkrise und ihren Folgen werden analysiert.
Die Rolle des Internationalen Währungsfonds: Dieser Abschnitt analysiert die Rolle des IWF während der Krise, einschließlich der bereitgestellten Finanzhilfen und der damit verbundenen Auflagen. Es dürfte die Kontroversen um die IWF-Politik diskutieren und die Auswirkungen der Maßnahmen auf die betroffenen Länder bewerten. Die Debatte um die Wirksamkeit und die langfristigen Folgen des IWF-Engagements steht im Mittelpunkt.
Schlüsselwörter
Asienkrise, Finanzmarktliberalisierung, Moral Hazard, Finanzmarktpanik, Währungskrise, Kapitalabfluss, Schwellenländer, Ostasien, Internationaler Währungsfonds (IWF), Bankenaufsicht, Wechselkursrisiko, Kurzfristige Verschuldung, Devisenreserven.
Häufig gestellte Fragen zur Asienkrise
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht umfassend die Asienkrise von 1997/98, konzentriert sich dabei auf fünf stark betroffene Länder (Thailand, Indonesien, Südkorea, Malaysia und die Philippinen) und analysiert die Ursachen und Folgen dieser Währungs- und Finanzmarktkrise. Ein besonderer Fokus liegt auf der Erklärung der Krisenanfälligkeit dieser Länder und der Bewertung verschiedener theoretischer Ansätze.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Herausbildung eines instabilen Finanzsystems in Ostasien vor der Krise, analysiert den Moral-Hazard-Ansatz und den Ansatz der Finanzmarktpanik zur Erklärung des Krisenausbruchs, untersucht die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise und bewertet die Rolle des Internationalen Währungsfonds (IWF) während und nach der Krise. Die Bewertung der Krisenanfälligkeit der asiatischen Länder bildet einen weiteren Schwerpunkt.
Welche Faktoren werden als Ursachen der Asienkrise identifiziert?
Die Arbeit identifiziert die Finanzmarktliberalisierung, den Zugang zu internationalen Kapitalmärkten und die daraus resultierende Kreditvergabepolitik als zentrale Faktoren. Die Aufnahme von Krediten im Ausland zu niedrigen Zinsen und deren Vergabe im Inland zu höheren Zinsen für Aktien- und Immobilienkauf führten zu einer spekulativen Blase. Divergierende Laufzeiten und Währungen, fehlende Wechselkursabsicherung, unzureichende Bankenaufsicht und eine hohe kurzfristige Auslandsverschuldung in US-Dollar im Verhältnis zu den Devisenreserven verstärkten die Vulnerabilität der Länder.
Welche Erklärungsansätze für die Asienkrise werden diskutiert?
Die Arbeit präsentiert und analysiert den Moral-Hazard-Ansatz, der die Rolle staatlicher Interventionen und impliziter Garantien betont, und den Ansatz einer Finanzmarktpanik, der sich auf Panikverkäufe und Herdenverhalten konzentriert. Die Stärken und Schwächen beider Ansätze im Hinblick auf die Asienkrise werden kritisch bewertet.
Welche Folgen hatte die Asienkrise?
Die Arbeit beschreibt detailliert die negativen wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Asienkrise, einschließlich der Auswirkungen auf die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die soziale Stabilität der betroffenen Länder. Die Zusammenhänge zwischen der Finanzkrise und ihren Folgen werden analysiert, möglicherweise unter Einbezug von Statistiken und konkreten Beispielen.
Welche Rolle spielte der Internationale Währungsfonds (IWF)?
Die Arbeit analysiert die Rolle des IWF während der Krise, seine Finanzhilfen und die damit verbundenen Auflagen. Sie diskutiert die Kontroversen um die IWF-Politik und bewertet die Auswirkungen der IWF-Maßnahmen auf die betroffenen Länder. Die Debatte um die Wirksamkeit und die langfristigen Folgen des IWF-Engagements wird im Mittelpunkt stehen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Asienkrise, Finanzmarktliberalisierung, Moral Hazard, Finanzmarktpanik, Währungskrise, Kapitalabfluss, Schwellenländer, Ostasien, Internationaler Währungsfonds (IWF), Bankenaufsicht, Wechselkursrisiko, Kurzfristige Verschuldung, Devisenreserven.
- Quote paper
- Iryna Levytska (Author), 2009, Logik der Finanzkrise am Beispiel Asiens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193924