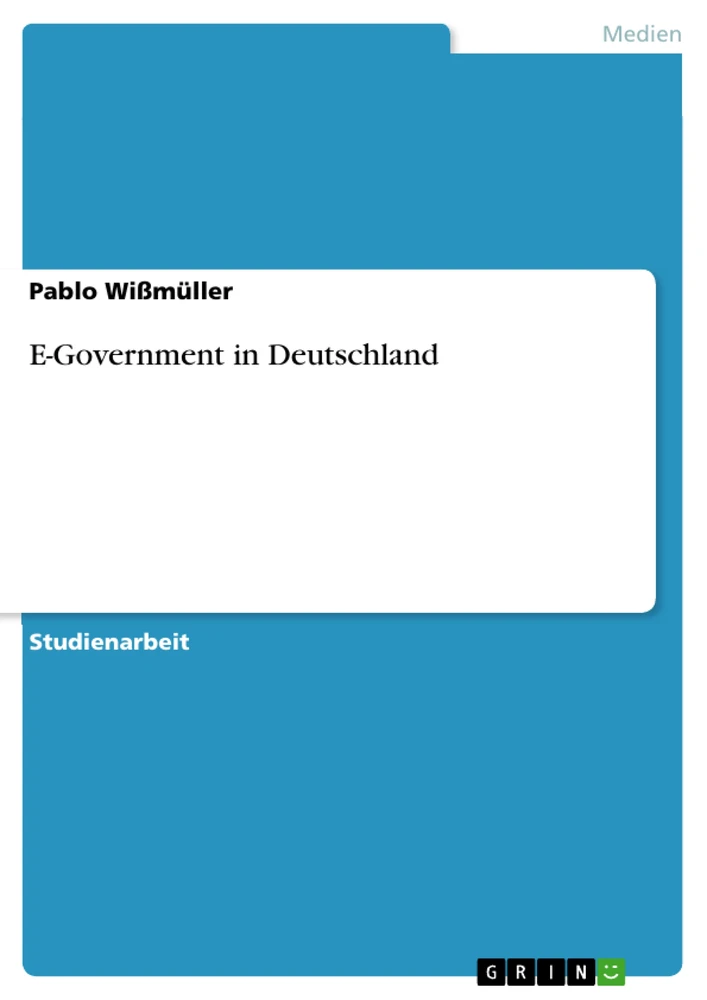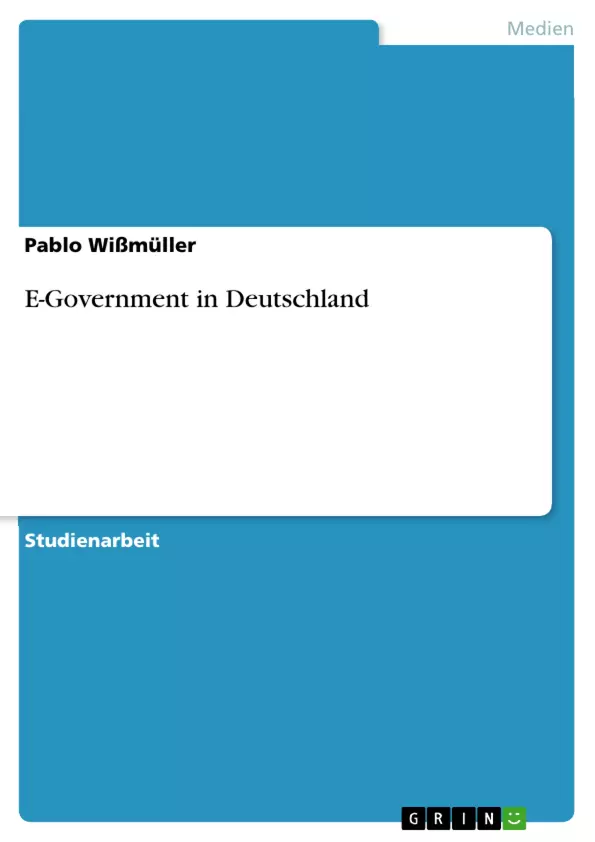Die rasante Entwicklung und zunehmende Verbreitung des Internets in den letzten Jahren eröffneten zunehmend neue Möglichkeiten der Informationsbeschaffung, -bereitstellung, Kommunikation und Transaktion für alle Partizipienten.
Auch der öffentliche Sektor erkannte frühzeitig, dass die Potenziale für eben diese Zwecke und als Schnittstelle zwischen Verwaltung und Bürger bzw. Privatwirtschaft fungieren kann. Neben der Begriffsdefinition werden, im Rahmen dieser Arbeit, die beiden elementaren Phasen der E-Government-Entwicklung in Deutschland betrachtet. Darüber hinaus wird zur Veranschaulichung sowohl ein "Best-Practice-Beispiel" als auch ein "Worst-Practice-Beispiel" für die Umsetzung von E-Government-Projekten herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinition und -erklärung
- E-Government
- Die zwei Phasen des E-Government in Deutschland
- Phase eins: Initiative BundOnline 2005
- Bewertung der Initiative BundOnline 2005
- EU-Dienstleistungsrichtlinie
- Phase zwei: E-Government 2.0
- Bewertung von E-Government 2.0
- Phase eins: Initiative BundOnline 2005
- Best-Practice-Beispiel auf Bundesebene
- ELSTER Online
- Worst-Practice-Beispiel auf Bundesebene
- ELENA
- Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung des E-Government in Deutschland, insbesondere im Kontext der beiden Phasen BundOnline 2005 und E-Government 2.0. Sie beleuchtet die Bedeutung und den Einfluss von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) auf die öffentliche Verwaltung, die Gestaltung von Bürgerdiensten und die Interaktion zwischen Staat und Bürgern.
- Begriffsdefinition und Bedeutung von E-Government
- Analyse der Initiative BundOnline 2005 und ihrer Bewertung
- Die Rolle der EU-Dienstleistungsrichtlinie für die E-Government-Entwicklung
- Charakterisierung und Bewertung von E-Government 2.0
- Vorstellung von Best-Practice- und Worst-Practice-Beispielen auf Bundesebene
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz von E-Government in Deutschland dar und erläutert den historischen Kontext der Entwicklung. Sie skizziert die Themenbereiche und den Aufbau der Arbeit.
Begriffsdefinition und -erklärung
Dieses Kapitel definiert den Begriff E-Government und zeigt dessen Vielschichtigkeit und unterschiedliche Auslegungen auf. Es wird auf die Bedeutung des Internets als zentrales Werkzeug im E-Government-Kontext eingegangen.
Die zwei Phasen des E-Government in Deutschland
Dieses Kapitel behandelt die beiden zentralen Phasen der E-Government-Entwicklung in Deutschland. Zuerst wird die Initiative BundOnline 2005 analysiert, die als erster Schritt zur Digitalisierung der Verwaltung dient. Es wird auf die Ziele, die Umsetzung und die Bewertung dieser Initiative eingegangen. Des Weiteren wird die Bedeutung der EU-Dienstleistungsrichtlinie für die E-Government-Entwicklung in Deutschland beleuchtet. Schließlich werden die Ziele und Herausforderungen von E-Government 2.0, der zweiten Phase der E-Government-Entwicklung, dargestellt.
Best-Practice-Beispiel auf Bundesebene
Dieses Kapitel zeigt anhand des Beispiels ELSTER Online, wie die Umsetzung von E-Government-Projekten erfolgreich gestaltet werden kann. Es werden die Vorteile und die positiven Auswirkungen von ELSTER Online hervorgehoben.
Worst-Practice-Beispiel auf Bundesebene
Dieses Kapitel analysiert anhand des Beispiels ELENA, welche Herausforderungen und Probleme bei der Umsetzung von E-Government-Projekten auftreten können. Es werden die Ursachen für die negative Entwicklung von ELENA aufgezeigt.
Schlüsselwörter
E-Government, BundOnline 2005, E-Government 2.0, EU-Dienstleistungsrichtlinie, Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), Online-Dienstleistungen, Verwaltungsinformationen, öffentliche Verwaltung, Bürgerdienste, digitale Transformation.
- Arbeit zitieren
- Pablo Wißmüller (Autor:in), 2012, E-Government in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194001