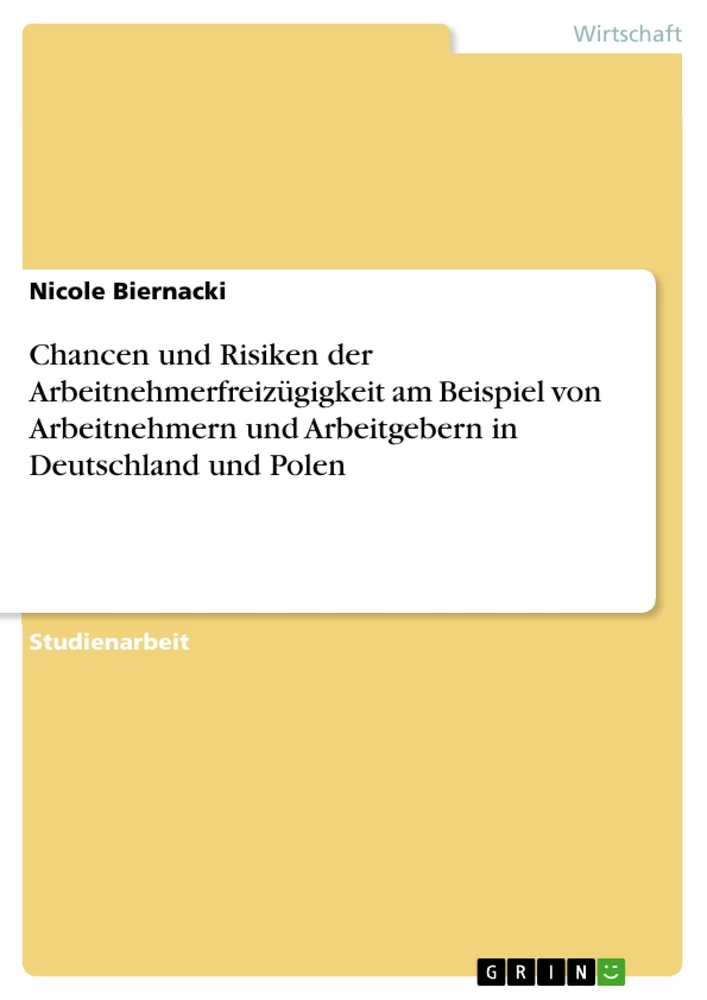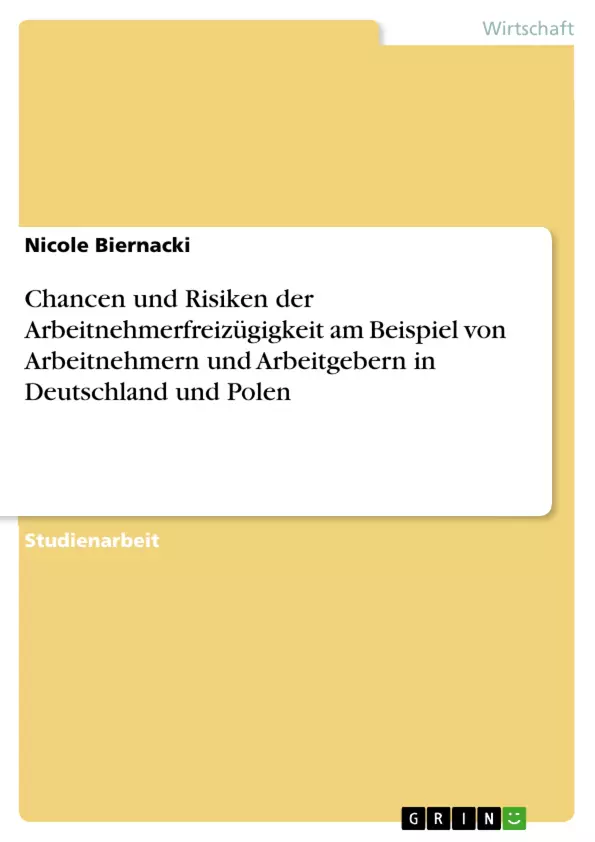Am 1.5.2004 trat die Republik Polen, neben sieben anderen MOE-Staaten, in die Europäische Union ein. Die Strategie der EU, die auch als Lissabon-Strategie bezeichnet wird, ist es, alle europäischen Länder anzugleichen. Sie bemühen sich gemeinsam die Beschäftigung und das Wachstum in Eu¬ropa zu verbessern – ein höheres Wachstum und mehr Beschäftigung in einer umweltfreundlichen Wirtschaft. Die EU will als Einheit eine der wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsräume der Welt werden . Anfang der 90er Jahre wurde ein Europa-Abkommen geschlossen, dass die Reintegration des Kontinents fördern sollte. Desweiteren stand eine umfassende, wirtschaftliche, politische und kulturelle Zusammenarbeit im Vordergrund. Es wurde eine Übergangsphase von zehn Jahren festgelegt, in der sich die Länder rechtlich, marktwirtschaftlich und demokratisch angleichen sollten. Es folge demnach eine Assoziierung, deren große Entwicklung wir heutzutage beobachten können.
Die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist neben dem freien Dienstleistungs-, Kapital- und Warenverkehrs, eine der vier im Europarecht anerkannten Grundfreiheiten. Sie erlaubt den EU-Bürgern uneingeschränkt in anderen Ländern der Europäischen Union zu arbeiten .
Vor dem Eintritt Polens in die EU, entschieden sich Deutschland und Österreich für die Aufschiebung dieser elementaren europäischen Grundfreiheit bis zum 1.5.2011 für Estland, Lettland, Litauen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Polen .
Doch die Wirklichkeit ist, dass wir in den Jahren 1996 bis 2006 2,75 Millionen Arbeitsplätze dem neu geschaffenen Binnenmarkt zu verdanken haben . Außerdem hatten auch viele deutsche Unternehmen Vorteile durch die Öffnung des europäischen Binnenmarktes, da der Warenverkehr nicht mehr durch interne Grenzen behindert wird. Die ausländischen Unternehmen können kostengünstig in Polen produzieren. Dies senkt die Kosten und die Unternehmen können mit niedrigeren Preisen auf dem Markt auftreten.
Doch sind die Fragen hierbei, ob sich die BRD über die Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit Sorgen machen muss? Oder ist dies unbegründet? Profitieren nur die Ost- und Mitteleuropäer davon?
Inhaltsverzeichnis
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Zu den Aspekten der Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU
2.1.Generelle Arbeitnehmerfreizügigkeit
2.2.Begrenzte Arbeitnehmerfreizügigkeit
2.2.1.Werkvertragsvereinbarung
2.2.2.Saisonarbeiter
2.2.3.Gastarbeiter
2.2.4.Grenzgängerbeschäftigung
3. Vergleich der Hauptaspekte der Gründe für Migration zwischen Deutschland und Polen
4. Chancen und Risiken der Arbeitnehmerfreizügigkeit für deutsche und polnische Arbeitnehmer und Arbeitgeber
4.1.Risiken
4.2.Chancen
5. Ausbli>
6. Fazit
Anhang
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU?
Es ist eine der vier Grundfreiheiten der EU, die es Bürgern erlaubt, in jedem Mitgliedsstaat ohne Arbeitsgenehmigung eine Beschäftigung aufzunehmen.
Warum gab es Übergangsfristen für Polen?
Deutschland und Österreich befürchteten eine massive Zuwanderung und Auswirkungen auf das Lohngefüge, weshalb die volle Freizügigkeit erst 2011 eingeführt wurde.
Welche Chancen bietet die Freizügigkeit für deutsche Unternehmen?
Unternehmen profitieren von einem größeren Pool an Fachkräften und der Möglichkeit, kostengünstiger im EU-Binnenmarkt zu agieren und zu produzieren.
Welche Risiken werden im Zusammenhang mit der Migration diskutiert?
Diskutiert werden möglicher Lohndruck in bestimmten Branchen sowie die Abwanderung von qualifizierten Arbeitskräften (Brain Drain) aus den Herkunftsländern.
Was sind Saisonarbeiter und Grenzgänger?
Saisonarbeiter sind für einen begrenzten Zeitraum (z.B. Ernte) im Ausland tätig. Grenzgänger wohnen in einem Land und arbeiten regelmäßig im benachbarten Ausland.
- Citar trabajo
- Nicole Biernacki (Autor), 2011, Chancen und Risiken der Arbeitnehmerfreizügigkeit am Beispiel von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in Deutschland und Polen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194028