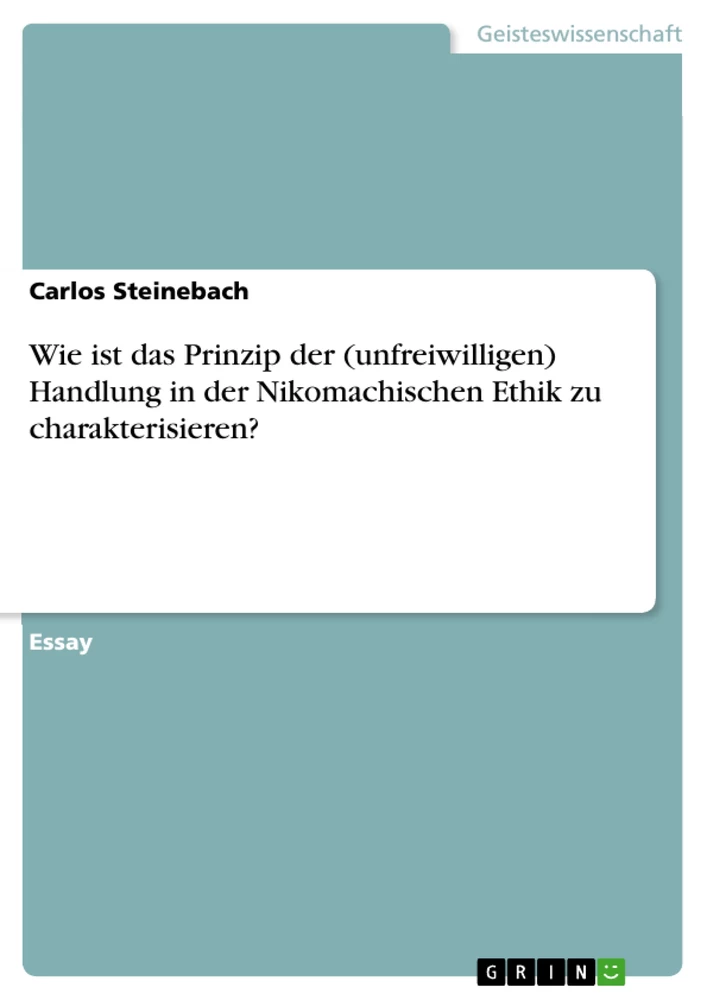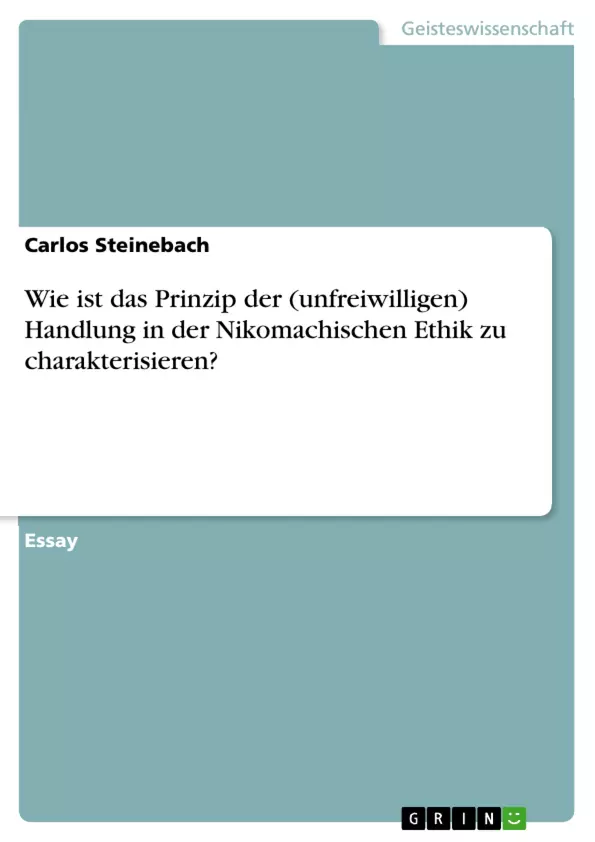Das nachfolgende Essay wird sich mit dem Prinzip der Handlung nach Aristoteles beschäftigen, speziell mit der Frage, wann eine Handlung als unfreiwillig angesehen werden kann. Dabei konnte man im Primärtext die generelle Aufteilung in die Bereiche Bewegung, Wissen und Wollen feststellen. Diese sollen nun anhand einer Auslegung der Nikomachischen Ethik zum Thema „Freiwilligkeit, Entscheidung und Verantwortlichkeit“ von Christof Rapp diskutiert werden.
Wie ist das Prinzip der (unfreiwilligen) Handlung in der Nikomachischen Ethik zu charakterisieren?
Carlos Steinebach
Das nachfolgende Essay wird sich mit dem Prinzip der Handlung nach Aristoteles beschäftigen, speziell mit der Frage, wann eine Handlung als unfreiwillig angesehen werden kann. Dabei konnte man im Primärtext die generelle Aufteilung in die Bereiche Bewegung, Wissen und Wollen feststellen. Diese sollen nun anhand einer Auslegung der Nikomachischen Ethik zum Thema „Freiwilligkeit, Entscheidung und Verantwortlichkeit“ von Christof Rapp diskutiert werden.
Zunächst soll sich dem Aspekt der Bewegung genähert werden. Dabei stellt sich die grundlegende Frage, was es bedeuten kann, dass das Prinzip der Handlung in jemandem liegt und was das genau mit Bewegung zu tun hat. Zunächst sind Bewegungen, deren Ursache außerhalb der betreffenden Personen liegen, nach Aristoteles charakteristisch für eine unfreiwillige Handlung (vgl. 1110a38). Rapp erkennt dies zwar an, sieht es jedoch nicht als wichtiges Merkmal, da durch eine wörtliche Übersetzung Aristoteles‘ unfreiwillige Handlungen nahezu nicht vorkommen können, da es lediglich das „Stattfinden von Bewegung und die Abwesenheit von äußerem Zwang“1 beinhalte. Er sieht die „als Werkzeug gebrauchten Gliedmaßen“2, wie Rapp Aristoteles zitiert, dahingehend agieren, dass die getätigten Bewegungen nicht um der Bewegung willen ausgeführt werden, sondern immer einen anderen Zweck verfolgen (sich beispielsweise unbedacht durch das Gesicht zu streichen). Daher könne man nur von einer unfreiwilligen Handlung in Bezug auf die Erfüllung des Kriteriums „Bewegung“ sprechen, wenn ein anderer die eigene Hand führt. Dies erscheint mir jedoch zu eng gedacht. Denn selbstverständlich sind freiwillige Handlungen solche, die ein Mensch im Bewusstsein tut, etwas anderes zu erreichen. Doch wie ist beispielsweise eine Verteidigungssituation in dieser Hinsicht zu verstehen? Angenommen man ist unbewaffnet und wird mit einem Messer angegriffen, so versucht man, ohne dass man eigentlich in die Klinge fassen möchte, mit der Hand schlimmeres Übel abzuwenden. Es ist nun fraglich, ob solch eine Handlung bereits in die Kategorie der Handlungen gemischter Natur zu verorten ist oder tatsächlich eine unfreiwillige Handlung beschreibt. Oder wie ist es zu beschreiben, wenn man von einem Ort weggetragen wird, ohne dass man diesen verlassen möchte? Zappeln und sich wehren sind ebenfalls in diesem Fall Handlungen, die vom agens primär so nicht ausgeführt werden wollen, die Umstände es jedoch nicht anders erlauben. Meiner Einschätzung nach sind solche Fälle in den Bereich der unfreiwilligen Handlung einzuordnen, da die Ursache der Bewegung eindeutig von außen kommt. Daher muss ich Christof Rapp in seinen Ausführungen widersprechen, denn Bewegung kann durchaus als wichtiger Aspekt in der Frage nach der Freiwilligkeit oder Unfreiwilligkeit einer Handlung angesehen werden.
Der zweite Aspekt beschreibt den des Wissens. Auch hier ist die Betrachtung des Antonyms, des Unwissens, ein zentraler und wichtiger Punkt, wenn es um unfreiwilliges Handeln geht. Aristoteles führt drei markante Beispiele an, in denen die Unwissenheit die Unfreiwilligkeit der Handlung prägt. Das erste Beispiel ist das Verraten eines Geheimnisses, ohne zu wissen, dass es eines ist (1111a8ff.), das zweite das Schlagen einer Person, ohne zu wissen, dass es der eigene Vater ist (1135a28ff.) und das dritte das Betätigen einer Wurfmaschine, wodurch jemand aus Versehen getötet wird. In diesem Fall ist Rapp zuzustimmen, dass in den ersten beiden Beispielen ein klares Nichtwissen zu erkennen ist, doch die Handlung im dritten Fall erscheint nicht plausibel für einen kognitiven Mangel. So ist der agens sich bewusst, dass er mit dieser Maschine töten kann, tut dies jedoch im Moment der Vorführung nicht ohne Wissen, sondern ohne Absicht. Demnach ist die Absichtlichkeit ein Kriterium innerhalb der Unwissenheit.3 Eine Handlung, die also eine andere actio nach sich zieht, als diese vom agens intendiert ist, wäre als unfreiwillige Handlung zu bezeichnen. Weiterhin bezieht er sich auf den Aspekt Aristoteles, bei dem er eine Handlung aus Trunkenheit und Zorn als unwissende Handlung, jedoch nicht als Handlung aus Unwissenheit bezeichnet (1110b24-27). Dabei erscheint mir, dass nicht ganz klar wird, ob Trunkenheit und Zorn nun als Entschuldigung für unfreiwillige Handlung gelten kann oder nicht. Ich sehe den Aspekt so, dass der Mensch eine freiwillige Handlung vollführt, indem er entscheidet, ob er sich betrinkt oder nicht. Wenn er dann aufgrund der Trunkenheit agiert, kann diese Handlung nie als unfreiwillige Handlung angesehen werden, da dieser Mensch auf einer vorherigen Stufe der Entscheidung freiwillig den Rausch wählte. Jedoch erscheint mir die Gleichstellung von Zorn und Trunkenheit in Bezug auf unfreiwillige Handlungen unglücklich. So ist Zorn eine Emotion, die zwar ebenfalls die Sinne umnebeln kann wie Alkohol, ein Mensch sich jedoch nicht (immer) bewusst dafür entscheiden kann, nun zornig zu sein. Eine andere Kategorisierung erscheint hier sinnvoller. Unmoralische und schlechte Handlungen sind jedoch in jedem Fall nach Aristoteles nicht durch Unwissen, Trunkenheit oder Zorn zu entschuldigen. Diese sind dann nämlich keine Handlungen aus Unwissenheit mehr, sondern Handlungen, die unwissend geschehen. Zutreffend beschreibt Rapp den Unterschied darin, dass bewusste unmoralische oder schlechte Handlungen nicht bereut werden (jedenfalls meist nicht sofort nach dem Handeln), jedoch für eine unfreiwillige Handlung Reue vonnöten ist.4
Schließlich soll der Aspekt des Wollens näher beleuchtet werden. Eng damit verbunden ist das genaue Gegenteil, nämlich der Zwang. Dieser ist von zentraler Bedeutung in Aristoteles Werk, da eine Handlung gemischter Natur damit charakterisiert wird, dass sie aus Zwang oder Unwissenheit geschieht. Dies hat vor allem eine zentrale Bedeutung auf die Wirkung dieser Handlung nach außen. Eine solche Handlung, auch wenn sie unmoralisch ist, wird durch die Gesellschaft akzeptiert und nicht als Fehlverhalten angesehen. Wie jedoch ist der Kern einer solchen Handlung zu ergründen und kann das „Wollen“, sprich die bewusste Ausübung einer Tätigkeit im Kontext einer teils unfreiwilligen Handlung überhaupt bestehen? Rapp nähert sich einer Erklärung dahingehend an, dass er die Begriffe Moral und Zwang zunächst gegenüberstellt. Die Handlung ist allein betrachtet unmoralisch, wird jedoch durch die Umstände dahingehend legitimiert, dass die Gesellschaft Verständnis dafür findet.5 Es wird demnach freiwillig eine unfreiwillige Handlung vollführt. Wieso kann jedoch die unfreiwillige Handlung, die offensichtlich gewollt ist, als legitim gelten? Der Schlüssel dazu scheint in der „akzidentellen Auslegung“6 von Aristoteles zu liegen. Diese wird durch ein Beispiel erläutert: Ein Koch kann zwar Genuss erzeugen, aber nicht Gesundheit. Übertragen auf eine Handlung gemischter Natur würde das bedeuten, dass vordergründig die Unfreiwilligkeit herrscht, hintergründig die Freiwilligkeit, die eine moralisch verwerfliche Handlung vollzieht. Das Sprichwort „Der Zweck heiligt die Mittel“ scheint an dieser Stelle zutreffend, die unmoralische Handlung ist lediglich eine „Nebenwirkung“7 der Handlung, die eigentlich ein moralisches Ziel hat, nämlich seine geliebten Angehörigen vor Leid und Schmerz zu schützen. Mir erscheint in diesem Zusammenhang der Begriff der Abwägung und des Verstandes angebracht. Handlungen, die ein Mensch bewusst vollführt (gerade solche, die aus Zwang entstehen), werden auf ihren Kosten-Nutzen-Faktor reduziert und daraufhin entschieden. Es ist zwar nicht moralisch, jedoch durchaus denkbar und menschlich, dass jemand einen Zwang nicht ausführen kann, weil der Preis für ihn selbst zu hoch ist, obwohl er damit das Leid seiner Geliebten riskiert. Auch eine solche Entscheidung ist eine Frage der Abwägung, des Wollens und letztlich eine freiwillige Handlung mit unfreiwilligen Vorzeichen.
Zusammenfassend ist deutlich geworden, dass die drei Pfeiler Bewegung, Wissen und Wollen das Prinzip der Handlung insofern charakterisieren, dass sie die Kehrseite, nämlich die Merkmale der unfreiwilligen Handlung deutlich machen. Rapp arbeitet hier stark mit Antonym-Paaren und versucht damit eine Abgrenzung, der ich, wie man sehen konnte, teilweise zustimmen kann. Eine pauschale Kategorisierung von freiwilligen und unfreiwilligen Handlungen erscheint mir jedoch nicht möglich, es muss von Situation zu Situation abgewogen und entschieden werden und sicherlich werden die Meinungen stets auseinander gehen. Jedoch können die Aspekte Bewegung, Wissen und Wollen eine plausible Argumentationsgrundlage bieten.
[...]
1 RAPP 2006: 113.
2 Ebd.: 113.
3 Vgl. RAPP 2006: 115-116.
4 Vgl. RAPP 2006: 118.
5 Vgl. ebd.: 111.
6 Ebd.: 114.
7 Ebd.: 114.
Häufig gestellte Fragen
Wann gilt eine Handlung laut Aristoteles als unfreiwillig?
Eine Handlung ist unfreiwillig, wenn sie durch äußeren Zwang geschieht oder auf Unwissenheit über die konkreten Umstände beruht.
Was sind Handlungen "gemischter Natur"?
Das sind Handlungen, die unter Zwang begangen werden (z. B. eine Straftat, um Angehörige zu retten). Sie sind im Moment der Ausführung zwar gewollt, aber unter normalen Umständen würde man sie nie wählen.
Welche Rolle spielt die Reue bei unfreiwilligen Handlungen?
Aristoteles unterscheidet: Nur wer eine Tat aus Unwissenheit später bereut, hat wirklich unfreiwillig gehandelt. Wer keine Reue zeigt, handelt zwar "nicht-freiwillig", aber nicht im strikten Sinne entschuldbar.
Gilt Trunkenheit als Entschuldigung für Unwissenheit?
Nein. Wer im Rausch handelt, handelt zwar unwissend, ist aber für diesen Zustand selbst verantwortlich. Die Ursache liegt im Handelnden selbst, daher bleibt er verantwortlich.
Was bedeutet der Aspekt der "Bewegung" in der Nikomachischen Ethik?
Es geht um den Ursprung (arché) der Bewegung. Liegt dieser außerhalb des Menschen (z. B. wenn man weggeschleppt wird), ist die Handlung unfreiwillig.
- Citation du texte
- Carlos Steinebach (Auteur), 2012, Wie ist das Prinzip der (unfreiwilligen) Handlung in der Nikomachischen Ethik zu charakterisieren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194030